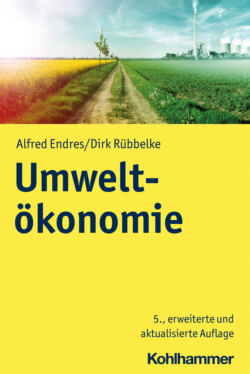Читать книгу Umweltökonomie - Dirk Rübbelke - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Ordinalität und Kardinalität des Nutzenkonzepts: Die Zahlungsbereitschaft als Näherungsgröße
ОглавлениеAkzeptiert man trotz der vorgetragenen Bedenken (vielleicht mangels einer überlegenen Alternative) das Konzept der Konsumentensouveränität, so ist man auf dem Wege zur Definition eines Optimums, das mit der Internalisierung erreicht werden soll, schon bald mit einem neuen Hindernis konfrontiert. Selbst wenn die Nutzeneinschätzungen der Betroffenen für die Lage des Optimums entscheidend sein sollen, ist noch nicht gesagt, wie diese (konzeptionell und praktisch) zu messen seien. In der modernen Mikroökonomie ist der Nutzen nämlich ein ordinales, nicht aber ein kardinales Konzept.
Für viele Anwendungsbereiche (auch: Forschungsprogramme) der Wirtschaftstheorie ist es auch hinreichend, mit einem Nutzenkonzept zu arbeiten, nach dem die Betroffenen in der Lage sind, Zustände nach ihrer Erwünschtheit zu ordnen, ohne den dabei empfundenen Nutzen quantitativ und interpersonell vergleichbar bewerten zu können. Eben dies ist jedoch für die Charakterisierung eines sozialen ökonomischen Optimums, z. B. einer optimalen Emissionsmenge, nötig. Die Aussage, die optimale Emissionsmenge sei dadurch gekennzeichnet, dass Grenzvermeidungskosten und Grenzschäden einander angeglichen sind, impliziert, dass beide Größen in ein und derselben Dimension quantitativ angegeben werden können. Abgesehen von den praktischen Mess-Schwierigkeiten muss zunächst auf das konzeptionelle Problem hingewiesen werden: Sowohl bei den Umweltschäden als auch bei den Vermeidungskosten handelt es sich um Nutzeneinbußen. Letztere stellen die Nutzeneinbußen beim Verzicht auf die Verwendung von Ressourcen für alternative (z. B. konsumtive) Zwecke dar (»Opportunitätskosten«). Definiert man das ökonomische Optimum so, wie dies oben dargestellt worden ist, so akzeptiert man als Näherungsgröße für den streng genommen nicht kardinal messbaren Nutzen die Zahlungsbereitschaft (bzw. Entschädigungsforderung)55 des entsprechenden Entscheidungsträgers. Die oben für die Bewertung von Konsumgütern herangezogene Nachfragekurve gibt ja, wie dort schon erläutert, nichts anderes als die marginale Zahlungsbereitschaft des betreffenden Konsumenten für das Gut an. Analog gibt die Grenzschadenskurve aus Abbildung 2 die Bereitschaft des Betroffenen an, für die Zurückführung des Schadens zu zahlen. In einer anderen (verwandten) Lesart gibt sie die Zahlungsforderung des Geschädigten für die Duldung des externen Effektes an.
Es ist also festzuhalten: Verwendet man das Konzept der Internalisierung externer Effekte, so strebt man umweltpolitisch ein nach ökonomischen Kriterien definiertes Optimum an. Für die Konstitution dieses Optimums werden als Werte Marktwerte verwendet. Für marktfähige Güter wird die Bewertung, die ein »idealer« (d. h. insbesondere durch vollständige Konkurrenz gekennzeichneter) Markt vornimmt, akzeptiert.56 Für Güter, die nicht unmittelbar über Märkte bewertet werden, wird die Bewertung mit Hilfe des Zahlungsbereitschaftskonzepts auf marktanaloge Weise vorgenommen.57
Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass bei der Verwendung von Marktwerten oder über marktanaloge Verfahren gewonnenen Substituten von Marktwerten neben den Präferenzen der Betroffenen auch deren Einkommen bzw. Vermögen in die Bewertung eingehen. Denn selbstverständlich ist ein »reicher« Entscheidungsträger in der Lage, auf dem Markt eine höhere Zahlungsbereitschaft zu artikulieren als ein »armer«. Es soll hier gar nicht untersucht werden, ob dies grundfalsch ist und stattdessen die Wertung jedes Individuums mit demselben Gewicht in die soziale Bewertung eingehen sollte. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass mit der unkorrigierten Verwendung von Zahlungsbereitschaften als Wertgrößen die zugrunde liegende Einkommensverteilung implizit akzeptiert wird.