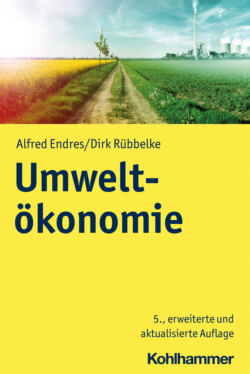Читать книгу Umweltökonomie - Dirk Rübbelke - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A. Wirtschaftstheoretische Grundlagen I. Gegenstand und Methoden der mikroökonomischen Theorie
ОглавлениеDie Mikroökonomie ist die Wissenschaft von der Knappheit und der Bewältigung von Knappheitsfolgen. Knappheit entsteht dadurch, dass die zur Deckung der Bedürfnisse der Menschen vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen, um alle vorhandenen Wünsche zu erfüllen. Der Begriff der Knappheit bezieht sich also hier nicht (nur) auf das Fehlen des Notwendigsten, sondern auf jede Divergenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Die zentralen Begriffe der »Bedürfnisse« und »Ressourcen« sind in der modernen Ökonomie sehr weit gefasst.
Der Begriff des Bedürfnisses transzendiert den umgangssprachlich üblicherweise als »ökonomisch« bezeichneten Bereich von Ernährung, Wohnen, Bekleidung, Transport usw. bei weitem und umfasst häufig als »außerökonomisch« verstandene Bedürfnisse, wie das nach sauberer Umwelt, innerer und äußerer Sicherheit, ja sogar die Sehnsucht nach Harmonie und Geborgenheit in der Partnerschaft.3
Auch der Begriff der Ressourcen ist in der modernen ökonomischen Literatur nicht mehr auf die traditionellen Produktionsfaktoren – (Erwerbs-)Arbeit, Kapital und Boden – beschränkt. Vielmehr werden heute auch die natürlichen (erschöpflichen wie regenerierbaren) Ressourcen oder das menschliche Wissen und die Arbeitsmoral in einer Gesellschaft berücksichtigt.
Eine Welt der Knappheit ist notwendigerweise durch Konflikte um die kostbaren (weil zur Minderung der Knappheit erforderlichen) Ressourcen charakterisiert. Keine Gesellschaft ist ohne Mechanismen und Institutionen zur Regelung dieser Konflikte denkbar. Die Regeln, mit denen knappe Ressourcen auf die allzu zahlreichen Träger der allzu zahlreichen Bedürfnisse aufgeteilt werden können, sind sehr vielfältig. Zu denken ist etwa an die Anwendung des Gesetzes des Dschungels, basisdemokratische Entscheidungsverfahren, den Marktmechanismus oder patriarchalische (matriarchalische) Zuweisungen. Die meisten Gesellschaften praktizieren eine Mischung dieser verschiedenen Allokationsmechanismen mit unterschiedlich starker Ausprägung ihrer Komponenten. Die moderne Wirtschaftstheorie hat sich überwiegend mit dem Markt als Allokationsmechanismus beschäftigt, aber auch die anderen oben erwähnten Mechanismen (und weitere) behandelt.
Für den (sicherlich geringen) Teil der Leserschaft, der an der Relevanz der obigen Ausführungen für die Umweltpolitik zweifelt, sei verdeutlicht: Betrachten wir den Luftraum über einer bestimmten Region als knappe Ressource, um die verschiedene Ansprüche konkurrieren: Firmen möchten die Luft als Aufnahmemedium für ihre Schadstoffe verwenden, Anwohner möchten die Luft einatmen. Die oben genannten Allokationsmechanismen können auch als Institutionen zur Regelung dieses Konflikts eingesetzt werden.
Nach dem Gesetz des Dschungels würde sich die »aggressive« Nutzungsform der Emittenten gegen die »defensive« Nutzungsabsicht der Anwohner uneingeschränkt durchsetzen.4
Der Allokationsmechanismus der autoritären Zuweisung würde im Beispielsfall bedeuten, dass den Firmen Emissionshöchstgrenzen vorgegeben werden. Damit wäre implizit eine Aufteilung der knappen Ressource zwischen Firmen und Anwohnern fixiert.
Mehr oder weniger am marktlichen Allokationsmechanismus orientierte Lösungen bestünden etwa in Verhandlungen zwischen potentiellen Verursachern und potentiellen Geschädigten5 oder in der Vergabe von Emissionszertifikaten6.
Als basisdemokratische Variante wäre eine Volksabstimmung über die Emissionsniveaus (oder Ansiedlung bzw. Schließung) der betreffenden Firmen denkbar.
Im Zusammenhang mit der Analyse von Mechanismen zur Entscheidung über die Verwendung knapper Ressourcen und die Früchte ihres Einsatzes sind für die ökonomische Theorie insbesondere zwei Fragen interessant:
a) Welche Verwendung der knappen Ressourcen wird in einer Volkswirtschaft insgesamt als Resultat der zahlreichen Entscheidungen von zahlreichen einzelnen Entscheidungsträgern vorgenommen?Hier geht es darum zu erfahren, in welcher Weise die Rahmenbedingungen, unter denen die Individuen ihre Entscheidungen treffen, z. B. die Technologie oder die Rechtsordnung, die allokativen Ergebnisse beeinflussen. Wir bezeichnen diesen Teil der mikroökonomischen Theorie als »positive Analyse«.
b) Wie ist das im ersten oben genannten Schritt festgestellte (oder prognostizierte) Allokationsergebnis aus volkswirtschaftlicher Sicht zu bewerten?Dieses weitergehende Programm der mikroökonomischen Theorie bezeichnen wir als »normative Analyse«.
Viele Ökonominnen und Ökonomen sind besonders davon fasziniert, das tatsächlich von einem bestimmten Allokationsmechanismus erreichte Ergebnis mit einem »optimalen« Ergebnis zu vergleichen. Natürlich ist es für dieses Unterfangen nötig, ein gesellschaftliches Optimalitätskriterium zu entwickeln. Wird bei der Analyse des Marktmechanismus festgestellt, dass das Marktergebnis (»Gleichgewicht«) vom Optimum abweicht, so ist dies für den Ökonomen/die Ökonomin Anlass, über Korrekturmechanismen nachzudenken.7
Im Folgenden wird ausführlich dargelegt, dass die Existenz von Umweltproblemen (in der ökonomischen Terminologie: »externen Effekten«) eine Abweichung zwischen Marktgleichgewicht und Optimum begründet. Die im Zweiten Teil des Buches thematisierte »Internalisierung externer Effekte« ist nichts anderes als der Versuch, wirtschaftspolitische Korrekturen am Marktmechanismus mit dem Ziel vorzunehmen, Gleichgewicht und Optimum zur Deckung zu bringen.
Natürlich ist der Anspruch, die Politik solle einen optimalen Zustand herstellen, im Bereich der Umweltpolitik – wie in jedem anderen Bereich – aus mancherlei Gründen zu hoch gegriffen. Dennoch lohnt es sich, den Begriff der Optimalität zu operationalisieren und strukturelle Ursachen für Fehllenkungen des Marktmechanismus durch eine Konfrontation des Marktgleichgewichts mit dem Optimum aufzudecken. Wenn auch das Optimum in der Realität wohl nie erreicht werden wird, so könnte es doch eine Orientierungshilfe für die Umweltpolitik liefern, der der Blick für die einzuschlagende Richtung allzu oft (aber doch auch verständlicherweise) durch das Gestrüpp von Alltagsproblemen verstellt wird.
Allerdings werden der in der Ökonomie verwendete Optimalitätsbegriff und das Konzept der Internalisierung externer Effekte als idealtypisches Instrument zur Herstellung optimaler Zustände nicht kritiklos empfohlen. Vielmehr weisen wir auch auf die Tücken dieser Konzeptionen hin. Freilich sollte diese kritische Darstellung nicht als ablehnende Haltung der Autoren gegenüber den Internalisierungsstrategien missdeutet werden. Die Eignung der Internalisierung externer Effekte als Orientierungshilfe für die praktische Umweltpolitik muss nämlich anhand eines Vergleiches mit den tatsächlich zur Verfügung stehenden Alternativen gemessen werden. Wie unten ausführlicher begründet, sind die Autoren der Auffassung, dass die Internalisierungsstrategien (und andere auf der Grundlage der ökonomischen Theorie entwickelte Instrumente) trotz aller Defekte eher niedrig auf der Skala der Mangelhaftigkeit rivalisierender umweltpolitischer Strategien rangieren.
Vielleicht ist den Vertreterinnen und Vertretern anderer Disziplinen (als der Ökonomie) unter den Lesern noch eine methodologische Vorbemerkung nützlich:
Typisch für die Herangehensweise der Ökonominnen und Ökonomen an die hier angesprochenen (und andere) Fragen ist die modelltheoretische Analyse. Es geht in der ökonomischen Theorie nicht darum, alle in der Welt auftretenden Einzelfälle von Allokationsproblemen in allen ihren historisch zustandegekommenen Einzelheiten zu beschreiben. Dies wäre sicher ein ermüdendes und fruchtloses Unterfangen.8 Vielmehr geht es darum, die gemeinsame Struktur herauszuarbeiten, die verschiedenen Klassen von Einzelfällen zugrunde liegt (insbesondere bezüglich der Anreizwirkungen von Rahmenbedingungen auf die Entscheidungsträger). Hierbei ist es unverzichtbar, von vielerlei Einzelheiten konkreter Anwendungsfälle zu abstrahieren.9 Ein Beispiel: Der Markt für Entsorgungsleistungen im Abfallbereich unterscheidet sich sicherlich in vielem vom Markt für Bananen und dieser wieder vom Markt für Computersoftware. Dennoch sind alle drei Bereiche durch die Kategorie »Markt« vereint. Die Wirtschaftstheorie versucht, die gemeinsame Struktur der unterschiedlichen Märkte, also das »Wesen« des Marktes, herauszuarbeiten. Sie entwickelt dafür Kategorien wie Spezialisierung und Tausch, Angebot und Nachfrage, Effizienz und technischer Fortschritt, Konkurrenz (oder ihre Abwesenheit) und viele mehr. Diese spielen auf allen Märkten eine Rolle und können so zum gemeinsamen Verständnis der vielgestaltigen Einzelmärkte verwendet werden.
Das Ergebnis des hier angesprochenen Abstraktionsprozesses wird in der ökonomischen Theorie mit »Modellen« beschrieben. Hierbei handelt es sich um abstrakte Ursache-Wirkungssysteme. Sie stellen das Zusammenwirken der für das Untersuchungsziel des Modells als wesentlich angesehenen Elemente der Realität stilisiert dar. Betrachten wir als Beispiel ein Modell, mit dem das Verhalten einer Firma erklärt werden soll. Es setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
a) Definitionen (Beispiel: Gewinn = Erlös – Kosten)
b) Annahmen über das Verhalten der Entscheidungsträgerin/des Entscheidungsträgers (Beispiel: Die Firma strebt danach, ihren Gewinn zu maximieren.)
c) Annahmen über die Rahmenbedingungen, unter denen die Entscheidungsträgerin/der Entscheidungsträger ihrem/seinem Ziel näherkommen kann (Beispiel: Die Firma verfügt über eine Monopolstellung.)
d) Schlussfolgerungen (Beispiel: Die Firma produziert eine Menge, für die der Grenzerlös den Grenzkosten gleichkommt.)
Die Konstruktion von Annahmen, auf denen das Modell beruht, ist ein besonders wichtiges und schwieriges Unterfangen: Einerseits sollen die Annahmen geeignet sein, das zu analysierende Problem einfach darzustellen. Eine der wichtigsten Aufgaben des Modells besteht schließlich darin, die den Betrachter häufig zur Resignation treibende hohe Komplexität der Realität zu reduzieren. Andererseits dürfen die Annahmen aber nicht so einfach konzipiert werden, dass sie die »wesentlichen« Aspekte des zu analysierenden Problems aus der Modellbetrachtung ausblenden. Die Konstruktion von Optimierungsmodellen stellt also selbst ein Optimierungsproblem dar.
Diese Optimierung ist ohne Wertung des Analysierenden nicht möglich, denn er muss darüber befinden, welche Aspekte des zu untersuchenden Problems aus seiner Sicht »wesentlich« sind und welche anderen dagegen vernachlässigt werden können. Der hier im Zusammenhang mit der ökonomischen Modellbildung auftretende enge Zusammenhang zwischen Optimierung und Wertung wird uns unten bei der Erörterung optimaler Emissions- oder Sicherheitsniveaus noch weiter beschäftigen. Natürlich kommt die analysierende Ökonomin/der analysierende Ökonom bei der Wertung nicht mit »objektiver Wissenschaftlichkeit« allein aus. Vielmehr muss sie/er auch (ob sie/er dies merkt oder nicht) ihre/seine eigene wissenschaftliche und persönliche Sozialisation in den Prozess ihrer/seiner Modellbildung einbringen.10
Zugegeben: Die obige Erklärung des »Modells« ist einigermaßen abstrakt geraten, ganz ähnlich übrigens wie das Modell selbst. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Wir versuchen es nun etwas anschaulicher und sichern uns dabei die Unterstützung des englischen Romanciers David Lodge. In seinem Roman »Thinks« (London 2001) lässt er seinen Protagonisten erklären, was ein Roman ist. Wir übersetzen die betreffende Passage und ersetzen dabei das bei der Vorlage verwendete Wort »Roman« durch »ökonomische Modelle«:11
»Ökonomische Modelle sind eigentlich Gedankenexperimente. Der Autor erfindet Leute, setzt sie hypothetischen Situationen aus und zeigt, wie sie reagieren. Das Gedankenexperiment ist geglückt, wenn das Verhalten des Protagonisten interessant und plausibel ist und darüber hinaus etwas über die Natur des Menschen und der menschlichen Gesellschaft enthüllt.«
Verweilen wir doch noch ein wenig bei belletristisch vermittelten Analogien. (Weil’s so schön ist.)
Häufig wird das Verhältnis zwischen ökonomischer Theorie und Realität mit dem Verhältnis zwischen einer Landkarte und dem auf der Landkarte verzeichneten Gebiet verglichen. Die Karte abstrahiert von zahlreichen realen Eigenschaften des Gebiets und bietet stattdessen eine nach geografischen Kriterien vorgenommene Stilisierung. Man sieht auf der Karte viele wichtige Eigenschaften des Gebiets nicht, z. B. ob die Häuser im Wohngebiet schön sind und inwieweit der angrenzende Wald geschädigt ist. Dennoch bietet die Karte wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Gebiets und Orientierung für denjenigen, der sich darin bewegen möchte. Dies nimmt die ökonomische Modelltheorie mit Blick auf die von ihr stilisierten Eigenschaften von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ebenfalls für sich in Anspruch.
Dass derartige Stilisierungen auch ihren ästhetischen Wert haben können, wird in dem 2010 unter dem Titel La Carte et le Territoire bei Flammarion in Paris erschienenen Roman von Michel Houellebecq deutlich. Erzählt wird (unter anderem) die Geschichte des berühmten Malers Jed Martin, der in einer bestimmten Phase seines Schaffens Fotografien (hoch künstlerische, versteht sich!) von Michelin-Landkarten herstellt. Über die Ausstellung, die ihm zum Durchbruch verhilft, heißt es auf Seite 77 f. der 2012 bei Dumont erschienenen deutschen Ausgabe Karte und Gebiet:
»Der Eingang zur Ausstellung war halb von einer großen Tafel versperrt, die zu beiden Seiten einen Durchgang von zwei Metern Breite frei ließ und auf der nebeneinander ein Satellitenfoto von der Umgebung des Großen Belchen und die Vergrößerung einer Michelin-Departmentalkarte vom selben Gebiet zu sehen waren. Der Kontrast war frappierend: Während auf dem Satellitenfoto nur eine Suppe aus mit verschwommenen bläulichen Flecken übersäten, mehr oder weniger einheitlichen Grüntönen zu erkennen war, zeigte die Karte ein faszinierendes Netz von Landstraßen, landschaftlich schönen Strecken, Aussichtspunkten, Wäldern, Seen und Pässen. Über den beiden Fotos stand in schwarzen Lettern der Titel der Ausstellung: ›Die Karte ist interessanter als das Gebiet‹«.