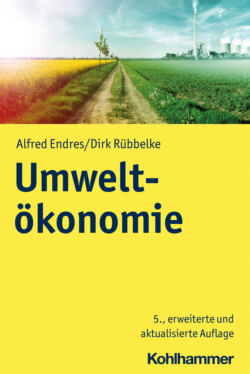Читать книгу Umweltökonomie - Dirk Rübbelke - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеIn diesem Buch werden Umweltprobleme und Umweltpolitik mit den Methoden der Mikroökonomie untersucht. Dabei soll die ökonomische Struktur herausgearbeitet werden, die den vielfältigen praktischen Problemen und Problemlösungsversuchen zugrunde liegt. Besonderes Augenmerk gilt der Anreizstruktur, der die Träger umweltrelevanter Entscheidungen infolge von Marktmechanismus, staatlichen Regulierungen und internationalen Institutionen ausgesetzt sind. Um die grundsätzliche Ebene der Erörterung nicht vom Boden der Realität abheben zu lassen, werden häufig die Bezüge der wirtschaftstheoretischen Analyse zu praktischen Problemen und Lösungsansätzen hergestellt. Angesichts der großen umweltpolitischen Bedeutung und der großen Ergiebigkeit für die umweltökonomische Analyse geschieht dies besonders ausführlich bei der Behandlung des Klimaschutzabkommens von Paris und des europäischen Emissionshandels.
Das Buch versucht, neueste Entwicklungen in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion aufzunehmen. Dennoch soll es auch für Leserinnen und Leser verständlich sein, die »lediglich« über Grundkenntnisse der Volkswirtschaftslehre verfügen, wie sie in den ersten drei Semestern eines wirtschaftswissenschaftlichen Studienganges vermittelt werden. Die Autoren nehmen nicht für sich in Anspruch, diese schwierige Kombination von Zielen erreicht zu haben. Sie ins Auge zu fassen, war jedoch bei der Arbeit stets hilfreich.
Auch »Nebenfachökonomen«, die mit dem Mut zur Lücke die für sie unverständlichen Passagen souverän überblättern, sollten insgesamt vom vorliegenden Text profitieren können. (Mögen die betreffenden Passagen nicht allzu zahl- oder umfangreich sein.) So könnte das Buch einen Beitrag zum Abbau der Sprachbarrieren zwischen den »Kernökonomen« und dem »Rest der Welt« leisten. Gerade im Umweltbereich, wo die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Fachrichtungen unverzichtbar ist, wäre eine »Übersetzungshilfe« besonders wichtig.
Wegen der festen Verankerung der Umweltökonomie in der traditionellen Mikroökonomie werden im Ersten Teil die wirtschaftstheoretischen Grundlagen recht ausführlich behandelt. Wir haben bei unserer jahrelangen Teilnahme an der wissenschaftlichen und politischen Umweltdiskussion den Eindruck gewonnen, dass viele Kommunikationsschwierigkeiten auf die mangelnde Vermittlung des wirtschaftstheoretischen Fundaments der Umweltökonomie zurückzuführen sind. Im Zentrum des ersten Teils steht daher eine durch die Notwendigkeiten der folgenden umweltökonomischen Analyse geprägte Darstellung des Wesens und der Optimalität von Marktgleichgewichten.
Die aus ökonomischer Sicht für die Umweltprobleme kennzeichnenden externen Effekte erscheinen dabei als Störungen der Fähigkeit des Marktmechanismus, »sozial optimale« Ergebnisse hervorzubringen. Die umweltpolitische Leitidee der »Internalisierung externer Effekte« stellt den Versuch dar, die verlorene soziale Optimalität des Marktsystems wiederherzustellen. Bei der Darstellung wird besonderes Gewicht darauf gelegt, die dem in der Ökonomie verwendeten Optimalitätskonzept und damit auch dem Konzept der Internalisierung externer Effekte zugrunde liegenden Werturteile herauszuarbeiten. Dieser Teil des Buches richtet sich insbesondere an die »Nebenfachökonomen« unter den Lesern. Er könnte aber auch für »Kernökonomen« nützlich sein, die bei der fortgesetzten Beschäftigung mit modelltechnischen Details die Tatsache aus dem Blick verloren haben, dass die Ökonomie keine Ingenieur- oder Naturwissenschaft ist. Insbesondere ergibt sich, dass das in der Wirtschaftswissenschaft verwendete Optimalitätskonzept keineswegs geeignet ist, umweltpolitische Ziele jenseits des Gestrüpps divergierender Interessen in einer Gesellschaft »objektiv« zu formulieren. Die Lage volkswirtschaftlich optimaler Umweltzustände hängt vielmehr u. a. von den Präferenzen und Einkommen aller (im weitesten Sinne) vom Zustand der Umwelt Betroffenen ab. Ferner wird sie vom Stand der Technik beeinflusst. Auch dieser wird auf vielfältige Weise durch gesellschaftliche Prozesse geprägt. Optimalität ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff.
Nach der Klärung der wirtschaftstheoretischen Grundfragen werden im Zweiten Teil die wichtigsten Strategien der Internalisierung externer Effekte dargestellt und diskutiert.
Dabei wird zunächst (in Kapitel A) das von Ronald Coase (1960) vorgeschlagene Modell der Verhandlungen zwischen den an einem externen Effekt beteiligten Parteien erörtert. Die Coase‘schen Überlegungen sind für das Verständnis der Theorie externer Effekte grundlegend. Sie fügen sich nahtlos in die ökonomische Markttheorie ein. Externe Effekte erscheinen als Lücken im Marktsystem, die durch eine entsprechende Ausweitung des marktlichen Geltungsbereiches geschlossen werden. In der Coase‘schen Welt ist es denkbar, dass der Verursacher eines externen Effekts den Geschädigten dafür kompensiert, dass Letzterer die schädigende Aktivität erlaubt. Andererseits ist jedoch auch ein Arrangement denkbar, bei dem der Geschädigte den Verursacher für eine Reduktion der Externalität bezahlt. Mit dieser symmetrischen Behandlung sprengt Coase die traditionelle Rollenverteilung, bei der a priori der Verursacher als Täter und der Geschädigte als Opfer auftritt. Ebenso verhält es sich bei der Verursacherin als Täterin und der Geschädigten als Opfer. Wir erwähnen das im Folgenden nicht mehr gesondert, um den Sprachfluss nicht unangemessen zu behindern. Mit seinem in dieser Hinsicht provokativen Ansatz hat Coase die wohlfahrtsökonomische Diskussion außerordentlich belebt.
Dem Coase‘schen Gedanken verwandt ist die Internalisierung externer Effekte über das Haftungsrecht, die im Kapitel B des Zweiten Teils behandelt wird. Gelingt es, dem Verursacher die von ihm bei Dritten angerichteten Schäden anzulasten, so wird er diese bei der Entscheidung über Ausmaß und Qualität seiner Aktivitäten entsprechend berücksichtigen. Die Bedingungen, unter denen der Verursacher schadensersatzpflichtig ist, werden im Einzelnen durch die geltende »Haftungsregel« festgelegt. In diesem Buch wird wegen ihrer hohen umweltpolitischen Relevanz die Regel der Gefährdungshaftung besonders ausführlich behandelt. Zum Vergleich wird jedoch gelegentlich die Verschuldenshaftung herangezogen.
Neben Verhandlungen und haftungsrechtlichen Regelungen wird auch die Pigou- Steuer als Internalisierungsstrategie behandelt (Kapitel C). Nach dieser Idee wird dem Verursacher die Zahlung einer Abgabe pro Emissionseinheit in Höhe der (im sozialen Optimum veranschlagten) externen Grenzkosten auferlegt. Diese »klassische« Strategie ist bis zur heutigen »Ökosteuer«-Diskussion folgenreich. In zahlreichen Ländern werden Umweltsteuern eingesetzt, die letztlich auf den Pigou’schen Grundgedanken zurückzuführen sind und deren Design sich mehr oder weniger an der Pigou-Steuer orientiert.
Eine Internalisierung externer Effekte in reiner Form ist aus verschiedenen (im Text näher dargelegten) Gründen in der Praxis sehr schwierig. In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur ist daher auch der Einsatz von Instrumenten, die einem aus wirtschaftstheoretischer Sicht etwas weniger anspruchsvollen Ziel als dem der Internalisierung dienen, ausführlich behandelt worden. Es geht in diesem Zusammenhang darum, zu prüfen, inwieweit umweltpolitische Instrumente geeignet sind, einen vorgegebenen (nicht notwendig dem ökonomischen Optimalitätskriterium genügenden) Emissionsstandard zu erreichen. Die betreffenden Instrumente werden daher als »standardorientierte« Instrumente bezeichnet.1
Die hier angesprochene Frage wird im Dritten Teil behandelt. Die außerordentlich zahlreichen »pragmatischen« umweltpolitischen Instrumente, die in Wissenschaft und Politik diskutiert werden, werden dabei in drei »Prototypen«, nämlich Auflagen, Abgaben und Zertifikate zusammengefasst. Sie werden insbesondere auf ihre Effizienz, ihre Anreizwirkung bezüglich des umwelttechnischen Fortschritts und in Bezug auf die Genauigkeit, mit der sie das umweltpolitische Ziel erreichen können, untersucht.
Die Darlegungen in den ersten drei Teilen dieses Buches erklären das wohlfahrtsökonomische Fundament der Umweltökonomie, ihre elementaren Bausteine und den Umriss ihrer Architektur. Damit ist das Grundmodell der Umweltökonomie konstituiert.
Natürlich gibt es eine Unzahl von realen Problemen der Umwelt und der Umweltpolitik, die in diesem Modell nicht oder nicht adäquat abgebildet sind. Diesen wird in der Literatur mit entsprechenden (auf das Erklärungsziel der jeweiligen Erörterung ausgerichteten) Weiterungen des Grundmodells Rechnung getragen. Die Frage, welche Repräsentantinnen der kaum zu übersehenden Schar von Varianten in einem umweltökonomischen Lehrbuch Berücksichtigung finden sollen, ist natürlich schwer zu beantworten. Letztlich wird die Auswahl von der Bewertung ihrer politischen Relevanz und wissenschaftlichen Interessanz (hoppla!) durch die Autoren bestimmt. Im Vierten Teil dieses Buches finden Sie einen bunten Strauß von Erweiterungen des umweltökonomischen Grundmodells. Bei der Abfassung dieses Teils haben wir uns von unserer Überzeugung leiten lassen, dass es möglich sei, die Auswahl von Themen, die in einem grundlegenden Lehrbuch behandelt werden, von der aktuellen Forschung leiten zu lassen. Gegenstand und Methoden dieser Forschung lassen sich in vernünftigen Grenzen durchaus jenseits der In-Crowd der aktiven Forscherinnen und Forscher vermitteln, ohne den weniger spezialisierten Lesern die Unverdaulichkeiten des Forschungsdiskurses zumuten zu müssen.2
Mit den in Kapitel A behandelten Zusatznutzen umweltpolitischer Maßnahmen und den in Kapitel B behandelten Schadstoffinteraktionen geben wir Beispiele für den Umstand, dass zahlreiche ökologische Komplikationen im umweltökonomischen Grundmodell ignoriert werden. Zu Ersterem: Das gleichzeitige Auftreten von verschiedenen Effekten von Umweltschutzmaßnahmen ist eher die Regel als die Ausnahme. So ist eine Verringerung der Verbrennung fossiler Energieträger mit dem Ziel des Klimaschutzes verbunden mit der Reduktion anderer Luftschadstoffe, wie beispielsweise Feinstaub. Zu Letzterem: Unter Schadstoffinteraktionen versteht man das Zusammenwirken verschiedener Emissionsarten bei der Verursachung des Umweltschadens. Exemplarisch wird anhand dieser beiden Phänomene gezeigt, wie man ökologische Spezifika in das ökonomische Modell »einbauen« kann und inwieweit sich damit die Modellergebnisse ändern. Bei einer anderen Klasse von Weiterungen besteht die Abweichung vom Grundmodell darin, dass neben externen Effekten andere Gründe für »Marktversagen« in ein und demselben Modell berücksichtigt werden. Dies ist bei der Umweltpolitik unter den Bedingungen unvollständiger Konkurrenz und bei der Analyse von Umweltpolitik bei asymmetrischer Information gegeben, die in den Kapiteln C und D behandelt werden. Die in den vorgenannten Kapiteln behandelten Probleme von Marktmacht und Unsicherheit wurden in den ersten drei Teilen vollständig ausgeklammert. Anders verhält es sich mit der in Kapitel E behandelten Analyse des induzierten umwelttechnischen Fortschritts. Im ökonomischen Grundmodell wird diese unter der Überschrift »Dynamische Anreizwirkung« schon rudimentär behandelt. Demgegenüber erhält jedoch die dynamische Modellierung der im Vierten Teil des Buches platzierten Passage ein so großes Eigengewicht, dass die entsprechende Modellierung wohl das lehrbuchübliche Grundmodell sprengt und als »Weiterung« bezeichnet werden kann. Diese Einschätzung gilt auch für die in Kapitel E verwendete analytische Methode, die vom Leser mehr technische Kenntnisse verlangt, als die stärker anschaulich gehaltene Darstellung in den ersten drei Teilen.
In dem den Vierten Teil abschließenden Kapitel F werden verhaltensökonomische Aspekte von Umweltproblemen und Umweltpolitik analysiert. Manche Leser/innen werden das wohl eher für eine Alternative zum statt für eine Weiterung des umweltökonomischen Grundmodell(s) halten. Schließlich analysieren wir hier Entscheidungsträger, die über eine völlig andere »DNA in ihren Präferenzen« verfügen als der traditionell (und im Grundmodell ausschließlich) verwendete Homo Oeconomicus. Hier sind z. B. Gerechtigkeitsüberlegungen entscheidungsrelevant, die im Grundmodell der Umweltökonomie keine Rolle spielen. Man kann aber sehr wohl die Auffassung vertreten, dass dies eine Weiterung des Grundmodells sei. Schließlich wird in der Verhaltensökonomie nicht unterstellt, die Entscheidungsträger seien an Gerechtigkeit an der Stelle von Eigennutz interessiert. Vielmehr treten die Gerechtigkeitsüberlegungen ergänzend zu den altbekannten Eigennutzüberlegungen im Kalkül der Entscheidungsträger auf.
Natürlich: Inwieweit eine bestimmte Problematik zum Grundmodell, zu den Weiterungen (oder gar Alternativen) gehört, ist letztlich eine Frage der subjektiven Bewertung. Es sei hier jedem zugestanden, eine andere Einteilung als die hier gewählte für angemessener oder komfortabler zu halten.
Ebenso verhält es sich mit der Antwort auf die Frage, wie die Ökonomie internationaler Umweltprobleme eingeordnet werden soll. Zweifellos könnte sie als Weiterung des Grundmodells gesehen und damit im Vierten Teil platziert werden. Andererseits betritt man jedoch eine »andere Welt«, wenn sich die Betrachtung von der Dichotomie zwischen einer (mehr oder weniger gut informierten) regulierenden Institution und der Schar der Regulierten zur Betrachtung der Interaktion von unabhängigen Akteuren verschiebt. Dies geschieht systematisch bei der Analyse internationaler Umweltpolitik. Hier findet schließlich die Konstruktion des Nationalstaates, der Umweltrecht setzt und durchsetzt, keine Verwendung mehr. Vielmehr wird berücksichtigt, dass internationale Umweltpolitik zwischen souveränen Staaten (mehr oder weniger frei) vereinbart werden muss. Der Verschiebung des Erkenntnisobjekts entspricht ein Wechsel der analytischen Methode. An die Stelle der traditionellen mikroökonomischen Regulierungstheorie tritt die Spieltheorie.
Diese Überlegungen haben den Ausschlag dafür gegeben, die internationalen Umweltprobleme nicht als eine von mehreren Weiterungen des Grundmodells in den Vierten Teil zu allozieren, sondern ihnen den Fünften Teil exklusiv zu widmen. Hinzu kommt die überragende Bedeutung internationaler Umweltprobleme für die aktuelle umwelt- und gesellschaftspolitische Diskussion sowie der (damit korrespondierende) recht große Raum, der der einschlägigen Erörterung in diesem Buch eingeräumt wird. Wegen der hohen Aktualität der Diskussion um die globalen Umweltprobleme haben wir in diesem Teil auch besonders darauf geachtet, dass die wirtschaftstheoretischen Überlegungen nicht für sich stehen, sondern zur Bewertung praktischer internationaler Umweltpolitik herangezogen werden. Dies geschieht insbesondere am Beispiel einer umweltökonomischen Analyse des Klimaschutzabkommens von Paris sowie des EU-Emissionshandelssystems.
Noch leichter als bei den internationalen Umweltproblemen fällt die Entscheidung, natürliche Ressourcen und nachhaltige Entwicklung eigenständig (und damit im Sechsten Teil) zu behandeln, statt sie als Weiterungen des Grundmodells im Vierten Teil zu platzieren. Schließlich ist die hier eingenommene Perspektive sehr deutlich von der vorher in diesem Buch eingenommenen Perspektive zu unterscheiden.
Trotz vielerlei Abweichungen und Differenzierungen besteht die Grundvorstellung in den ersten fünf Teilen des Buches doch darin, dass mit der wirtschaftlichen Aktivität ein unerwünschtes Kuppelprodukt (externer Effekt, Emission) produziert wird, dessen Ausmaß durch ordnungs- oder prozesspolitisches Einwirken des Staates (oder einer Koalition von Staaten) günstig beeinflusst werden soll. Das Leitbild dieser Beeinflussung ist die Internalisierung externer Effekte, – sei es in ihrer reinen Form oder in der »Magerstufe« der standardorientierten Umweltpolitik. Im Sechsten Teil des Buches ergänzen wir dann diese outputbezogene Betrachtung durch eine inputbezogene. Der Umstand, dass jede wirtschaftliche Aktivität Ressourcen aus der Natur entnehmen muss, rückt in den Fokus der Betrachtung. Das Problem besteht in der Erschöpfung des Ressourcenbestandes bzw. in der Beschädigung (wenn nicht sogar der Zerstörung) der ressourcialen Basis der menschlichen Existenz. Die daraus entstehende Frage ist die nach den Bedingungen der Dauerhaftigkeit menschlicher Existenz. Das zugehörige politische Leitbild ist das der nachhaltigen Entwicklung.
Soweit der Überblick über das Programm dieses Buches. Bitte gestatten Sie uns zum Abschluss dieses Anfangs noch einige Bemerkungen zu den Spezifika der vorliegenden Auflage im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen. Die ersten vier Auflagen dieses Buches wurden von Alfred Endres in Alleinautorenschaft verfasst und damit auch verantwortet. Nun hat die Lektüre zahlreicher verhaltensökonomischer Artikel den bisherigen Alleinautor davon überzeugt, dass es gut ist, mal einen Schuss Altruismus in seine Entscheidung bezüglich der Autorenschaft der nächsten Auflage einfließen zu lassen. So teilt er denn nun das Vergnügen mit seinem verehrten Kollegen, Herrn Prof. Dr. Dirk Rübbelke von der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Die in dieser Kooperation entstandende Neuauflage unterscheidet sich von der vorangegangenen Auflage insbesondere in folgender Hinsicht:
• Die Literaturhinweise in allen Teilen des Buches sind umfassend aktualisiert worden. Dies ist besonders wichtig für diejenigen Leserinnen und Leser, die das Buch zur Anfertigung von Seminar- und Abschlussarbeiten oder Dissertationen nutzen.
• Das oben bereits angesprochene Kapitel A des Vierten Teils über Umweltschutz als unreines öffentliches Gut wurde neu in das Buch aufgenommen. Dabei wird die Theorie der Kuppelproduktion umweltökonomisch nutzbar gemacht, indem sie zur Analyse von »Zusatznutzen« umweltpolitischer Maßnahmen eingesetzt wird.
• Ebenfalls neu in das Buch aufgenommen wurde das Kapitel F des Vierten Teils, in dem verhaltensökonomische Aspekte des Umweltschutzes berücksichtigt werden.
• Die Analyse der Umweltpolitik bei unvollständiger Konkurrenz war in der Vorauflage auf den Monopolfall beschränkt. Nun findet sich (in Kapitel C des Vierten Teils) auch eine Analyse der Emissionsbesteuerung im Oligopolfall.
• Der Entwicklung der internationalen Umweltpolitik der letzten Jahre folgend wurde die Behandlung des Kyoto-Abkommens stark gekürzt. Spiegelbildlich wird das Klimaschutzabkommen von Paris in der vorliegenden Auflage (in Kapitel B des Fünften Teils) sehr ausführlich behandelt.
• Der europäische Emissionshandel war in den letzten Jahren starken Veränderungen unterworfen und hat erheblich an Bedeutung gewonnen. Dem trägt die Neuauflage des vorliegenden Buches (in Kapitel C des Fünften Teils) Rechnung.
• Natürlich: Das sind allerlei Erweiterungen, die naturgemäß Platz beanspruchen. Damit der Text nicht ausufert, haben wir den für die Erweiterungen notwendigen Platz an anderer Stelle eingespart (leider einsparen müssen). Insbesondere haben wir aus der Vorauflage das Kapitel »Die ›doppelte Dividende‹ der Ökosteuer« gestrichen.
• Bei der Arbeit an der Neuauflage haben die Autoren vielfältige Unterstützung erfahren. Wir möchten uns sehr herzlich bei Frau Annette vom Heede, FernUniversität in Hagen, und Frau Anja Brumme, Frau Dr. Theresa Stahlke und Herrn Dr. Philip Mayer, Technische Universität Bergakademie Freiberg, bedanken, die den Text in mehreren Versionen redaktionell betreut haben.
• Schließlich soll (darf!) hier nicht unerwähnt bleiben, dass sich Herr Professor Dr. Michael Finus (heute: Universität Graz), Frau Professorin Dr. Karin Holm-Müller (heute: Universität Bonn), Frau apl. Professorin Dr. Bianca Rundshagen (FernUniversität in Hagen) und Herr Professor Dr. Reimund Schwarze (heute: Viadrina Universität Frankfurt/Oder) mit zahlreichen nützlichen Hinweisen um frühere Auflagen dieses Buches verdient gemacht haben. Schließlich haben die Ausführungen zur Ökonomie des Umwelthaftungsrechts und des induzierten umwelttechnischen Fortschritts erheblich von der jahrelangen Forschungskooperation zwischen Alfred Endres und Herrn Professor Dr. Tim Friehe (heute: Universität Marburg) profitiert. Die Samariterdienste der genannten Personen wirken wohltuend in den jetzt vorliegenden Text hinein.
Zu guter Letzt noch eine frohe Botschaft für Dozentinnen und Dozenten der Umweltökonomie: Um die Aerodynamik des vorliegenden Textes beim Einsatz in Ihren Lehrveranstaltungen zu verbessern, können Sie die PowerPoint-Folien aller Abbildungen unter https://dl.kohlhammer.de/978-3-17-039458-2 herunterladen.
Alfred Endres und Dirk Rübbelke
Hagen und Freiberg im November 2021
1 Entsprechend könnten die Internalisierungsstrategien als »schadensorientierte« Instrumente bezeichnet werden.
2 Trends in der umweltökonomischen Forschung lassen sich fortlaufend aus den Programmen der Jahrestagungen der einschlägigen wissenschaftlichen Vereinigungen ablesen, z. B. der Association of Environmental and Resource Economists (AERE) oder der European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE). Mit einem gewissen Lag gilt das auch für die führenden umweltökonomischen Zeitschriften wie Ecological Economics, Environmental and Resource Economics, Energy Economics, Environmental Economics and Policy Studies, International Review of Environmental and Resource Economics, Journal of Environmental Economics and Management, Resource and Energy Economics, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists. Eine thematische Auswertung dieser Zeitschriften präsentieren Kvamsdal et al. (2021). Stärker zukunftsgerichtet (also zu den Herausforderungen, denen sich die Umweltökonomie wird stellen müssen) vgl. Bretschger/Pittel (2020).