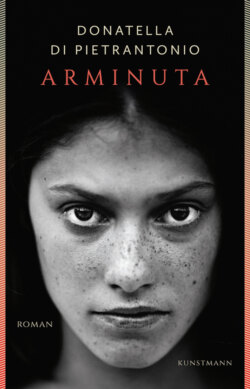Читать книгу Arminuta - Donatella Di Pietrantonio - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
Оглавление»Hat’s dir in der Stadt nicht gepasst?«, fragte mich Vincenzo unvermittelt.
Wir waren im Abstellraum im Souterrain des Wohnhauses. An den Wänden entlang ein unförmiger Haufen kaputter Körbe, von der Feuchtigkeit wellige Kartons, eine löchrige Matratze, aus der Wollflocken herausquollen. In einer Ecke eine Puppe ohne Kopf. In dem wenigen freien Raum in der Mitte schälten wir Kinder die Tomaten zum Einmachen und schnitten sie in Stücke, ich aber war die langsamste.
»Das hat die Signorina wohl noch nie gemacht«, hatte mich schon einer der Brüder mit Fistelstimme verhöhnt.
Der Kleine tauchte einen Arm in den Eimer mit den Abfällen und steckte ein Stückchen in den Mund. Die Mutter war gerade nicht da, sie war etwas holen gegangen.
»Also? Wieso bist du hierhergezogen?«, hakte Vincenzo nach und wies mit rot verschmierter Hand in die Runde.
»Das hab ja nicht ich entschieden. Meine Mutter hat gesagt, ich wäre jetzt groß und meine echten Eltern wollten mich wiederhaben.«
Die Augen auf mich gerichtet, hörte Adriana aufmerksam zu, sie brauchte nicht auf ihre Finger und das Messer zu schauen, mit dem sie arbeitete.
»So ’n Quatsch! Schlag’s dir aus dem Kopf, von dir hat hier keiner geträumt!«, sagte Sergio, der gemeinste. »He, Ma«, brüllte er dann nach draußen, »stimmt es wirklich, dass du sie zurückgewollt hast, diese blöde Gans?«
Vincenzo schubste ihn mit dem Arm, und Sergio fiel hämisch lachend von der umgedrehten Holzkiste, auf der er saß. Mit dem Fuß stieß er gegen einen halb vollen Behälter, und ein paar schon geschälte Tomaten landeten auf dem Zementboden im Staub. Ohne zu überlegen, wollte ich sie wegwerfen, doch mit einer raschen, erwachsenen Bewegung nahm Adriana sie mir noch rechtzeitig weg. Sie spülte sie ab und drückte sie aus, bevor sie sie in den großen Topf zurücktat. Schweigend drehte sie sich um und fixierte mich, hatte ich verstanden? Man durfte nichts vergeuden. Ich nickte.
Die Mutter brachte die sauberen Flaschen, in die die Tomaten abgefüllt wurden. In jeder lag schon ein Basilikumblatt.
»O Gott, hast du etwa heut deine Tage?«, fragte sie mich schroff.
Vor Scham antwortete ich zu leise.
»Was? Ja oder nein?«
Mit einer Geste des Fingers wiederholte ich mein Nein. »Ein Glück, sonst wär hier alles verschimmelt. Wenn du deine Blutung kriegst, kannst du bestimmte Arbeiten nicht machen.«
Auf dem Feuer, das in einem Winkel zwischen dem Wohnhaus und der erdigen Böschung brannte, wurden die Flaschen mit Sugo dann in einem riesigen Kessel im Wasserbad sterilisiert und waren gerade fertig. Da erschien Vincenzo, sich immer wieder umblickend, mit einem halben Sack voll Maiskolben und überhörte geflissentlich die Frage, wo er die herhätte. Wir entfernten die Blätter und den Bart, die Körner innen waren zart und verspritzten Milch, wenn man sie mit dem Fingernagel ritzte. Ich beobachtete die anderen und machte es wie sie. Der Rand eines Blatts schnitt mir in meine noch zu weiche Haut.
Anschließend röstete Vincenzo sie über der verbleibenden Glut und wendete sie ab und zu mit bloßen Händen, mit einem raschen Schubs seiner schwieligen Fingerspitzen.
»Wenn sie ein bisschen angekohlt sind, schmecken sie besser«, erklärte er mir mit einem schiefen Lächeln.
Den ersten hielt er Sergio, der sich schon freute, kurz vor die Nase und reichte ihn dann mir. Ich verbrannte mich daran.
»Recht geschieht’s ihr«, knurrte Sergio, während er wartete, bis er an die Reihe kam.
»Maiskolben habe ich fast noch nie gegessen, und nur gekocht. So sind sie viel leckerer«, sagte ich.
Niemand hörte es. Stumm half ich Adriana, alle Gefäße zu spülen, die wir für die Soße gebraucht hatten, und sie wieder im Abstellraum zu verstauen.
»Kümmer dich nicht um Sergio, der ist zu allen gemein.«
»Womöglich hat er recht, vielleicht haben deine Eltern mich gar nicht zurückgewollt. Inzwischen bin ich mir sicher, dass ich hier bin, weil meine Mutter krank ist. Aber ich wette, wenn sie wieder gesund ist, kommt sie mich holen.«