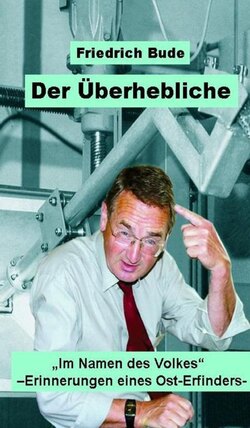Читать книгу DER ÜBERHEBLICHE - Dr. Friedrich Bude - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.Rückblende
27.05.1940 Kriegstagebuch Ernstine Bude:
Heute wurde Fritz Bude ’s Abend 9 Uhr unter Blitz u. Donner ein kleiner Junge geboren. Fried rich heißt er u. ist das 3.Kind. Er kam ein bißchen voreilig u. infolgedessen entstanden in den 1 ½ Std. da er endgültig unterwegs war allerhand Situationen,über die man nachträglich herzlich lacht. Johanna ist sehr mobil. Der Kleine ist niedlich u. artig.
Heute kam der Heeresbericht, daß die Auflösung des noch vorhandenen franz. u. engl. Heeres nur noch eine Frage der Zeit sei. Heinz liegt jetzt in Wien auf dem größten Truppenübungsplatz Großdeutschlands. Auch Fritz hat sich melden müssen u. ich mache mir um die nächste Zukunft Sorgen. In der Werkstatt ist viel zu tun.
Damals war die kindliche Welt in der Kleinstadt noch in Ordnung. Sieg und Niederlage weit weg.
Das grausame Geschehen des 1. und 2. Weltkrieges mit den vielen Toten der näheren Verwandtschaft, den Selbstmorden während der Inflationszeit, die Überlebenskämpfe der Handwerkerfamilie hat Frieders Großmutter in ihrem sogenannten „Kriegstagebuch“ festgehalten. Dort findet sich auch der erste schriftlich fixierte „Kommentar zur politischen Lage“ des damals Dreijährigen.
Kriegstagebuch Ernestine Bude:
1.6.1943
Kam Heinz aus Russland auf Urlaub, am 22.6. ging er wieder an die Front. … Wann wird endlich das furchtbare Morden enden?
Damals sagte unser kleiner Frieder zu ihm:
„ Onkel Heinz, geh nur nicht wieder bei die alten Russen, geh lieber bei die Feuerwehr.“
Wir haben die Ansicht des Kleinen geteilt, u. sein Ausspruch wird bei uns wohl zum geflügelten Wort werden.
„Fritz!“ - wie ein Pistolenschuss, kurz und hell, schallte es über den Hof, wenn Mutter unseren Vater rief. Alle nannten ihn so. Laut Geburt und Taufe durfte er dagegen den etwas hochtrabenden „Friedrich“ beanspruchen. Mutter war diese Verkürzung ein Dorn im Auge. Sie bestand erneut auf diesem königlich-preußischen Taufnamen. Aber auch das Sonntagskind Friedrich II. von Budes Gnaden verlor durch die kindgemäße namentliche Verniedlichung über Friederlein zu Frieder seinen adligen Glanz.
In früher Kindheit entdeckte der kleine Frieder in Muttis Nachttisch einen dicken hölzernen Stab mit aufgezogenen Vierecken, Sternen, Rollen und Kugeln. Die konnte man drehen, hin- und herschieben, an der Wand oder am hohen Kopfteil der glänzenden Mahagonibetten abrollen. Was aber langweilig war - bis auf die kleinen winzigen Kratzer, die auf der Holzpolitur entstanden. Sie waren kaum zu sehen: Kreise, und Schlaufen, Haken und krumme Linien, immer waren sie anders.
Einmal sah der Vierjährige, wie Mutti sich mit dem rollenden Stab den Rücken rieb, wagte aber nicht zu fragen, ob dort auch Kratzer gemacht werden sollten?
Mehr Spaß machten schon die kleinen dehnbaren durchsichtigen Röllchen aus Vatis Nachttisch. Wozu braucht der die denn? - Heißa! Die konnte man aufrollen, den Finger hinein stecken und lang ziehen. Wurde damals schon Frieders Entdecker- und Erfinderveranlagung geweckt?
Mit großer Mühe zerrt er, als Mutter nicht im Haus, einen Stuhl bis zum eisernen becherförmigen Ausguss der Küche, klettert auf den Sitz, um kniend das auf zwei Finger aufgezogene Gummibeutelchen über den Wasserhahn zu stülpen.
Wasser marsch! - Der Beutel wird immer größer.
„Wau!“ - fast so groß wie das Becken war jetzt der schwere Sack. Seine Hände können das wabbelnde Gebilde nicht mehr halten:
Patsch, kaputt, Stuhl nass, der Küchenboden voller Pfützen.
Also, dafür waren die kleinen Gummiringe nicht gedacht.
Aber Aufblasen konnte man sie ohne Mühe! Vorn bildete sich ein klitzekleines Köpfchen, dann blähte sich eine dicke wellige Wurst auf, noch mehr blasen, wurde die Wurst ein richtiger langer Luftballon, nur das Köpfchen wurde nicht viel größer. Man konnte damit herumrennen. Bis die Nachbarin, Frau Hoffmann, dem Kind im Hofgang eindringlich dies verbot, die restlichen Gummis seiner Hosentasche einkassiert hat.
„Wozu braucht denn Vati die Gummiröhrchen im Schlafzimmer!“
Am 16. April 1945 eroberten die amerikanischen Soldaten von General Patton Ostthüringen und befreiten damit ganz Thüringen von der nationalsozialistischen Herrschaft. Nur 100 Tage dauerte die amerikanische Besatzung.
„Die Amis kommen!“ In wenigen Minuten flüchteten alle Hausbewohner in den Keller, ausgebaut als „Luftschutzbunker“. Dass heißt, es wurden Fensteröffnungen zu ebener Erde eingebaut, welche nur so hoch waren, dass jeder mühsam heraus kriechen konnte. Die Luftschutzübung war damals spannend, Leiter anlegen – hochsteigen – raus kriechen. Und die Erwachsenen hatten schon da erhebliche Schwierigkeiten.
Großes Gedränge am Fenster, als die ohrenbetäubenden Geräusche den Marktplatz erschütterten. Plötzlich und nur Sekunden ratterten und quietschten direkt vor dem Fenster bullige Räder mit Ketten vorbei. Mehr war nicht zu sehen, nur drei Meter entfernt lärmen die amerikanischen Panzer.
Als der Spuk vorbei war, zeigte der Vater seines Freundes Peter, Zahnarzt im 1 .Stock, den Kindern zwei Patronen. Nach Kriegsverletzung wieder als Mediziner tätig, hatte der den Einmarsch am Markt durch die drei Erkerfenster voll überblicken können, ist von den Scharfschützen auf dem Panzerturm auch erkannt worden. Die Einschusslöcher in der Glasscheibe waren einzige langfristige Zeugen militärischen Geschehens am Markt der Stadt.
Sie haben ihr Lager aufgeschlagen unterhalb des Felsens mit der katholischen Kirche. Frieders zehn Jahre älterer Bruder Albrecht wurde nach erfolgreichen Diebstählen von Kaffee, Schokolade, vor allem Zigaretten, dort dann doch noch erwischt, musste im hilfsweise errichteten Gefängnis in der Rathaustoreinfahrt, vier Häuser nebenan, einsitzen. Mutti und Frieder haben dann „belegte Bemmen“ vorbei gebracht.
Überraschender kam für die Thüringer Bevölkerung Anfang Juli 1945 der Besatzungswechsel. Die Frage der Rückverlegung der amerikanischen Truppen aus künftigem sowjetischen Besatzungsgebiet in die ihnen zugewiesene Zone war Mitte Juni in ein entscheidendes Stadium getreten und nach einem Briefwechsel zwischen Stalin und Truman für die Zeit ab 1. Juli 1945 befohlen worden.
Der Einmarsch der Roten Armee begann am 2. Juli 1945 in Ostthüringen durch die 8. Gardearmee unter Generaloberst Tschuikow, die in Stalingrad gekämpft, Berlin mit erobert und dann in Sachsen stationiert war.
05.09.45 Kriegstagebuch Ernstine Bude:
Seit 1. Sept. gibt es neue Lebensmittelkarten. Die Empfänger in 6 Gruppen: Schwerstarbeiter, Schwerarbeiter, Arbeiter (zu denen unser Betrieb gehört), Kinder von 3 - 5 Jahr. bis Schüler und Angestellte, Sonstige, Hausfrauen u. alte Leute. In der Gruppe Sonstige gibt es weder Fleisch noch Fett oder Butter. Die Tagesration ist folgende: 200 gr. Brot, 10 gr. Nährmittel, 30 gr. Marmelade, 15 gr. Zucker, 0 gr. Fleisch u. Fett. Die nach uns kommen und sich geregelt ernähren können, mögen sich das vorstellen und nach Bedarf genau überdenken. Sie werden auch begreifen, daß wir ohne Mühe eine schlanke Generation geworden sind. Raucher bezahlen im Schleichhandel für eine Zigarette 5 - 8 RM (Reichsmark). Wir fertigen in unserer Werkstatt eine mittelmäßige Küche für 450 bis 580 RM, dafür bekommt man gerade ein Pfund Kaffee (300 - 800 RM).
Morgens schon schwül-warm. Mutti hantiert in der Küche.
„Ich 5-jähriges Sonntagskind hocke am Fenster, denke darüber nach, warum der Storch, als Belohnung für auf dem Fensterbrett ausgestreuten Zucker, Babys bringt. Wie er das macht, das Tuch mit dem Baby im Schnabel! Er kann sich doch gar nicht auf das schmale Fensterbrett setzen! Wir wohnen ganz oben im 3. Stock von Oma Knorrs Haus. Da kommt der Storch leicht ran. Wie soll das aber bei den unteren Stockwerken funktionieren, bei dem schmalen Hofgang zum Nachbarhaus?“
Markt 7, das größte Haus am Platz. Die städtische Feuerwehrleiter wurde danach gebaut.
Die drei Türme bilden den Blickfang der oberen Marktseite.
Es hat auf der oberen Marktseite den dritten großen Turm. Einige Häuser weiter steht das Rathaus mit dem zweiten Turm. Gleich hinter der Rathausecke überragt der Kirchturm beide.
Auf unserem Dachboden im Turmgewölbe ist es dunkel. Dort eine runde Luke, seine große Schwester Renate hat ihn einmal hochgehoben, man kann über die ganze Stadt sehen. Früher wurde bei Festlichkeiten, wie der 600-Jahrfeier, dort immer eine große, sehr lange Hakenkreuz-Fahne rausgehängt. Jedenfalls ist das auf den vielen schönen Fotos zu sehen, die Opa gemacht hat.
Schmölln, Markt 1958
Opa ist tot, betitelt als Ratsuhrmachermeister war er für den richtigen Gang aller Stadtuhren verantwortlich. Albrecht, Frieders großer Bruder, durfte Opa helfen, täglich in den Kirchturm steigen, die Turmuhr aufziehen. Muss spannend gewesen sein. Jetzt ist Opas großes Geschäft geschlossen. Die lange Fahne liegt noch auf dem Boden, wird aber nicht mehr rausgehängt, weil das abgetrennte Hakenkreuz dort einen hellroten Fleck hinterlassen hat, ihre wahre Vergangenheit verrät.
Vom Küchenfenster kann man weit runter in den schmalen Gang bis zum Hof sehen. Frieder traut sich nur selten, bekommt Angst vor der Tiefe unter ihm. Aber geradeaus hat man einen schönen Blick auf die Dächer der oberen Marktseite - und die anderen beiden Türme. Noch schöner ist es, im Turm-Erker des Wohnzimmers zu sitzen. Aus drei Fenstern sind alle Seiten des großen Marktes zu überblicken. - Ihnen entgeht somit nichts!
Früher hatte er neben Mutti am offenen Erker gehockt: an den Fenstern der meisten Häuser rundum standen Leute, Musik hat gespielt. Alle streckten wie Mutti die Hand raus - das war der Hitler-Gruß!
Als Frieder so nachdenkend über Klapperstorch und Kinderkriegen am Küchenfenster hockt, klingelt es zweimal - ganz heftig. Mutti kommt, guckt mit ihm aus dem Fenster den steilen Hofgang runter. Unten stehen zwei Polizisten und rufen:
„Ihr Haus wird von der russischen Kommandantur bezogen. In zwei Stunden muss das Haus geräumt werden. Außer Koffern darf nichts mitgenommen werden!“
Vieles ist dem kleinen Frieder danach verschwiegen worden. Aber er weiß noch, mit welcher Eile Vater aus der Werkstatt geholt wurde. Die Tischlerei stand drei Straßen weiter am Bahnhofsplatz neben dem Haus der Budens-Oma. Dort wohnten auch Tante Anneliese und sein riesengroßer Cousin Henner. Onkel Heinz, in russischer Gefangenschaft, war Tapezierer, betrieb die Polsterwerkstatt, welche im Nebengebäude untergebracht war.
Die nächsten Stunden stand er nur im Wege! Bruder Albrecht und mehrere Gesellen schleppten heimlich Möbel aus dem dritten Stock nach unten.
Frau Hoffmann hatte im Hof gerade Wäsche aufgehängt. Sie musste die großen Betttücher so umhängen, dass den Polizisten, welche an der Hausecke am Markt standen, der Blick durch den schmalen Gang bis in den Hof verdeckt wurde.
Vom Ende des langen Hinterhofes gelangte man in den Garten. An Apfelbäumen vorbei ging es über schmale Treppen zwischen Büschen im Zickzack den steilen Berg hoch. Dort stand links im benachbarten Fleischereigrundstück ein Holzgerüst. Dieser mehrere Meter hohe Bretterverschlag, im Viereck um eine Wasserspritze angeordnet, diente winters als Eismaschine. Wenn diese bei Minusgraden sich drehte und Wasser versprühte, bildeten sich rundum an den Holzwänden dicke Eisschichten, welche abgeklopft, im Eiskeller des Berges unterhalb des Gerüstes Fleisch und Wurst frisch hielten.
Einmal war der Antrieb defekt, die Spritze drehte sich nicht. Der Wasserstrahl zielte die ganze Nacht über die Mauer auf unser Gebüsch. Am nächsten Morgen glitzerte dort ein fester Eisberg in der Sonne, rau, hüglig, mit Schluchten und Spitzen bis zur Laube des oberen Gartenteiles. Man konnte drauf rumklettern. In Frieders Fotoalbum gibt es ein imposantes Bild mit dem Untertitel: „Ich auf dem Eisberg.“
Vom oberen Garten führte durch ein festes hohes Tor die Treppe wieder runter bis zur Schulstraße. Gegenüber unser Felsen, steil zum Klettern und Spielen, dahinter die Lohsen, unser Stadtwald.
Vor der Russenbesetzung schleppten Albrecht und Tischlergesellen die Möbel im Schutz der Hoffmannschen Bettwäsche durch den Garten bis zur Schulstraße. Dort stand schon ein Platten-Handwagen. Ab ging es durch die Stadt zur Budens-Oma am Bahnhof. Das dortige Möbellager, während des Krieges sowieso leer, wurde jetzt wieder voll gestellt. Auch vom Studienrat Brodeck kamen später noch Möbel rein; große, mit Schnitzereien versehene Schränke, welche dem Raumbedarf von Besatzung und Flüchtlingen weichen mussten.
Nach dem Rausschmiss wohnten sie in Oma Budes Schlafzimmer am Bahnhof. Frieder hat das nicht gestört. Jetzt konnte er oft in der benachbarten Tischlerei zusehen. Das war interessant. Vor allem, wenn gehobelt wurde, die Späne mit einem großen Ventilator durch dicke Rohre über das Dach in einen Holzverschlag gesaugt wurden. War dort die obere Tür offen, konnte man hinein springen und rumtollen.
Eigentlich durfte er nicht im oberen Stock der Tischlerei bleiben. Dort arbeiteten die Gesellen an Hobelbänken, wo er unerwünscht war. Aber von Omas Wohnung gelangte man auch durch Tapeziererwerkstatt und Tischlerei in den Hof, weshalb er diesen Weg meist neugierig nutzte.
Wenn der Zug am Haus vorbei ratterte und fauchte, konnte man aus Omas Fenster alles beobachten. Die Betriebsamkeit der „Bahner“ ganz oben im Stellwerk verfolgen, wie sie mit der Kurbel die dann klingelnde Bahnschranke öffneten und schlossen, die Hebel für die Weichen stellten. Alles konnte man verfolgen.
Außer Hoffmanns, welche in einer Mansarde unter der Bodentreppe wohnten, die Hausmeisterarbeiten für die Russen machen sollten, mussten alle raus aus dem schönen großen Haus mit Turm. Zahnarzt Pauling mit Peter, meinem Freund, zog in die Kellerwohnung einer Villa auf der anderen Seite der Bahn.
Am Tag nach dem Einzug der Russen schlich er mit Peter durch den schmalen Hofgang bis zum Zaungitter. Den ganzen Hofkonnten sie, vorsichtig um die Ecke guckend, überblicken. Welch ein Schock:
Im Sonnenschein auf dem Gullydeckel im Hof stand die schöne Glasvitrine aus Omas Korridor mit dem zierlichen Porzellan! Zwischen deren Glasplatten spielten die Russenkinder mit Puppen, stellten diese zu den zierlichen Figuren! So was hätte Frieder nie machen dürfen! Natürlich lag dann auch schon eine kleine Porzellantänzerin kaputt auf dem Hofpflaster.
Als er entsetzt in der neuen Notunterkunft seiner Knorrs Oma diese Untaten berichte, schlägt diese entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Vati kam zufällig mit der schmutzigen Tischlerschürze vorm Bauch ins Zimmer. Und noch Mal musste er berichten: „Das has’de nu davon, wie kann mo nur so däämlich sein, das Zeug nicht mitzunähm’. Wenn’ch mo überleg, was mo alles durch den Garten rausgeschleppt ham! - Und du lässt dei Porzellan drin!“ Furchtbar hat er sich aufgeregt.
Auf den Tag genau ein Jahr wohnten sie bei der Budens-Oma am Bahnhof.
Als die Russen auszogen, war es wieder spannend.
Vorm Haus stand ein großer Laster. Die Russen schleppten mit eifrigen deutschen Helfern die Möbel raus. Diesmal hat Oma aufgepasst, „wie ein Heftelmacher“: Sie stand aufgeregt im Tor des uns gegenüberliegenden Einganges der Fleischerei. Ihre Wohnzimmerstühle wurden verladen. Kaum waren die Möbelträger wieder im Haus, schwuppdiwupp, war Oma am Wagen, zerrte Stühle vom Wagen, rein in den Hausflur der benachbarten Fleischerei.
Die schweren Möbel nahmen die Besatzer nicht mit. So war ihnen vieles geblieben. Vati zeigte auf die Kerben seines Kirschbaumschrankes:
„Da haben sie die Flaschenköpfe abgeschlagen!“
Jetzt zog die Familie in eine größere Wohnung im Haus mit dem dritten Turm der Stadt - ein Stockwerk tiefer, langer Korridor mit elf Türen!
Das Schönste war, dass sein großer Bruder am Korridorbalken Haken für die Schaukel einschraubte. Er hat ihm das Schaukeln gelehrt, konnte bei den Schwüngen mit den Füßen sogar die Decke berühren. Aufpassen musste man. Auf der einen Seite stand Vatis Meisterstück: ein großer Kleiderschrank, welcher heute noch auf der Datsche in Ehren gehalten wird. Passgenau schließen nach Jahrzehnten Fächer und Türen, so dass eingeklemmte Kleidungsstücke ständigen Ärger verursachen.
Auf der anderen Seite Opas zwei große Standuhren: sein Glanzstück, eine „ganz alte wertvolle“, wie ihm sein großer Bruder erklärte, „die Zahnräder wären von Hand gefeilt“, was das Kindergartenkind natürlich nicht verstand - und Omas Standuhr, welche heute noch den Westminstergong in des Autors Wohnzimmer schlägt.
Wegen der Flüchtlingswelle musste Oma ihre Parterrewohnung aufgeben und bei der Familie mit einziehen.
Kein Mensch hat sich in diesen Umbruchszeiten für die Uhren interessiert, wahrscheinlich landete das Glanzstück später aus Platzgründen in Vaters Möbellager am Bahnhof.
Erst sechs Jahrzehnte später wird Großvaters Attraktion wieder zum Leben erweckt, kommt ihre Besonderheit beim Sichten alter Unterlagen mit der „Deutsche Uhrmacher-Zeitung, Juli 1941“ erneut ans Licht. Sie gibt einen interessanten Einblick in die Familiengeschichte der letzten zwei Jahrhunderte:
Frieders Ur-Ur-Großvater, 1822 geboren, hatte den Bau der bewussten Uhr schon 1848 begonnen. Unfertig wurde diese gegen 1880 von dessen Schwiegersohn, Frieders Urgroßvater, Franz Knorr, fertig gestellt, ging aber nur fehlerhaft, blieb erneut unvollendet.
Dieser Franz Knorr gründete eine wahre Uhrmacherdynastie. Alle vier Söhne errichteten in Ostthüringen, in Kraftsdorf, Weida, Roda und Schmölln Uhren-, Optik- und Goldwarengeschäfte.
Der Zweite, Frieders Großvater Richard Knorr, geboren 1874, eröffnete sein Geschäft 1906 in Schmölln, welches er von Oskert Lückert übernahm, der nach Las Palmas auswanderte. Bereits 1912 konnte er den Altbau aufstocken und mit dem Turm am Markt 7 vollenden.
Er erbte die unvollendete Uhr somit in dritter Generation und hat diese um 1920 zum Laufen gebracht. Das Besondere daran ist, dass das Uhrwerk nur aus drei Rädern und einem sogenannten „ Stiftscherengang“ besteht, so dass die drei Räder ohne Zwischenantrieb die Zifferblätter für Sekunden, Minuten und Stunden antreiben - eine wahre Rarität.
Diese Standuhr schmückte noch 1933 als Ausstellungsstück die Druckerei Böckel vom „Tagesblatt“ auf der anderen Seite der Bahnschienen, gegenüber dem Stellwerk, welches für Frieder als Kind so interessant war. Dort, wo auch seine Großmutter Ernestine früher als Redakteurin schriftstellerte.
Wieder musste mehr als ein halbes Jahrhundert vergehen, bis ein Urenkel von Frieders Großmutter, väterlicherseits, also kein Nachkomme der Knorr-Familie, diese Standuhr im Möbellager Bude entdeckte, aufmotzte und zum Leben erweckte.
Nach gütlicher Familieneinigung der väterlichen und mütterlichen Nachkommen wurde die Uhr der Blutsverwandtschaft zurückgegeben, tickt heute im Wohnzimmer von Frieders Neffen, einem Knorr´schen Urenkel in Jena. Dessen Ur-Ur-Ur-Großvater hatte das Werk 1848 begonnen, durfte es damals als vorgesehenes Meisterstück nicht weiter bearbeiten, weil die Arbeit vor dem offiziellen Prüfungsbeginn schon begonnen wurde.
Winter 47/48, Kriegstagebuch Ernstine Bude:
Wir haben, wie fast alle Mitmenschen keine Kartoffeln mehr, noch keine Butter, keine Nährmittel, keine Waschmittel, keine Schuhe.
Die Leute vertauschen gegen Nahrungsmittel die notwendigsten Wäsche- u. Kleidungsstücke. Wir kauften in diesen Tagen 1 Ltr. Speiseölfür 400 RM, 1 Pfund Schwarztee kostet 1000 RM, 1 Pfund Weizen oder Roggenmehl 25 RM. Ein normaler Wochenlohn beträgt 40 - 50 RM. Die Zustände sind katastrophal. Die Arbeitsleistungen sinken, weil die Menschen keine Kraft mehr haben. Fast 3 Monate konnten wir infolge der großen Kälte nicht arbeiten.. Oster-Sonnabend, ich bekam von ganz fremden Leuten aus Brooklyn (New Yorker Stadtbezirk), die durch Zufall meine Adresse erhalten hatten, ein 8 kg Paket mit allerhand guten Sachen, die wir gar nicht mehr kennen.
Zwei Jahre nach dem Schaukelbau neben der geschichtsträchtigen Uhr: Ohne Abschied blieb der Bruder weg! Gedrückte Stimmung, Mutti tröstet den kleinen Frieder:
„Albrecht ist auf Handwerksburschen-Wanderschaft!“
Als Geselle in Vatis Werkstatt angestellt, musste der auf den Lohn am längsten warten, bekam am wenigsten. Überhaupt war die Familie nicht durch die Tischlerei bevorzugt, eher benachteiligt. Mutter sagte immer: „Bevor Vati bei uns was macht, muss mindestens ein Donnerwetter von mir passieren und dann dauert es noch ein Jahr, bis alles fertig ist.“
Albrecht war nach dem Westen abgehauen, wollte richtig Geld verdienen. Nur Mutti war eingeweiht.
Wenige Wochen nach des Bruders Abwesenheit - die Schwester tat ganz geheimnisvoll: „Frieder, Du hast ein Päckchen mit der Post bekommen!“
Das erste Päckchen, ganz allein für den achtjährigen Knirps?
Klein, mit Packpapier fest verklebt. Auf dem Deckel konnte er seinen Namen buchstabieren. Etwas kleines Buckliges, braun und klebrig, mit durchsichtigem Glitzerpapier umwickelt, war eingepackt, sah aus, wie getrocknete Pflaumen, mit kleinen Körnern, schmeckte sehr süß - Feigen.
Es war der Start der brüderlichen 40-jährigen Familienzusatzversorgung aus dem Westen.
Brütende Sommerhitze zum ersten Wiedersehen in der Heimat. Das Freibad brechend voll. Albrecht, der große Bruder „aus dem Westen“ spielte mit Freunden „Turmhaschen“. Wie gern hätte Frieder dort mitmachen wollen, klebte förmlich am Beckengeländer, stolz jauchzend, wenn der Bruder dem Häscher entkam.
Auf dem 3-Meterbrett standen die Jungs, bereit zum Springen. Sobald der Fänger die dritte Stufe der Leiter berührt, musste er über den Turm den anderen hinterher springen, einen der zum Beckenrand flüchtenden abschlagen. Alle hasteten dann zurück auf den Turm, der alte oder neue Fänger hinterher.
Klatsch, klatsch, klatsch - in alle Richtungen hechteten sie in die warme Brühe. Albrecht, diesmal Fänger, sprang nach.
Kurz tauchten sein Kopf, ein Arm auf, dann ging er unter. Alle lachten, dachten, er macht Spaß. Nur einer sprang zurück, zog Frieders Bruder an die Oberfläche, wissend, dass er ihn unter Wasser getreten hatte.
Albrecht konnte beide Füße nicht mehr bewegen. Bis zum Bauchnabel gelähmt, wurde er auf die Bank gelegt. Später bugsierten sie ihn auf die Sitzfläche eines alten OPEL, mit welchem Vati vorfuhr. Es war schrecklich grausam. Der Fuß des Ausreißers hatte den Halswirbel gerammt. Durch den sitzenden Transport im OPEL staute sich Blut im Nervensystem. Dessen Folgen und die brütende Hitze der Tage im Krankenhaus gaben ihm den Rest.
Das erste und einzige Mal, dass Vater weinte:
„Heut Nacht geht es zu Ende, sagt der Arzt.“
In dieser bewussten Nacht schlug unerwartet das Wetter um, kühl und frisch.
Nach Wochen konnte Albrecht aufstehen, fuhr zurück nach Westen, den rechten Fuß bei jedem Schritt hinter sich herziehend.
Der blockierte Nerv am Hals, unheilbar - ein Leben lang wird er behindert sein.
Spärliche Erinnerungen an Vater werden erneut wach.
Bis auf donnerstags und sonntags saß er abends bei der Mia oder „Prößdorfs“ beim Skaten. Obwohl ein guter Spieler, seine Skatfreunde aber weit begüterter, Großbauern, Fabrikbesitzer, ging die Spielerei doch ins Geld. Dies war immer knapp.
Einmal brachte Vati ein großes Briefmarkenalbum mit, was er seinem Jungen klammheimlich zeigte. War er doch leidenschaftlicher Sammler. Vati muss dieses beim Skaten als Pfand für nicht bezahlte Spielschulden erhalten haben, was Frieder natürlich nicht wusste. Supermarken, große schöne bunte aus Ecuador und viele vollständige Sätze.
Mehrere Tage lag das Album oben auf dem Küchenschrank. Öfter ist Frieder heimlich raufgeklettert, hat die Marken angesehen - als es immer noch da oben lag - einige stibitzt. Die Steckreihe im Album wieder mit den restlichen Marken aufgefüllt.
Dann war das Album weg. - Wächst Gras drüber?
Wochen später. Abends in der Küche sagt Vati: „Frieder, aus dem Album fehlen Briefmarken, es gehört nicht mir, hast du sie gemopst?“
Das Skatpfand war eingelöst, die fehlenden Marken vom Schuldner moniert worden.
Mutti guckte sehr vorwurfvoll. Frieder, der Lüge nicht fähig, gab mit rotem Kopf alles zurück.
Viel hat der Vater nicht mit dem Kind gemeinsam unternommen, vielleicht ist ihm deshalb das Wenige besonderes in Erinnerung: Wie er an seinen skatfreien Abenden auf dem Sofa liegend ihn mit dem Kopf an sein Fußende lockte, blitzschnell die Decke von den Schweißfüßen mit ihren ekelhaft riechenden Socken zog, ihn mit deren stechendem Mief erschreckte.
Komisch, trotzdem durfte in seinem Beisein keiner zum Abendbrot stinkigen Käse essen.
Oder, wie er beim Sonntagsspaziergang nach Sommeritz mit ihm von Bäumen abgeschnittene Äste geschnitzt, als Speere nutzte.
Den nachhaltigsten Einfluss auf seine Entwicklung werden wohl dessen Anregungen zum Tüfteln, „knobeln“ genannt, gewesen sein: verblüffende Lösungen von Denkspielen und Rechenaufgaben, das Schachspielen hat er ihm auch beigebracht.
Ob das aber Frieders erfinderische Veranlagung mit geprägt hat? - ist zu bezweifeln, immerhin üben das wohl viele Väter.
Nun ist er tot!
So wie das Beil einen Holzklotz teilt, ein einzelner Scheid seine ursprüngliche Kraft verliert, so verlor der bürgerliche Familienstamm seine Bedeutung, seinen Wohlstand, seine Reputation in der Stadt.
Mütterlicherseits hatte der Großvater Richard Knorr noch vor dem 1.Weltkrieg zwar das herrschaftliche Haus mit dem 3.Turm der Stadt in der Mitte des Marktes, dem Zentrum der Stadt gebaut. Betitelt als Ratsuhrmachermeister wachte er über die städtischen Uhren im Kirch- und Rathausturm und am Bahnhof, Optiker zugleich und Händler für Porzellan und Schmuck. War längst verstorben, das Geschäft still gelegt, die Großmutter, ihr Leben lang Hausfrau. Ohne Rente, muss sie von den spärlichen Mieteinnahmen des Hauses leben.
Väterlicherseits brach auch alles weg. Jetzt kam raus, Werkstatt und Haus am Bahnhof wären verschuldet. Der ursprünglich vorgesehene Nachfolger für das Handwerk eines Tischlers am Bahnhofsplatz war jetzt im Westen, fürchtete Repressalien bei Rückkehr, hatte sich eingerichtet in der besseren Welt. Somit verzichtete die Mutter auf die gesamte Erbschaft, besser auf die Hypothekenschuld.
Vater zahlte bisher knappes Wirtschaftsgeld, womit sie die Familie im Haus am Markt versorgen musste. Die Geschäfte wurden dagegen im Vaterhaus am Bahnhofsplatz mit der Großmutter Ernestine besprochen. Mutter war außen vor! Traditionell besuchten junge Mädchen von Handwerkerfamilien nur eine Haushaltsschule, heirateten anschließend. Sie war ohne Beruf!
Jetzt nähte die 72-jährige Oma und deren 48-jährige Tochter in Heimarbeit bis in die Nacht Knöpfe auf Pappen und an Hosen, bügelten und nähten Bündchen an Kleider, um die Familie mit dem 9-jährigen Frieder und dessen 17-jähriger Schwester, welche im Klosterinternat zu Erfurt wohnte, um Kindergärtnerin zu erlernen, zu ernähren. - Schmalhans zog ein!
Aus war es mit dem Streunen durch die Tischlerei, mit dem Spielen im Spänebunker.
Oma Knorr hatte sich was ganz Besonderes für den kleinen Frieder ausgedacht. Einen Muff aus schwarzem Katzenfell, in welchen er wie ein Mädchen seine Hände stecken musste, beim winterlichen fast täglichen Gang auf den Friedhof, von Mutti und Oma, auch in Schwarz, eskortiert. O Gott, war das peinlich!
Bis in die Nacht ratterte die Nähmaschine, auf der Mutti und Oma in Heimarbeit für die THÜDAMA, unsere Kleiderfabrik, nähten, um weniges zu verdienen.
Nur wenn Albrechts Westpäckchen kamen, zog Wohlstand ein.