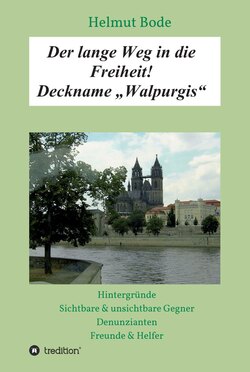Читать книгу Der lange Weg in die Freiheit! Deckname "Walpurgis" - Dr. Helmut Bode - Страница 10
Оглавление4. Moçambique
Bezogen auf den hier behandelten Zeitraum, lag unser Abenteuer Moçambique fünf Jahre zurück, aber, da wiederholt von unserem Einsatz in Moçambique die Rede ist, erscheint es angebracht, hierzu einige Ausführungen zu machen.
Ende 1978 bzw. Anfang 1979 wurde ich gefragt, ob ich nicht für zwei Jahre an der Universität in Maputo, Moçambique, als Lehrkraft für Automatisierungstechnik arbeiten möchte. Meine Bedingung war, aber nur mit meiner Familie. Zur Vorbereitung auf den Einsatz fand von Ende Februar bis Mitte Juni 1979 an der Fachschule in Rodewisch ein Lehrgang zum Erlernen der portugiesischen Sprache usw. statt. Viele Hochschulen, Universitäten und einige Akademie-Institute der DDR hatten Vertreter aus unterschiedlichen Fachrichtungen entsandt.
Einige Zeit nach Abschluss dieses Lehrganges, wurde mir mitgeteilt, dass ich derjenige von den drei Mitarbeitern unserer Hochschule sei, der ausgewählt worden ist, zusammen mit meiner Familie nach Moçambique entsandt zu werden. Wieso gerade die Auswahl auf uns gefallen war, ist uns heute noch unklar! Ich war kein Genosse und wir hatten briefliche und persönliche Kontakte zu Verwandten und Bekannten in der Bundesrepublik Deutschland.
Zwischen dem Außenhandelsunternehmen LIMEX GmbH Berlin und mir wurde am 18. Juli 1979 ein entsprechender Vertrag geschlossen, gegengezeichnet vom Direktor für Kader und Qualifizierung der TH „Otto von Guericke“ Magdeburg (nachfolgend THM genannt). Die Dauer und die Art der Tätigkeit ist im §1.1 [3.] wie folgt vereinbart:
»Der Spezialist wird für die Dauer von zwei Jahren in Moçambique bereitgestellt. Der Einsatz dort erfolgt als Dozent für Automatisierungstechnik.«
In einem Nachtrag zu meinem Arbeitsvertrag vom 30. Juli 1979 mit der THM [4.] wurde u.a. vereinbart:
»…
1. Herr Dr. Bode, … tritt mit Wirkung vom 16.08.1979 einen zweijährigen Auslandsaufenthalt als Dozent in Mosambique [sic!] an.
2. Während der Zeit des Auslandsaufenthaltes wird Herr Dr. Bode von den sich aus dem Arbeitsvertrag … ergebenden Pflichten an der THM entlastet. … «
Am 20. Juli 1979 wurde:
»Zwischen dem Versorgungszentrum Pharmazie und Medizintechnik Magdeburg und der Kollegin Rosemarie Bode … zur Sicherung arbeitsrechtlicher Ansprüche mitreisender Ehepartner bei Delegierung ins Ausland … folgende Vereinbarung getroffen: 1. Kollegin Bode, Rosemarie, begleitet den Ehepartner für die Dauer des Auslandseinsatzes von zwei Jahren. Während dieser Zeit ruht das Arbeitsrechtsverhältnis mit der Kolln. Rosemarie Bode. Arbeitsort und Arbeitsaufgabe werden im Rahmen des jetzigen Einkommens nach der Rückkehr neu vereinbart.« [5.]
Wichtig ist, dass in allen Verträgen oder Vereinbarungen immer die Rede von zwei Jahren ist und nicht, wie später behauptet, von drei Jahren. Wir hatten mit unserer Tochter vereinbart, dass sie ein Jahr mit nach Moçambique kommt und das zweite Jahr in einem Internat in der DDR verbringen sollte. Dies war erforderlich, da die Schule der Botschaft nur bis zur vierten Klasse unterrichtete. Nur so war es für uns akzeptabel, denn länger als ein Schuljahr hätten wir unsere Tochter nicht in ein Internat gegeben. Da es in einem derartigen Internat nicht nur um die Vermittlung des üblichen Lernstoffes ging, sondern ganz gewiss auch um die Herausbildung von dem Arbeiter- und Bauern-Staat treuergebenen Klassenkämpfern. Zu Hause konnten wir nachmittags, an den Wochenenden und Feiertagen der politischen Indoktrination durch die Schule gegensteuern, um das Schlimmste zu verhüten. Da war ein Jahr Internatsaufenthalt schon fast zu viel! Es gab in Maputo auch eine internationale Schule, aber die zu besuchen war für ein Kind aus der DDR „völlig unakzeptabel“, darüber wurde nicht einmal diskutiert!
Da sich unsere Reise als außerordentlich abenteuerlich gestalten sollte, nachfolgend eine etwas ausführlichere Darstellung.
Es begann das Planen, Organisieren Vorbereiten und Packen. Was gab es in Moçambique nicht, d.h., was mussten wir unbedingt mitnehmen. Später stellte sich heraus, dass es noch viel weniger gab, als die gut informierten Stellen uns hatten wissen lassen. Wäsche und Bekleidung für vier Personen, Lebensmittel (Mehl, Obst- und Fleischkonserven), Hygieneartikel, Waschpulver, Arzneimittel usw. wurde in sehr große Koffer verpackt, die aber erst einmal beschafft werden mussten. Die Koffer sollten per Luftfracht nach Maputo gelangen. Andere Gebrauchsartikel wurden in Kisten für den Seetransport verstaut. Nun war die DDR mit Konsumgütern auch nicht gerade gesegnet, sodass es manche Rennerei gab, um bestimmte Dinge zu ergattern. Rosemarie besorgte sich Sauerteig und lernte Brot backen, für das natürlich das entsprechende Mehl mitgenommen werden musste. Schulsachen für die Tochter und Spielsachen für beide Kinder. Zum Impfen mussten wir nach Berlin fahren usw.
Am 30. August 1979 war es nun soweit, beide Omas und Rosemaries beste Freundin Anna waren zum Abschied erschienen. Das viele Gepäck und wir haben kaum in den B100071 gepasst, dann ging es los. Gegen 11 Uhr waren wir in Berlin-Schönefeld. Die uns betreuende Firma LIMEX verkündete, dass aus Moçambique kein Flugzeug gekommen sei und wir wieder, bis auf Abruf, nach Hause fahren sollten, unsere Luftfracht-Koffer könnten wir ja aufgeben. Beides haben wir gemacht, so dass wir abends wieder in unserer Wohnung waren. Den Möbeln wurde wieder ihre Verkleidung abgenommen usw. Wir haben uns nirgends mehr gemeldet. Unser Aufenthalt auf der Straße glich einem Spießrutenlauf, immer wieder mussten wir erklären, wieso wir noch da sind! Ständig erhielten wir Anrufe oder Telegramme mit möglichen Abflugzeiten, bis es dann, drei Wochen später, am 20. September 1979, wieder einmal so weit war.
Wir, d.h. Rosemarie, unsere beiden Kinder und ich sowie unser diverses Handgepäck, einschließlich eines Römer-Peggy-Kinderwagens zum Transport unseres Sohnes, wurden zum Flughafen Berlin-Schönefeld gefahren. Meine Familie in einem vorbestellten Zimmer des Flughafenhotels zurücklassend, fuhr ich mit dem Fahrer nach Berlin zur Firma Limex72, hier bekam ich unsere Papiere und 42 US-Dollar Reisegeld! Für meine Frau und mich gab es je einen grünen, unsere Tochter erhielt einen blauen Reisepass. Für unseren Sohn erhielten wir einen Kinderpass mit seinem ersten Passbild.
In der DDR gab es eine Drei-Reisepass-Hierarchie. Die gewöhnlichen Bürger wurden mit blauen, die Reisekader mit grünen und die im diplomatischen Dienst stehenden Genossinnen und Genossen wurden mit roten Reisepässen ausgestattet.
Um 23: 30 sollten wir starten, entsprechend rechtzeitig hatten wir uns zum Abflugbereich begeben und saßen nun im Transitraum, aber es verzögerte sich von Mal zu Mal. Um Mitternacht war die Besatzung der Boeing 707 der moçambiquanischen Luftfahrtgesellschaft DETA73 immer noch nicht auf dem Flughafen. Unter der Hand erfuhren wir, dass die Besatzung nicht aufzufinden sei! Es wurde, natürlich nur unter größter Verschwiegenheit, gemunkelt, dass nach längerem Telefonieren mit einschlägigen Nachtbars, die Besatzung endlich aufgespürt worden sei und wir demnächst an Bord gehen könnten, was aber noch dauerte. Es war nun schon das zweite nicht so erbauende Erlebnis mit den Vertretern des Landes, in dem wir die nächsten zwei Jahre verbringen sollten.
Zwischenzeitlich hatten einige Mitglieder unserer Gruppe schon ihren Vorrat an Reisedollar angegriffen, es war ja auch zu verlockend.
Endlich wurden wir nun doch noch aufgefordert in einen Bus zu steigen, in dem wir aber wieder warten mussten! Irgendwann setzte sich schließlich der Bus doch noch in Bewegung und brachte uns zur Maschine. Wir durften einsteigen! Leider wurde uns verwehrt den Kindersportwagen (Römer-Peggy) mit an Bord zu nehmen, so wie wir es uns gedacht hatten. Er wurde zum Laderaum gebracht. Unser Sohn hätte schön darin schlafen können.
Plötzlich ging alles schnell, kaum hatten wir in der Maschine unsere Plätze eingenommen, da wurde das Licht ausgeschaltet und die Maschine rollte mit zweieinhalb Stunden Verspätung zur Startposition. Wir saßen auf der linken Seite, neben mir unsere Tochter und vor uns Rosemarie mit unserem Sohn. Die Maschine war nur wenig besetzt.
In diesem Moment habe ich mir gedacht, auf was hast du dich da bloß eingelassen, was mutest du deiner Frau und deinen Kindern zu, wie soll das ausgehen? Rosemarie beschreibt in ihrem ersten Brief an ihre Freundin Anna die Situation wie folgt:
»Am 21. hatten wir im Flughafenhotel ein Zimmer, das war sehr günstig. 2330 sollte die Maschine fliegen, sie stand direkt auch schon da – ein großer weißer Vogel –. 1 Std. vorher mit den Kindern auf dem Flugplatz, aber um 2400 war die Besatzung immer noch nicht aufzufinden!! Der Kleine war am Anschlag und wir auch und von da ab hatte ich regelrecht Angst, daß und ob alles gutgeht. Mit dem Gepäck war alles eine Würgerei, mit dem Kinderwagen ein hin und her. Wir durften ihn nicht mit ins Flugzeug nehmen und wir mußten hin und her packen. Wir wußten nicht wie es mit dem Platz für Lars war, aber dann hatte ich erst einmal 2 Sitze für ihn. Die Betreuung im Flugzeug unmöglich, wir waren kaum drin, da ging das Licht aus und wir rollten los. Na ja, um 200 erhoben wir uns in die Lüfte, das Flugzeug also einwandfrei, leise, bloß Lars ging es glaube ich nicht so gut, aber er schlief dann Gott sei Dank bald ein. Glaubst Du, wie wir dann oben waren, da wurde mir erst einmal bewußt, auf was für ein Abenteuer wir uns eingelassen haben – ich hatte also nur Schiß, muß ich ehrlich sagen. Berlin von oben war sehr schön und dann war Pause. Wir wußten nicht wo lang usw. Ich war so aufgeputscht, daß ich auch nicht schlafen konnte.
Gegen 400 überflogen wir eine Riesenstadt, es kann nur Paris gewesen sein, es war wunderschön, natürlich keine Information. Als wir doch so eingedruselt waren, um 600, heißt es anschnallen, wir landen in Lissabon. …«
Wir hatten die Information erhalten, dass die Maschine direkt von Berlin nach Maputo fliegt, dass wäre nach meinem Laienverstand ein Flug in Richtung Südsüdosten, aber nach einigen Kurven stellte sich mein Kompass auf eine südwestliche Richtung ein, sodass ich annahm, hier im Flugzeug funktioniert er nicht richtig. Es war aber ein Irrtum, denn wie wir aus Rosemaries Brief erfahren, landeten wir nach ca. vier Stunden in Lissabon, der Hauptstadt Portugals, sodass mein Kompass doch richtig angezeigt hatte.
Hier weiter aus Rosemaries Brief:
»Für eine ¾ Std. sollten wir das Flugzeug verlassen, ich nahm vorsichtshalber die Nuckelflasche und das Windelzeug mit – 3 Std. hat's gedauert. In einem stickigen Transitraum ohne Sitzgelegenheit und in einer pottdreckigen Küche Flasche wärmen usw. – wir waren restlos sauer!«
Nun wurde das Flugzeug voll. Menschen, Gepäck, Körbe voller Obst, Gemüse und z.T. wohl auch mit Kleintieren, quetschten sich in der Kabine zusammen. Wenn mir nicht bewusst gewesen wäre, dass wir in Lissabon wieder in das Flugzeug gestiegen sind, mit dem wir bereits aus Berlin gekommen waren, so hätte ich geglaubt, wir sitzen in einem afrikanischen Überlandbus! Zu allem Überfluss wollte nun auch noch eine Stewardess unserem Sohn den Platz wegnehmen. Einen solchen Fall wohl ahnend, hatte mich die Dame von Limex bei der Übergabe der Flugscheine extra darauf hingewiesen, dass sie uns für vier Personen die Tickets besorgt habe, damit der Junge seinen vollen Platz beanspruchen könne. Es war mein erstes Rededuell in Portugiesisch, was die Stewardess davon verstanden hat, weiß ich nicht. Wir gaben ihr aber zu verstehen, dass wir das Flugzeug verlassen, wenn sie diesen Platz anderweitig besetzt! Auf jedem Fall hat sie es nicht noch einmal versucht, unserem Sohn den Platz streitig zu machen. Vor uns saßen zwei Herren, die sich die Zeit mit Rauchen vertrieben und dass über zehn Stunden! Wie gut, dass heute bei den Flügen der meisten Airlines das Rauchen untersagt ist.
Bei zunächst guter Sicht konnten wir einiges von Portugal sehen, dann ging es etwas östlich quer über Spanien und das Mittelmeer, um schließlich die Küstenlinie des afrikanischen Kontinents zu überfliegen. Von hier flogen wir wohl direkt Richtung Maputo, immer einen südsüdöstlichen Kurs. Zunächst sahen wir noch Land, Felsen und Wüste, dann war es mit der Sicht vorbei. In der Maschine wurde es immer wärmer, bis wir erfuhren, dass die Klimaanlage ausgefallen sei und vor uns die Kettenraucher!
Nach ca. neuneinhalb Stunden wurden die Triebwerkgeräusche immer leiser, ging nun auch noch der Treibstoff zur Neige? Nein, wie ich später erfuhr, wurde rechtzeitig der Sinkflug eingeleitet, wozu nicht mehr die volle Triebwerksleistung notwendig war. Aber endlich setzte die Maschine zur Landung an und nach zehn Stunden und zehn Minuten hatten wir es geschafft, wir waren in Maputo.
So wie die Zusteiger in Lissabon in die Maschine gestürmt waren, verließen sie diese nun auch wieder, es war chaotisch. Nach unserer Zeit war es 19: 10, in Maputo bereits eine Stunde später. Der Flugplatz war unbeleuchtet und es herrschte eine drückende Schwüle bei ca. 28 °C. Nach dem es mir gelungen war, den Kinderwagen aus der Ladeluke gereicht zu bekommen, ging es zur Abfertigung. Bepackt und warm angezogen, lief uns das Wasser am ganzen Körper herunter. Unser Sohn war nervlich wieder am Ende und es war noch nicht abzusehen, wie alles weitergeht. Aber dann klappte es doch gut und schnell. Die Leute von der Universitätsgruppe waren zur Stelle und halfen uns bei der Abfertigung.
Im Gedränge vor dem Ankunftsschalter war es uns nicht mehr möglich auch den Reisepass unserer Tochter mit dem Einreisestempel versehen zulassen, was uns später noch Schwierigkeiten bereiten sollte. Man hatte uns einfach weitergeschoben.
Mit einem Bus der Uni ging es zunächst durch eine illegale Siedlung, bestehend aus Wellblech- und Strohhütten, die sich zwischen den Flughafen und die Stadt Maputo geschoben hatte, dann waren wir bald in der Rua D. Für uns und eine andere Familie, ebenfalls mit einer Tochter, so alt wie unsere Tochter und einem Sohn, ein Jahr und neun Monate alt, war ein Reihenhaus, die Nr. 35, reserviert.
»Wir waren erstmal heilfroh, kein Hotel, kein Internat, wo die meisten Leute untergebracht waren. Hauptsache für alle ein Bett!! Das Haus auf den 1. Blick sehr schön. Gebaut für 1 Familie mit Bediensteten, 3 Etagen.«
Ein Vorgarten mit einem großen Kaktus und einer breiten Einfahrt für ein Auto, welches in einer offenen Garage auf der rechten Seite des Erdgeschosses eingestellt werden konnte. Links war der Eingangsbereich mit einer Toilette sowie genügend Platz für eine Garderobe. Hinter diesem Eingangsbereich befand sich ein Raum, Zugang nur von der Gartenseite, mit WC und Dusche für den Doméstico, den wir natürlich nicht hatten, obwohl es genügend junge Leute gab, die gerne diesen Dienst als Hausgehilfe übernommen hätten! Dominierend im Eingangsbereich war aber die Treppe zum ersten Geschoss. Dieses bestand aus einem großen Raum, von dem nur die Küche mit der Speisekammer abgetrennt war. Es hätten drei Räume sein können. Zur Straßenseite hin, über der Unterstellmöglichkeit für ein Auto, befand sich ein Balkon.
Das zweite Geschoss hatte nach vorne zwei Schlafzimmer und nach hinten zwei Kinderzimmer, dazwischen lagen das Bad mit Dusche, Wanne, BD74 und Waschbecken; eine Toilette mit Waschbecken sowie eine Dusche mit Toilette und Waschbecken. Das dritte Geschoss bestand aus einem großen Raum, der zur Straße hin durch einen Balkon, welcher sich über die gesamte Hausbreite erstreckte, abgeschlossen war. Hinter dem Haus befand sich ein Gärtchen mit einem riesigen Gummibaum und verschiedenen, uns meist unbekannten Pflanzen, umgrenzt von einer relativ hohen Mauer. Das Gärtchen war entweder über eine Treppe von der Küche aus zu erreichen oder vom Vorgarten über den Durchgang, in dem ein Auto abgestellt werden konnte.
Im Haus gab es, bis auf die Schlafzimmer für die Erwachsenen mit den kleinen Jungen und die Zimmer für die beiden Mädchen, keinen Bereich, in dem die Familie ungestört bzw. unbeobachtet war. Komplikationen vorprogrammiert!
Wir lebten wie in einer Kommune, was für uns völlig unhaltbar war, auch dass es eine Raucherin gab, die wohl sehr unter dem Zwang, so wenig wie möglich zu rauchen, litt. Sicherlich hatten die Verantwortlichen die Vorstellung, dass sich die beiden vierköpfigen Familien untereinander helfen oder ergänzen könnten, was sich aber, mit ganz wenigen Ausnahmen, als falsch erwies. Wir lösen gerne unsere Probleme selbst und nicht im Kollektiv.
Es gibt eben Situationen, die jede Familie auf ihre Art und Weise regelt. Unser Sohn wurde z.B. im Laufe des Vormittags noch einmal zum Schlafen gelegt, sodass er mittags relativ erholt war und in Ruhe sein Essen mit uns einnehmen konnte. Der Sohn unserer Mitbewohner hatte sich gewöhnlich im Laufe des Vormittags müde gelaufen, sodass er häufig während des Essens einschlief oder sehr unleidlich war.
Hierzu nur eine Episode, wie fast jeden Tag in der Woche, saßen wir auch diesmal wieder, alle acht Personen, an dem großen Tisch vor der Küche beim Mittagbrot und unser kleiner Mitbewohner war nicht zu bewegen zu essen. Was er aber sehr gerne tat und auch diesmal, er sah zu uns herüber und wollte dabei seinen Kopf abstützen. Er traf hierbei mit dem Ellenbogen auf den Rand seines noch mit Suppe vollen Tellers. Was dann geschah, muss ich nicht weiter schildern, auf jedem Fall war die Ruhe am Mittagstisch empfindlich gestört.
Gerne wurde auch von der Mitbewohnerin in Rosemaries Töpfe gesehen, die sich in Vorbereitung des Mittagsessens auf dem Herd befanden! Dies hat sich aber ab dem Moment gelegt, wie die Seekisten angekommen waren und Rosemarie nun ihren Schnellkochtopf einsetzen konnte. Dieser Topf war mit einem Sicherheitsventil in der Mitte des Deckels versehen, welches wohl von der Topfguckerin irrtümlich als Deckelgriff angesehen wurde. Eines Tages kam es, wie es kommen musste, denn beim Anheben des vermutlichen Deckelgriffes entwich zischend der Dampf, gefolgt von einem Aufschrei und beendete fortan die Deckellüftaktion!
Jede der beiden Familien hatte mehr oder weniger Vorräte an Nahrungsmittel, Waschpulver usw. von zu Hause mitgebracht, die eben dann auch recht unterschiedlich schnell zur Neige gingen, auch dies führte zu Problemen. Rosemarie war wesentlich geduldiger als ich und musste wohl öfters schlichtend eingreifen, wenn ich gerade einmal im Hause war und meinen Unwillen lauter als im Flüsterton zum Ausdruck brachte.
Heute, wo ich diese Zeilen schreibe, lese ich in einem Brief von Rosemarie an ihre Freundin Anna vom November 1979, wie stark sie doch auch diese Wohnungssituation belastet hat, wie nachfolgen zu lesen ist:
»Nun zum Haus: Wir haben das Riesen-Zimmer in der 1. Etage in 3 Teile geteilt. 2 Wohnzimmer u. 1 Eßzimmer, natürlich ist nichts abgeschlossen und man hört jedes Wort der Nachbarn. Zum Frühstück, Mittag u. Abendbrot treffen sich immer 8 Personen, für die ja auch in 1 Küche gekocht wird, das zehrt alles furchtbar an unseren Nerven, nur wenn die kleinen Kinder mal gemeinsam schlafen ist etwas Ruhe. Ich kann mich wirklich zurückhalten, aber auf die Dauer mache ich nicht mit. Dazu ist man zu alt und sein eigenes Leben gewöhnt. Man kann sich nie mal gehenlassen u. ist immer unter „Aufsicht“! Da die (kleinen) Kinder um 1800 ins Bett müssen u. nur 1 Bad, muß immer einer hasten, der andere warten, also kein Dauerzustand.«
Zu der für Rosemarie im Haushalt belastenden Situation berichtet sie an ihre Schwester:
»Die Wäsche wäscht man nur, weil sie verschwitzt ist. Wir kochen sie übrigens in einem 50-l-Waschtopf, den wir dann die Treppe hochschleppen u. in die Wanne auskippen, deren Ablauf auch noch verstopft ist, so daß wir75 ausschöpfen müssen, also wunderbar! Constance ist recht angespannt durch Schule, Hausaufgaben, Schwimmen, Portugiesisch-Lernen, so daß nicht viel Zeit bleibt. Lust zum Schreiben hat sie auch nicht viel. Sonst ist sie ein fixer Kerl und kommt gut zurecht.«
Am 24. September, es war ein Montag, wurden wir neuen Lehrkräfte vom stellvertretenden Rektor der Uni, bei Anwesenheit der Dekane der Fakultäten, denen wir zugeteilt werden sollten, begrüßt. Ich wurde erwartungsgemäß der „Faculdade de Engenharia“ (Ingenieurwissenschaft) zugeteilt, aber zu meiner großen Überraschung kam ich nicht in den Bereich Elektrotechnik oder Maschinenbau, um dort Automatisierungstechnik zu lehren, sondern zusammen mit einem Kollegen aus der Uni-Gruppe, in den Bereich Chemie! Hier sollte ich zunächst das Manuskript zur Lehrveranstaltung „Economia e Análisa de Sistemas“ und später zum Lehrgebiet „Control Automática“ erarbeiten. Das erste Lehrgebiet entsprach der „Systemverfahrenstechnik“, wo ich weder genügende Kenntnisse, besonders im Teilgebiet „Economia“, noch Lehrmaterialien besaß! Das zweite Lehrgebiet, welches ich zu betreuen hatte, entsprach meiner Ausbildung, auch gab es dafür ein sehr leistungsfähiges, mit praxisnahen Versuchen ausgestattetes Labor.
Da es in der Bibliothek englischsprachige Literatur zum ersten Lehrgebiet gab, übersetzte ich diese zunächst in die deutsche Sprache und erstellte daraus dann ein Manuskript in Portugiesisch. Zu meinem Erstaunen fand man die portugiesische Übersetzung für eine Verwendung in der Lehre akzeptabel!
In dem Bereich, zu dem ich nun gehörte, gab es u.a. einen portugiesischen, einen italienischen und einen holländischen Kollegen. Mit dem Kollegen aus Amsterdam saß ich in einem Zimmer. Er war Fachmann auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik, sodass ich viel von seinen praktischen Erfahrungen profitieren konnte, er dagegen von meinen Erfahrungen in der Lehre, wir ergänzten uns gut, wie er mir auch zu verstehen gab.
Ich gehörte zur Uni-Gruppe der von der DDR entsandten Wissenschaftler und war, wie die anderen Mitglieder der Gruppe, Angestellter der Universität und somit galt die moçambiquanische Arbeitszeit. Die dort zu leistenden Stunden und Arbeitstage waren wesentlich umfangreicher als die der Mitarbeiter von DDR-Institutionen, für diese galten nämlich die Tropenarbeitszeit und die DDR-Feiertage. Weiterhin stand für sie gewöhnlich schon bei ihrer Ankunft eine von der DDR eingerichtete Wohnung und häufig auch ein Dienstwagen bereit.
Dessenungeachtet hatten wir von Zeit zu Zeit Dienstbereitschaft in der Botschaft von 3: 45 nachmittags bis 7 Uhr morgens des folgenden Tages. Wenn man darüber nachdachte, fühlte man sich schon als Menschen dritter Klasse. Rosemarie schreibt dazu an ihre Eltern:
»Dies trifft uns gerade so hart, weil wir nun ja schon so einiges zu Hause vorzuweisen haben und nicht in dieses Land gefahren sind, um erst was zu werden und hier werden wir wie der letzte Dreck behandelt, haben auch keine Tropenarbeitszeit. … Alle fühlen sich ganz furchtbar wichtig!!«
Die beiden Mädchen wurden mit einem Bus zur Botschaftsschule abgeholt und so auch wiedergebracht.
»In die Schule gehen etwa 30 DDR-Kinder, erst war sie mit der 2. Klasse zusammen, jetzt ist sie in der 4. Klasse allein mit 9 Kindern. Schöne Schule, intensives Lernen und sie machen allerhand mit den Kindern. Montags nimmt sie am Portugiesisch-Unterricht teil, donnerstags am Schwimmen. z.T. werden sie dort mit dem Bus hingefahren, teilweise müssen wir sie abholen, d. ist sehr umständlich bei den weiten Wegen. Na ja, vielleicht klappt es bald mal mit einem Auto für ein paar Familien von uns und wird noch Einiges ein wenig leichter. Ich bin da optimistisch, aber evtl. auch die einzige in der Familie!!! Das Erlebnis unseres Lebens wird Afrika sicher sein!!! Aber Du hast schon recht, es gibt auch Dinge, über die man sich freuen kann. Es gibt auch sehr schöne Straßen u. wunderschöne Häuser mit Schwimmbecken u. herrlichen Gärten und immer wieder blühen neue Bäume, Akazien in lila und orange, das ist wirklich eine Pracht, Palmen jeder Art und Größe und die Käfer werden auch immer größer!!! Es tauchen schon immer mal Prachtexemplare von Kakerlaken auf – Helmut hat Angst, daß sie beißen! Meine Nachbarin ist Gott sei Dank mutiger als ich.«
Der Arbeitstag verlief in fest vorgegebenen Zeitabschnitten, die uns von dem Fahrplan eines universitätseigenen Busses vorgegeben waren, d.h. 6: 15 Abfahrt zu der ca. zwanzig Kilometer entfernten Faculdade de Engenharia der Universidade Eduardo Mondlane. Zur Mittagszeit startete der Bus 12: 15 zur Rückfahrt, 13: 45 hatten wir uns wieder am Stellplatz einzufinden, um zur Uni gebracht zu werden. Die Heimfahrt traten wir dann schließlich um 17: 30 an, sodass wir gegen 18 Uhr zu Hause waren.
Ich empfand diese in immer gleichen Etappen ablaufende Arbeitszeit als ausgesprochen belastend. Der Bus fuhr selten die gleiche Route zweimal hintereinander, denn es musste mit Anschlägen gerechnet werden.
Einmal, es war ein Sonnabend, fuhren wir von der Uni kommend eine Route, die wir bis dahin noch nie gefahren waren, entlang der Uferstraßen. Plötzlich knallte es mehrere Mal, der Bus wurde schlagartig vom Fahrer gestoppt. Es stellten sich heraus, dass drei Reifen defekt waren und dass auf weiter freier Strecke! Den Tag dauerte es sehr lange, bis wir endlich zu Hause waren. Die Ängste, die unsere Frauen in dieser Zeit ausgestanden haben, kann man sich wohl denken. Handys gab es ja damals noch nicht! Später erfuhr ich von meiner Physiotherapeutin, dass einige Tage zuvor vier moçambiquanische Kinder durch eine Bombe umgekommen waren, der Krieg war eben noch überall präsent.
Es gab wohl kaum Geschäfte, die ständig mit den Waren des täglichen Bedarfs beliefert wurden. Von weitem erkannte man die gerade belieferten Geschäfte an den Schlangen, die sich vor ihnen gebildet hatten, teilweise mit bis zu zweihundert Personen, als „bicha76“ bezeichnet. Genau genommen, gab es immer zwei Schlangen. In der einen standen die Frauen, mit ihren Kleinkindern auf dem Rücken oder vor der Brust, dichtgedrängt. In der anderen, ebenfalls dichtgedrängt, die Männer. Häufig ließen die Afrikanerinnen unsere Frauen mit ihren kleinen Kindern vor!
Es passierte auch schon mal, dass der Bus zur festgesetzten Zeit nicht erschien! Die Fahrt nach Hause mit den öffentlich verkehrenden Bussen, war ein Erlebnis für sich. Diese Busse waren gewöhnlich voll bis zum Gehtnichtmehr, d.h. die Menschen waren dichtgedrängt und dass bei den dort herrschenden Temperaturen von 30 °C und mehr. Auch war uns diese Transportmöglichkeit eigentlich untersagt!
Die Siedlung, in der unser Haus lag, war sehr schön, teilweise wunderbare Häuser und Grundstücke, vielfach mit hohen Zäunen umgeben und von großen Hunden bewacht.
Für unsere Frauen gestaltete sich der Einkauf sehr schwierig, da die meisten Geschäfte in der etwa zwei bis drei Kilometer entfernten Innenstadt lagen, d.h. sie mussten mit ihren Kinderwagen die Fahrstraßen benutzen, da nur die wenigsten Straßen Fußwege besaßen. Von diesen wenigen Fußwegen war wiederum nur ein geringer Teil so geeignet, dass sie mit Kinderwagen befahrbaren werden konnten. Die Straßen waren noch aus der portugiesischen Zeit und da bewegte man sich vorwiegend mit dem Auto durch die Stadt.
Rosemarie beschreibt die Einkaufssituation wie folgt:
»… keine Butter, keine Margarine, kein Öl, kein Reis, bis jetzt keine Kartoffeln gesehen. Es gibt Blumenkohl (1 x), Mohrrüben, Tomaten, Zwiebeln, … Helmut hat mir 10 große Tüten Nudeln besorgt. Es kann einem Angst werden. Die Leute von der Uni77, die Frauen, kümmern sich sehr um uns, sie bringen Brot, Eier u. auch Milch, am Anfang Fleisch. Also man muß erfinderisch sein. Dafür essen wir Apfelsinen und Ananas, aber wie gesagt, das reicht auch nicht auf Dauer. … Ich komme beim Einkaufen schon zurecht, auch mit dem Geld, auf dem Markt schiebt man sich durch schwarze Leiber. Es gibt hübsche Menschen, junge Frauen u. süße Kinder, hinten oder vorn auf der Mutter.«
Über die Bevölkerung schreibt Rosemarie an ihre Eltern:
»Die Menschen hier sind so arm und doch strahlen sie eine Ruhe aus, es gibt keine Hektik und Nervosität, die Kinder sind immer bei der Mutter, schlafen und trinken bei ihr, wie sie es gerade brauchen, ich habe noch keines schreien oder nörgeln gehört. Wenn wir europäischen Mütter uns nur 1/3 davon abnehmen würden, wäre es schon gut.«
Da die Versorgung mit Lebensmitteln immer schlechter wurde und wir um unsere Kinder Angst hatten, sprach Rosemarie dies in einer Frauenversammlung an: „Wir haben ein fünfzehn Monate altes Kind, neben unserer zehnjährigen Tochter. Die Wohnung liegt am Rande der Stadt. Kein Kinderbett, kein Laufgitter, keine Klimaanlage, keine Grundnahrungsmittel und keine abgeschlossene Wohnung. Es wurden keine Maßnahmen zur Absicherung der Wohnung getroffen. Keiner hatte den Mut zu sagen, dass wir nicht mit den Kindern hätten kommen sollen. Wer ist für unser Problem verantwortlich? Als Mutter habe ich himmelangst. Wir möchten gerne helfen. Wir sind mit den schwärzesten Vorstellungen hergekommen, diese sind aber noch übertroffen. Wenn uns da nicht geholfen wird, sehen wir uns veranlasst die soeben genannten Punkte aufzuschreiben, bestätigen zu lassen und sofort nach Hause zu fahren.“
Die anwesenden Damen oder wohl besser die Genossinnen der Unigruppe waren schockiert und sahen Rosemarie voller Betroffenheit an, was nun? Wie kann man so etwas sagen!
Rosemarie und ich hatten vorher abgesprochen, dass sie sich so äußert. Einige Tage später fand in der Wohnung des Leiters der Unigruppe eine Aussprache über die Wohnungssituation statt. In Kurzform gebracht ergab sich Folgendes, „Entweder Sie wohnen weiter mit einer anderen Familie zusammen oder Sie können nach Hause fahren!“ Antwort: „Dann fahren wir nach Hause!“ Damit waren wir für unseren weiteren Aufenthalt in Moçambique „abgestempelt“!
Erwähnenswert erscheint mir noch, dass unser Sohn, seit dem 7. Oktober allein auf seinen Beinen stehen und mit ihnen laufen kann. Sicher hat er den „Tag der Republik“ nicht als Anlass für eine Selbstverpflichtung „Eintritt in die Gruppe der sich im aufrechten Gang fortbewegenden Spezies“ genommen!
So manche Beule handelte er sich in der nächsten Zeit an seinem kleinen Kopf ein, was aber wohl auch seiner Sprachfähigkeit enormen Auftrieb gegeben haben muss, denn immer neue Worte sprach er nach oder sprudelten aus ihm heraus. Seine Augenzähne waren nun auch schon alle gekommen.
Etwa 14 Tage nach unserer Ankunft kam auch das per Luftfracht verschickte Gepäck an.
»Es sah aber aus, als hätten sie es 100 m vor der Landung abgeworfen u. zwar in ein Farblager! Völlig verbeult, wenn es die Rückreise noch mal aushält, haben wir Glück. Naß ist es z.T. auch geworden u. etliche Sachen stockig, aber das kann uns auch nicht mehr erschüttern!«
war Rosemaries brieflicher Kommentar zu unserem Gepäck. Meine Fachbücher waren nur deshalb nicht durchnässt, weil ich sie eingewickelt hatte und die Feuchtigkeit noch nicht durchgedrungen war.
Am 13. Oktober, es war ein Sonnabend, erreichte uns gegen Mittag ein Anruf, wir Männer hätten uns um 15 Uhr in der DDR-Botschaft bzw. im Kino-Xenon, Versammlungshaus in der Nähe der Botschaft, einzufinden! Dies bedeutete einen Fußmarsch von ca. vier Kilometer, und das bei ca. 35 °C bis 40 °C. Wir benötigten 45 Minuten. Grund der Zusammenkunft war, dass vier Bürger der DDR im Landesinneren ihr Leben verloren hatten. Die Ursache wurde uns nicht genannt. Später sickerte durch, dass es wohl durch Hantieren an einem unbekannten Kampfmittel zu einer Explosion gekommen war! Der Schock saß sehr tief.
Als Trostpflaster und wohl auch als Reaktion auf Rosemaries Aufbegehren in der Frauenversammlung, wurde uns verkündet, dass in Zukunft die Möglichkeit des Einkaufs im Interfranca-Laden gewährt werden würde. Danach ging es vier Kilometer, mit einer sehr bedrückenden und einer optimistisch stimmenden Nachricht, zu Fuß, zurück zur Rua D.
Eines Tages ging an Rosemarie, sie stand vor unserem Haus in der Rua D, ein Afrikaner vorbei und grüßte mit „guten Tag“. Sie war so verblüfft, dass sie erst antwortete, wie er schon weitergegangen war. Sie kamen aber doch noch miteinander ins Gespräch. Martins hatte in Leipzig, als Delegierter der FRELIMO78, studiert und lebte nun mit seiner Familie in unserer Nachbarschaft in der Rua C. Er und seine Frau waren Angehörige der Befreiungsarmee. Schließlich brachte er uns, ganz ohne Aufforderung, einen Sack mit 45 Kilogramm Reis, weil er wusste, dass wir sehr wenig zu essen hatten. Wir boten den anderen Mitgliedern der Gruppe an, den Vorrat zu teilen, was uns aber einen weiteren Negativpunkt einbrachte, denn wir hatten den Moçambiquanern zu helfen und nicht sie uns!
Es war also nicht erwünscht, dass wir uns von moçambiquanischen Bürgern helfen ließen! Unser Angebot zu teilen, war also gleich an die Leitung weitergegeben und für uns negativ bewertet worden!
Zu Martins und seiner Familie hatten wir von da an einen guten Kontakt. Martins Frau Miséria war vor einiger Zeit von einer Tochter entbunden worden. Unser Sohn wuchs aus immer mehr seiner Kleinkindsachen heraus, die dann freudig von Miséria angenommen wurden. Eines Tages erhielten wir eine Einladung und fanden uns in der gesamten aus Moçambique zusammengeströmten Familie von seiner und ihrer Familie wieder. Da Martins und Miséria aus zwei verschiedenen afrikanischen Stämmen abstammten, konnten sie sich nur über Portugiesisch untereinander verständigen.
Miséria hatte ihren Vornamen dem Umstand zu verdanken, dass es zur Zeit ihrer Geburt ihren Eltern sehr schlecht ging, was sie mit dem Vornamen ihrer Tochter zum Ausdruck bringen wollten. Unser Sohn, damals mit ganz hellen Haaren, sowie die wenige Wochen alte Tochter von Miséria und Martins waren natürlich der Mittelpunkt der anwesenden Damenwelt.
Schon nach kurzer Zeit unseres Aufenthalts in Maputo musste ich feststellen, dass ich, wohl auf Grund des sich sehr häufig wechselnden Wetters, heißer Wind von Norden, dann ganz plötzlich kalter Wind von Süden, gesundheitliche Probleme habe. Zunächst war mir schwindelig, schlecht und ich hatte Kopfschmerzen, auch konnte ich nur unter Schmerzen meinen Kopf gerade halten, d.h. den Hals überhaupt nicht bewegen.
Wir hatten in der Unigruppe einen Arzt, er arbeitete am Hospital Central Miguel Bombarda in der „maternidade e clínica para mulheres“, d.h. in der Frauenklinik, den ich konsultierte. Von ihm wurde ich zu einem Ohrenarzt geschickt. Nach dem die ungarische Ohrenärztin alle ihre Möglichkeiten an Untersuchungen abgeschlossen hatte, empfahl sie mir, mich ihrer bekannten Neurologin vorzustellen.
Auch hier wurde ich wieder auf das Gründlichste untersucht, mit dem Ergebnis „Espondilose cervical“ – zervikale Spondylose. Die Neurologin verordnete mir Massagen und Packungen, also ging es weiter zur Physiotherapie.
Nach dem ich versucht hatte, der mich untersuchenden Dame mein Problem in Portugiesisch zu erläutern, fragte sie mich: „Sind Sie Deutscher?“ Auf meine bejahende Antwort sagte sie weiter: „Sie können ruhig Deutsch sprechen, ich bin Schwedin, verstehe aber auch Deutsch.“ Im weiteren Gespräch erklärte sie mir: „Ich schicke Sie zu einer Kollegin, mit der können Sie sich bestens in ihrer Muttersprache unterhalten, sie ist Deutsche.“
Die Physiotherapeutin war aus Oberbayern. Verheiratet mit einem afrikanischen Tierarzt, der sich im Auftrag der UNO in Moçambique um die Zucht und Haltung von Rindern kümmerte. Hier war ich in sehr guter Behandlung. Von ihr erfuhr ich auch sehr viel, z.B. was in der großen Stadt Maputo passierte, da auch der Polizeichef ihr Patient war!
Die Massagen linderten zwar meine Schmerzen vorübergehend, beseitigten sie aber nicht. Nach Abschluss der ersten zehn Massagen musste ich mich der behandelnden Neurologin, eine Ungarin, wieder vorstellen. Sie meinte, dass ich hier ständig behandelt werden müsste, empfahl mir eine Arbeitstherapie und im günstigsten Fall eine Behandlung in der DDR.
Letztlich entschied der Arzt der Botschaft, wenn in Moçambique eine ständige Behandlung nicht möglich ist, um die Ursachen meiner Schmerzen zu beseitigen, dann würde er die Heimreise veranlassen. So kam es schließlich auch, d.h. zunächst wurde mir empfohlen in die DDR zur Kur zu fahren, meine Familie in Moçambique zu lassen und anschließend meinen Einsatz in Moçambique fortzusetzen, wozu ich mich aber nicht entschließen konnte.
Ende Dezember leitete, nach dem von der Neurologin in ihrem Gutachten geschrieben wurde, dass eine entsprechende Therapie hier nicht durchgeführt werden kann und sie die Ausreise empfiehlt, was auch durch das Gutachten des Botschaftsarztes bestätigt wurde, die Firma LIMEX unsere Rückkehr in die DDR ein.
Rosemarie und die Kinder hatten sich wesentlich besser an die klimatischen Verhältnisse gewöhnt. Bis auf einen Tag Mitte November, wo es ihr plötzlich ganz schlechtging, sie litt unter Schwindelanfällen und hatte Durchfall. Sie war zu nichts mehr in der Lage, sodass ich mich um unseren Sohn kümmern musste. Wir befürchteten schon das Schlimmste, nämlich, dass die außerordentlich hohen Belastungen der letzten Zeit nun ihren Tribut bei ihr forderten. Aber, wir hatten Glück, sie erholte sich bald und übernahm, pflichtbewusst wie sie nun einmal ist, schnell wieder ihre Aufgaben, dass ich gerade derjenige war, dem dies nicht gelang, empfand ich als äußerst deprimierend.
Anfang November schreibt Rosemarie über die neue Einkaufsmöglichkeit im Interfranca:
»Es gab jetzt einige Male Erleichterungen für uns beim Einkauf, so daß ich jetzt mal 1 Sack Kartoffeln habe u. Fleischbüchsen, sogar Butter, Zucker u. Fisch, auch Whisky und Bols, so daß es wie Weihnachten war u. mal etwas Abwechslung in die Mahlzeiten kommt. Da bin ich dann schon zufrieden …«
und in einem Brief vom Dezember können wir lesen:
»Ich schrieb's wohl schon im letzten Brief, meine Vermutung mit 50 kg stimmt, Helmut wiegt 80 kg, haben also beide ca. 5 kg abgenommen. Das ging gleich am Anfang so rapide runter, durch die ganze Aufregung und die Angst, was es morgen zu essen gibt, und kommt Nachschub an Brot usw. Die ersten Wochen haben Helmut und ich überhaupt keine Butter gegessen. Aber das ist alles nicht so tragisch, es kommt zu Hause sicher schnell wieder drauf als uns lieb ist. Wir haben im Moment zu essen, obwohl bei Brot jetzt die große Knappheit ausgebrochen ist u. bei Eiern, auch bei Milch mal wieder – man ist also nie sicher wie lange die Vorräte reichen!«
Die Hauptlast bezüglich der Besorgung von Lebensmitteln hat Rosemarie getragen, wobei sie meistens von unserem Sohn, der in seiner Römer-Peggy saß, begleitet wurde. Die Wege von acht bis zehn Kilometer zu LI-MEX, zum Interfranca, zum Wochenmarkt usw. haben beide absolviert.
Ab November bekamen wir Schecks, erst sporadisch, dann wohl regelmäßig, sodass wir die Möglichkeit hatten, im Interfranca einzukaufen, was die Versorgungssituation wesentlich günstiger gestaltete. Nur wenn unsere Tochter zu Hause war, konnte Rosemarie allein in die Stadt gehen. Manchmal hat sie ihren kleinen Bruder auf ihren Rücken gebunden, so wie es die afrikanischen Frauen taten und sich unter die spielenden einheimischen Kinder gemischt.
Unser Sohn, mit seinen damals hellblonden Haaren war natürlich für die Kinder ein Anziehungspunkt. Sie konnten es wohl nicht glauben, dass er Haare hat, um das zu ergründen streichelten sie ihn immer wieder über seinen Kopf. Die von Rosemarie mitgenommenen Bonbons wurden von den afrikanischen Kindern geteilt, in dem sie diese durchbissen und das Bonbonpapier zum Ablecken an andere Kinder weitergaben!
Der Aufenthalt unserer Kinder, außerhalb unserer Wohnungen war nicht ganz ungefährlich, ständig musste ein Erwachsener in ihrer Nähe sein. Wenn Rosemarie unsere Tochter zum Schulbus brachte, war stets unser Sohn dabei, allein haben wir ihn nie gelassen. Unsere Tochter spielte in der Rua D häufig mit gleichaltrigen moçambiquanischen Kindern Fußball:
»Man muß aber bald wieder aufhören, denn die Hitze nimmt zu.«
schrieb sie an ihre Großeltern.
Einmal sagte mir meine Physiotherapeutin, dass es am nächsten Tag Fleisch geben solle, aber man muss schon sehr früh, also gegen 4 Uhr, dort sein. Ich machte mich also am nächsten Morgen um kurz nach 3 Uhr auf den Weg zur besagten Fleischverkaufsstelle. Ich werde die Situation nicht vergessen. Es war sehr dunkel, es gab kaum Straßenlaternen, die eingeschaltet waren, auch war ich wohl der einzige Weiße, der in dieser Nacht unterwegs war! Die schwarzen Afrikaner, die mir entgegenkamen, bemerkte ich erst sehr spät, denn das einzige, woran man sie eventuell erkennen konnte, war das Weiß ihre Augäpfel. Ich war dagegen weithin sichtbar. Nach etwa 25 bis 30 Minuten hatte ich mein Ziel erreicht und reihte mich in die Männerschlange ein. Wenn ich mich recht erinnere, haben mich die Männer nach Öffnung des Geschäftes noch nach vorne durchgereicht. Jedenfalls bekam ich eine ordentliche Portion Schweinefleisch und habe mich schleunigst auf den Heimweg begeben, wo ich dann auch unversehrt ankam.
Rosemarie hat ganz gewiss während meiner Abwesenheit kein Auge zu gemacht, denn so ein Nachtausflug war nicht ungefährlich. Es drohten nicht nur Gefahren von anderen Menschen, sondern auch von uns völlig unbekannten Getier, wie z.B. großen Spinnen, Skorpionen usw., welchen man aus dem Weg zu gehen hatte. Na ja, ich hatte es geschafft, und für einige Zeit war wir mit Fleisch versorgt. Schließlich stand ich pünktlich 6: 15 am Bus, mit dem es zur Uni ging.
Ende November absolvierten wir neuen Mitglieder der Unigruppe in der Engenheira vor einem Vertreter der Botschaft eine Probefahrt mit einem PKW, der rechts sein Lenkrad hatte. Der Prüfer beurteilte, wie wir uns in dem dort herrschenden Linksverkehr verhalten. Nach bestandener Prüfung erhielten wir von der Botschaft die Selbstfahrgenehmigung, sodass wir eine Woche später den an drei Familien zugewiesenen PKW TOYOTA-Starlet selbst fahren durften. Nun hatten wir alle drei Wochen ein Fahrzeug und waren dadurch wesentlich beweglicher.
Bisher hatte uns öfters eine Familie aus Magdeburg mit dem ihnen ständig zur Verfügung stehenden Auto zum Baden im Indischen Ozean mitgenommen, nun konnten wir selbst fahren.
Eine der ersten Fahrten war zum Hotel Polana, es lag bzw. es liegt noch heute, unweit vom Zentrum direkt am Meer. Obwohl wir in einer Volksdemokratie waren, wurde im Polana doch noch auf bürgerliche Etikette geachtet, sodass man Rosemarie und die Kinder passieren ließ, mich aber nicht! Ich hatte nur Sandalen ohne Strümpfe an. Es war nichts zu wollen, ich kam nicht in das Hotel. Schließlich gelang es mir doch noch, zur großen Freude meiner Familie, in das Hotel zu kommen, in dem ich den Personaleingang benutzte. Wir hielten uns vorwiegend am Swimmingpool auf und hatten einen wunderschönen Nachmittag. Verlassen habe ich aber das Hotel, zusammen mit meiner Familie, durch den Haupteingang, natürlich unbehelligt.
Viel, viel später erfuhren wir dann, dass zur Zeit unseres Aufenthaltes in Maputo, Rosemaries Bruder, er lebte damals in Bayern, dienstlich in Moçambique war und im Polana gewohnt hat!
Anfang Dezember besuchte der Minister für Hoch- und Fachschulwesen der DDR Moçambique. In diesem Zusammenhang wurden wir zu einer Arbeitsbesprechung mit ihm eingeladen. Der Aufenthalt sollte zukünftig auf drei Jahre festgelegt werden. Mein Vertrag war bekanntlich noch für die Dauer von zwei Jahre abgeschlossen worden. Zu dem Wohnungsproblem äußerte sich der Minister dahingehend, dass dies in der DDR hätte geklärt werden müssen. Vielleicht war doch etwas von Rosemaries und meinem Protest bezüglich der unbefriedigenden Wohnungssituation an das Ministerium weitergeleitet worden. Wenn man uns nämlich zu Hause gesagt hätte, wir bekommen keine eigene Wohnung, hätte ich den Zweijahresvertrag nicht unterschrieben.
Zukünftig wollte die DDR nur noch Lehrkräfte für drei Fakultäten entsenden, welche das sein sollten, weiß ich nicht, aber was dann kam, konnte ich nicht fassen, denn es war angedacht, die Anzahl der Lehrkräfte im Fach Marxismus-Leninismus auf ca. 30 bis 35 zu erhöhen! Was die Moçambiquaner dazu gesagt haben, weiß ich nicht, aber dem Aufbau von Wirtschaft und Industrie hat es bestimmt nichts genutzt, wenn dieses Vorhaben verwirklicht wurde.
Es waren wohl auch Bestrebungen im Gange, die Vertreter aus den westlichen Ländern durch Lehrkräfte aus dem sozialistischen Lager zu ersetzten. So wurde z.B. noch Anfang 1980 ein Spezialist für Wärmeübertragung aus der Sowjetunion erwartet. Für dieses Gebiet war aber mein holländischer Kollege laut Vertrag noch für ein Jahr und sechs Monate zuständig!
Zum Abend hatte dann die Ministerin für Bildung von Moçambique, zu einem Empfang geladen. Persönlich war sie aber nicht erschienen, was uns aber nicht weiter gestört hat! Es gab sehr viele und sehr ausgesuchte Gerichte zu essen. Nachdem wir fast ein Vierteljahr am Hungertuch genagt hatten, musste man mit dem Essen sehr vorsichtig sein, einigen Gästen gelang dies nicht! Es war der krasse Gegensatz zu dem, was der Bevölkerung täglich zur Verfügung stand.
»Man sieht in den Apotheken fast nur Arzneimittel aus der BRD und der Schweiz (Ciba).«
schreibt Rosemarie an ihre Freundin und führt weiter aus:
»Mit einer Apothekerin aus Lissabon haben wir uns unterhalten, sie ist ganz erstaunt, daß ich nicht arbeite, da es hier keine Apotheker gibt …«
Ich erinnere mich noch, dass Rosemarie erwiderte „Ich habe doch zwei Kinder zu betreuen!“ „Bei dem, was Sie verdienen würden, könnten Sie sich bequem eine Haushaltshilfe leisten!“ war die Antwort. Es waren wohl monatlich 30.000 Escudos, das Doppelte von dem, was die DDR mir in Moçambique für zwei Erwachsene und zwei Kinder bezahlte! Das Moçambique unseren Einsatz in Dollar beglich, versteht sich von selbst.
Eine Haushaltshilfe zu bekommen, wäre uns nicht schwergefallen, aber die Arbeit einer mitreisenden Ehefrau in der privaten Wirtschaft, das wäre sicher ein großes unlösbares Problem für die Genossen der DDR-Leitung gewesen. Soweit ging nun die Hilfsbereitschaft der DDR gegenüber der moçambiquanischen Bevölkerung doch nicht. Wie und womit geholfen wird, das zu entscheiden, traute man uns nicht zu! Nach der Auffassung dieser DDR-Strategen galt eine Haushaltshilfe als unterdrückte Person!
Ca. 700 m von der Rua D entfernt, in Richtung Innenstadt, bewohnte in der Avenida Vladimir Lenine No. 2409 ein Angehöriger der „Sektion Sozialistische Betriebswirtschaft“ der TH Magdeburg, die sehr geräumige Wohnung No. 9.3. Sie wurde nun frei, da sein Einsatz beendet war.
Der Bewohner hätte hier, den so oft von den Genossen während unseres Aufenthaltes in den Mund genommenen Begriff „Kameradschaft“ in die Realität umsetzen können. Denn für diesen Einpersonenhaushalt hätte sich sicher eine passende Unterkunft für die kurze Zeit gefunden, die er noch in Maputo war. Dadurch wäre es möglich gewesen, diese große Wohnung einer Familie bei ihrer Ankunft in Maputo zur Verfügung zu stellen! Von Kameradschaft reden und Kameradschaft praktizieren, sind eben doch manchmal zwei verschiedene Dinge. Vielleicht gehörten ja Nichtgenossen nicht zu dem Kreis, auf die sich die Kameradschaft bezog!
Nach einem langen hin und her in der Unigruppe, entschied man sich am 12. Dezember, uns die Wohnung zuzuweisen. Später erfuhr ich, dass sich für uns die Direktorin der Faculdade Preparatório, an deren Stelle ich das Manuskript für die Vorlesung „Economia e Análisa de Sistemas“ an der Faculdade de Engenharia Química erstellte und die Sekretärin der Jugendorganisation OJETM an der Uni für uns eingesetzt hatten, sodass es zu dieser Entscheidung gekommen war.
Beide waren an der Uni als Ingenieurinnen (Engenheira, mit der weiblichen Abkürzung Enga, welches unserem Dipl.-Ing. entspricht) ausgebildet worden. Mit ihnen unterhielt ich mich öfters, sodass sie auch unsere persönliche Situation recht gut kannten. Übrigens erfuhr ich in einem dieser Gespräche, dass bereits am 11. Oktober darüber entschieden worden war, uns die Wohnung zu zuteilen, also bereits zwei Monate vor unserem Einzug!
Nachdem der Vormieter am 13. Dezember die Wohnung verlassen hatte und wir in den nächsten Tagen die Wohnung für unseren Einzug vorbereiten konnten, bewohnten wir diese ab dem 16. Dezember. Es war ein unbeschreiblich befreiendes Gefühl, endlich wieder nur unter uns zu sein. Wir lebten auf.
Es war das erste von vier Hochhäusern auf der linken Seite, wenn man von der Rua D kam. Es gab mindesten zwei Aufzüge, die uns in die neunte Etage brachten. Betrat man die Wohnung, so gelangte man ohne Flur in einen großen Raum. Rechts ein großer Esstisch, daran anschließend die Küche, von der es auf einen Wirtschaftsbalkon ging, der aber auch vom Treppenhaus direkt erreichbar war. Den Wirtschaftsbalkon schloss eine Unterkunft für einen möglichen Doméstico ein, den wir ja nicht anstellen durften, und das obligatorische Betonwaschbecken mit einem Reibebrett, ebenfalls aus Beton, an dem der Hausangestellte zur portugiesischen Zeit sicher für die Familie seines Herren die Wäsche gewaschen hat.
Neben der Küche war eine Sitzecke mit sich anschließendem Balkon, dem Lieblingsspielplatz unserer Kinder. Von hier aus war der Blick frei in Richtung der Engenharia und der Einflugschneise des Flughafens, sodass wir, wenn es die Zeit zuließ, den Flugverkehr, besonders Landung und Start der Interflug IL62, beobachten konnten. Nach rechts sah man den indischen Ozean.
In der Mitte, der dem Eingang gegenüberliegenden Wand, war eine Tür, hinter der ein Korridor lag. Links ging es in einen fensterlosen Abstellraum, danach, ebenfalls ohne Fenster, kam das Bad. Geradezu, am Ende des Korridors, ging es in ein Zimmer, welches unsere Tochter bewohnte. Das Fenster lag zur Straßenseite, von hier ging der Blick über die Stadt mit ihren Hochhäusern. Auf der rechten Seite des Korridors hatte unser Sohn sein Zimmer, danach kam unser Schlafzimmer, beide mit gleicher Blickrichtung wie der Balkon. In den drei Schlafzimmern befanden sich eingebaute Schränke. In dieser schönen Wohnung ließ es sich aushalten.
Nun konnten wir auch Besuch empfangen, ohne dass dies gleich weiter gemeldet wurde, denn eigentlich war uns persönliche Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung verboten!
Am ersten Weihnachtstag waren Martins und Miséria mit ihrem Baby die ersten Besucher in unserer neuen Wohnung. Miséria konnte es nicht fassen, wie weiß das Mehl war, welches Rosemarie aus unseren mitgebrachten Beständen, extra für Weihnachten aufgehoben und verbacken hatte.
Es herrschten 36 °C, die Kerzen an unserem Weihnachtsgesteck knickten ohne, dass sie entzündet worden waren, ab. Sogar unseren Gästen war es zu warm. Martins wedelte unentwegt über dem Köpfchen seiner kleinen Tochter mit einem typischen Fächer aus Moçambique, aber viel kühler wurde es wohl dadurch auch nicht. Martins kannte ja, wie in Deutschland Weihnachten gefeiert wurde, nun freute er sich, dies einmal seiner Frau zeigen zu können. Umrahmt wurde alles durch die Weihnachtsmusik, die ich in Vorbereitung unserer Reise auf Kassetten übertragen hatte.
In der Nacht vom 26. zum 27. Dezember wurden wir durch Lärm, die mehrere Schüsse verursacht hatten, geweckt. Wir konnten auf der unter uns liegenden Avenida Vladimir Lenine eine größere Anzahl von schnell vorbeifahrenden Polizeiautos beobachten, dann war wieder Ruhe, d.h. der Krieg war immer noch nicht beendet.
In der Zwischenzeit hatte sich nun für uns ergeben, da meine Schmerzen trotz ständiger Massagen nicht abnahmen, wieder nach Hause zu fahren, d.h. meinen Einsatz nach einem halben Jahr, von zwei geplanten Jahren, vorzeitig zu beenden. Die Meinung des Kulturattachés und der Leitung von LIMEX war, die Gesundheit geht vor. Als Termin der Rückreise wurde schließlich der 12. Februar 1980 festgelegt, denn zu diesem Zeitpunkt flog eine Maschine der Interflug zurück nach Berlin und es mussten vier Plätze für uns reserviert werden.
Am vorletzten Tag des Jahres hatten wir endlich unseren Arzt und seine Familie zu Besuch. Er war, neben seiner anstrengenden Tätigkeit, ich schrieb es bereits, auch für unsere Gesundheit zuständig. Wenn man ihn rief, kam er so schnell wie möglich. Ich glaube, bis auf unsere Tochter, waren wir alle bei ihm in Behandlung. Wir standen noch einige Zeit nach unserer Rückkehr in brieflichen Kontakt, er und seine Familie waren später in einem nordafrikanischen Land.
Am letzten vollen Arbeitstag des Jahres, informierte ich vor Beginn der Dozentenbesprechung unseren Dekan darüber, dass das Fach, für das ich eingesetzt war, nun neu besetzt werden muss, da ich aus gesundheitlichen Gründen meinen Aufenthalt in Maputo beenden und mit meiner Familie in den nächsten Wochen die Heimreise antreten werde. Es war mir sehr unangenehm und ich konnte nur hoffen, dass LIMEX bald Ersatz schicken würde.
Über den Jahreswechsel hatten wir das Auto, sodass wir Neujahr mit der Fähre über die Baia de Maputo nach Catembe fuhren. Die Fähre war furchtbar klapprig, verwahrlost und auch schließlich überladen.
Das Deck war überzogen mit einer Schicht von Altöl, d.h. es war wohl eines der wenigen Teile ohne Rost. Wir blickten direkt unter einen sich ständig hin und her schaukelnden LKW, sodass ich dachte, im nächsten Moment wird er sich vollends in Bewegung setzen, alles vor sich herschieben und in das Wasser stürzten. Zu allem Überfluss hatten sich einige Passagiere unter dem LKW einen schattigen Platz gesucht!
Die Autos standen so dicht, dass wir im Gefahrenfall die Türen nicht hätten öffnen können! Schließlich setzte die Fähre sich in Bewegung und strebte dem Ufer von Catembe zu. Langsam entwirrte sich das Knäuel von Menschen und Fahrzeugen, um über die Rampe das feste Ufer zu erreichen.
Die Rampe aber, war so durchlöchert, dass es mir heute noch rätselhaft ist, wie wir trotzdem das Ufer und auf der Rückfahrt die Fähre, erreichten, ohne stecken zu bleiben. Ich hätte mir das vorher doch erst einmal ansehen müssen, ehe ich meine Familie diesem Wagnis aussetzte.
Der wunderschöne Blick von Catembe auf Maputo entschädigte uns aber für die doch recht waghalsige Überfahrt. Leider waren die wohl ehemals wunderschönen Häuser von Catembe in einem sehr verwahrlosten Zustand. Ich war auf jedem Fall sehr froh, als ich meine Familie wieder gut nach Maputo gebracht hatte.
Mit einer Familie, die ebenfalls in zeitlichen Abständen ein Fahrzeug hatte, verabredeten wir, gemeinsam ein Wochenende in Bilene zu verbringen. Dafür mussten wir bei der Botschaft einen Antrag auf Ausstellung vorläufiger Reisedokumente stellen, da ja unsere Reisepässe bei der Botschaft sicherheitshalber deponiert waren!
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“ eines der Leitmotive der DDR uns Bürgern gegenüber.
Einen Tag vor der geplanten Reise, es war ein Freitag, notierte ich in meinem Tagebuch:
»Heute sehr warm 44 °C, Uni. Nach einigen Mühen die Reisepapiere bekommen, Bilenefahrt ist genehmigt.«
Am Sonnabend, nachdem wir uns in der Botschaft persönlich abgemeldet hatten, fuhren wir zwei Familien mit unseren Autos los. Zunächst auf der Fernverkehrsstraße 1. Die ersten 70 Kilometer war die Straße nicht besonders und es herrschte viel Verkehr. Die nächsten 130 Kilometer bis Bilene waren sehr schön zu fahren.
Bilene liegt an eine Lagune, welche von einem Bach gespeist wird und einen Zugang zum Meer hat. Es ist, heute wohl immer noch, ein sehr großer Campingplatz, mit allem was dazu gehört. Stellflächen für Zelte und Wohnwagen, Bungalows, Apartmenthaus, Schwimmbad, Bars, Yachthafen, Badestrand usw. Leider damals alles verwahrlost!
Unser Bungalow hatte zwei Doppelstockbetten, Dusche und Toilette, Kochgelegenheit und Kühlschrank, welche beide leider nicht funktionierten. Alles andere, bis auf die sehr saubere Bettwäsche, war schockierend. Wir hatten alle vier schön gebadet, denn das Wasser und der Strand waren einmalig. Beim Tauchen dachte man, durch ein Aquarium zu schwimmen, alles voll bunter Fische.
Unsere Kinder waren nicht zu bewegen, aus dem Wasser zu kommen. Unsere Tochter tauchte mit anderen Kindern unentwegt, so auch mehrmals unter einem Boot hindurch, welches mit Afrikanerinnen in ihren malerisch bunten Kleidern vollbesetzt war.
Die Damen begannen ein lautes Palaver, weil sie wohl dachten, ihr Boot wird umgekippt, was die kleinen Taucherinnen zu immer neuen Tauchgängen veranlasste, bis wir die Ursache für das nicht zu überhörende Geschrei ermittelt hatten und unsere Kinder zu Disziplin riefen.
Abends genossen wir das wunderbare Bild, was sich uns unter Palmen bei Mondschein am Wasser der Lagune und am Himmel bot. Unser Begleiter war mit dem südlichen Sternenhimmel recht vertraut, sodass wir noch einiges dazu lernten.
In der Nacht gab es ein starkes Tropengewitter. Wir Erwachsenen haben lange wach gelegen, denn immer wieder wurde das innere unseres Bungalows durch die Blitze grell erleuchtet und das daraus entstehende Schattenspiel regte unsere Fantasie an. Auch trug das Wissen, um das durch unseren Bungalow kriechende und fliegende afrikanische Boden- und Boden-Luft-Getier nicht gerade zur Beruhigung unserer Nerven bei. Es entstanden immer wieder neue Figuren in der uns noch nicht vertrauten Umgebung. Endlich verzog sich das Gewitter und ihm folgte eine wohltuende Abkühlung. Unsere Kinder schliefen tief und fest.
Am Sonntag nutzten wir noch einmal die Gelegenheit in dem wunderbaren Wasser der Lagune zu baden, ehe die Rückfahrt angetreten wurde. Diesmal nahm ich doch schon einmal öfter die faszinierende Landschaft Afrikas, durch die wir fuhren, war. An einem Stand am Straßenrand versorgten wir uns mit Ananas und Melonen. Das war ein schönes Wochenende.
In den ersten sechs Wochen des neuen Jahres hatten wir häufig Besuch, so luden wir u.a. zwei Kollegen aus unserer Gruppe, die beide ohne Ehepartnerin in Maputo waren, an einem Sonntag zum Mittagessen ein.
Bei der Familie aus Magdeburg, die nicht zu unserer Gruppe gehörte, konnten wir uns nun dafür revanchieren, dass sie sich in der Anfangszeit um uns gekümmert hatte.
Eines Abends besuchten uns zwei weitere Gruppenmitglieder. Auch ließ es sich nun realisieren, meinen holländischen Kollegen einzuladen. Er hatte einmal geäußert, dass er gerne eine deutsche Familie kennenlernen wollte, da ihm ja durch seine Familie, als Folge des Zweiten Weltkrieges, gewisse Ressentiments gegenüber Deutschen anerzogen worden waren. Ich glaube die Ressentiments konnten wir wohl abbauen. Auch mein Kollege Peter aus der Engenharia Química kam mit seiner Frau zu Besuch.
Unsere Vorräte an Seife, Waschpulver, Zahnpasta usw. fanden glückliche Abnehmer. Zu denen auch meine Physiotherapeutin gehörte, denn als sie uns besuchte, bekam sie für ihre große Familie etwas ab. Letztlich erinnere ich mich noch an ein Ehepaar, er war an der Sektion eins der TH Magdeburg, welches uns zum Abschied besuchte.
Von unserem Arztehepaar und unserer moçambiquanischen Familie Martins und Miséria verabschiedeten wir uns nun endgültig, denn es gab ja wieder viel zu packen und zu organisieren.
Eines sollte ich doch noch erwähnen, es gab unter unserer Gruppe Einen, der, warum auch immer, vielleicht, weil wir keine Genossen waren, uns wiederholt versuchte zu diskreditieren. Heute würde man das wohl Mobbing nennen. So verbreitete er u.a., wir würden unsere Vorräte gegen Dollar verkaufen!
Dies erfuhr ich von einem Herrn, der nicht zu unserer Gruppe gehörte, wie er sich auch Einiges von unseren Vorräten abholte. Leider kann ich ihn nicht mehr persönlich einordnen. Na ja, der Diskrediteur hätte vielleicht seine Vorräte, die er aber wohl nicht hatte, gegen Dollar verkauft, wir jedenfalls nicht! Er war von der Bildungseinrichtung delegiert, an deren Nachfolgeeinrichtung ich nach der Wende zehn Jahre tätig war. Er ist mir dort nie wieder begegnet, wie es schien, hatte man sich von ihm, nach der Wende, getrennt.
Unser wohl letztes, nicht ganz ungefährliches Erlebnis war eine Fahrt an einen nordöstlich von Maputo gelegenen Strand. Es war alles wunderschön. Plötzlich gab es einen Schrei. Bald erfuhren wir den Grund. Ein schwarzafrikanisches Mädchen, etwa im Alter unsere Tochter, hatte sich am rechten Handballen und Unterarm durch eine zerbrochene Flasche schwer verletzt und blutete folglich stark. Die Eltern wussten sich keinen Rat und fragten uns um Hilfe. Nach dem ich die Wunden notdürftig verbunden hatte, brachte ich das Mädchen und ihren Vater, in das mir sehr vertraute Hospital Central.
Ehe ich sie in der Notaufnahme abgeben konnte, verging einige Zeit, sodass es schon dunkel war, bis ich die Rückfahrt antreten konnte. Wie ich mich dem Strandbereich näherte, musste ich zu meinem großen Schreck feststellen, dass ein ganzer Bereich der Straße zum Strand hin durch Polizei abgesperrt war.
Ich konnte nicht darüber nachdenken, was sich wohl ereignet haben mochte. Ich bin nur an diesen Absperrungen vorbeigefahren. Doch endlich sah ich im Scheinwerferlicht Rosemarie mit den Kindern an der Straße stehen, sodass ich sie nicht erst suchen musste.
Uns beiden fiel ein Stein vom Herzen. Sie hatte wohl instinktiv gespürt, dass an dem sonst so ruhigen Strand etwas nicht stimmte und war folglich mit den Kindern zur Straße vorgelaufen. Ich hätte meine Familie nicht allein an dem Strand lassen dürfen, aber das Auto war für drei Erwachsene und zwei größere Mädchen, sowie unseren Jungen, zu klein. Auch habe ich die Dauer der Abwesenheit unterschätzt. Wir waren froh, geholfen zu haben und nun wieder unversehrt vereint zu sein.
Den richtigen Schreck bekam ich zwei Tage später. Ich war wieder zur Massage und die Physiotherapeutin berichtete mir, dass am Sonntag am Strand, in unserer unmittelbaren Nähe, eine Person ermordet worden sei. Der Schreck hat lange angehalten.
Es gab eine Vielzahl von Gängen zur Uni. Von ihr benötigte ich die „guia de marcha“, also die Reisegenehmigung. Vier Tage vor unserem Abflug war sie immer noch nicht vom Rektorat ausgestellt. Wieder wurde ich an einen neuen Bearbeiter verwiesen, der mich auf Sonnabend vertröstete. Montag startete aber das Flugzeug.
Wieder zurück in die Stadt zur Botschaft. Die Antwort auf meine Bitte um Hilfe lautete: „Wir können Ihnen da nicht helfen, das müssen Sie schon mit dem Rektorat selbst klären!“ Auf meine Erwiderung: „Wenn ich bis Sonnabend die guia de marcha nicht bekomme, dann kann ich am Montag nicht ausreisen!“ erhielt ich zur Antwort: „Ja, dann müssen Sie umbuchen und können erst 14 Tage später fliegen, wenn noch Platz in der Maschine ist!“ Also zurück zum Rektorat, mich vor den Schreibtisch des neuen Bearbeiters gesetzt und ihm zu verstehen gegeben, dass ich nicht ehr gehe, bis ich die „guia de marcha“ habe, die ich dann schließlich auch erhielt.
Einiges konnte ich auch ohne die „guia de marcha“ erledigen, so war ich zum Notar, der immer etwas bestätigen musste, zum Kulturministerium, zum Zoll und zu diversen weiteren moçambiquanischen Behörden, letztlich zur Auswanderungsbehörde. Hier bekam ich so genannte „Recibos“, eigentlich Quittungen, die wohl notwendig waren, um Moçambique verlassen zu können.
Aus meinen Notizen entnehme ich, dass wir diese für uns Erwachsene bereits einige Tage hatten, aber für unsere Kinder wurden sie nicht ausgestellt, warum, war unklar. Erst nach dem ich wiederholt in der Auswanderungsbehörde vorstellig geworden war, erhielt ich diese, zwei Tage vor der Ausreise ausgehändigt.
Jeder Antrag musste auf einem behördlichen Papier geschrieben werden und mit einer Behördenmarke „selo“ versehen sein. Letztlich musste ich mir bescheinigen lassen, dass ich mit meiner Frau und unseren beiden Kindern sowie unserem persönlichen Eigentum Moçambique verlassen kann.
Das Ganze hat wohl etwa fünf Wochen gedauert, immer wieder bekam ich zu hören „amanhã“, d.h. ich sollte morgen wiederkommen, aber da saß ich wieder vor dem großen blankpolierten Schreibtisch, auf dem ganz oben in einer Ecke ein Zettelchen von maximal 5 cm im Quadrat lag, auf dem am Vortag von einem würdigen Schwarzafrikaner mein Problem skizziert worden war!
Geschehen war damit offenbar nichts, denn der Herr ließ sich am nächsten Tag wieder alles von mir erzählen und wollte wieder zu solch einem Zettel greifen. Ich zeigte aber in diesem Moment auf das bereits auf dem Schreibtisch liegende Zettelchen, er stutzte, schien mich Weißgesicht nun wohl doch erkannt zu haben und begann das Problem einer Lösung zu zuführen. Letztlich, zwei Tage vor dem Abflug, waren dann doch alle Papiere zusammen.
Eine Woche vor der Abreise leistete ich meinen letzten Nachtdienst in der Botschaft und am letzten Freitag gelang es mir mit Hilfe einer Kollegin und eines Kollegen, zwei in dieser Angelegenheit sehr versierte Mitglieder der Uni-Gruppe, unsere stark lädierten und mit Farbe gekennzeichneten Koffer als Luftfracht erfolgreich durch den Zoll zu bringen. Am Sonntag empfingen wir noch einmal viel Besuch, der das Bedürfnis hatte, sich von uns zu verabschieden.
Am 11. Februar 1980 war dann ein Viertel nach Vier unsere letzte Nacht in Afrika beendet. Eine halbe bzw. eine Stunde später wurden unsere Tochter bzw. unser Sohn geweckt, anschließend frühstückten wir.
Um 6 Uhr brachte mich eine in Sachen Ausreise versierte Vertreterin der Gruppe und die Koffer zum Flughafen. Der Zoll durchsuchte jeden Koffer, beanstandete aber nichts. Das Kofferwiegen dauerte sehr lange, warum? Wir sollten es zu Hause beim Auspacken erfahren, es fehlten einige elektrische Geräte! Wir hätten, wie wir später erfuhren, die Koffer wie ein Paket verschnüren sollen, sodass das Öffnen schwieriger gewesen wäre, na ja, wir konnten es verschmerzen.
Gegen 6: 30 wurden Rosemarie und die Kinder zur Fahrt zum Flughafen abgeholt. Nun sollte es in den Transitraum gehen. Zunächst wollte man wieder „selos“ für die „guia de marcha“ und dann kam es! Wie anfangs berichtet, hatten wir bei der Einreise verabsäumt, dass in den Reisepass unserer Tochter die Einreise durch einen Stempel bestätigt wurde. Der aufmerksame Beamte hinter seinem Schalter konnte somit natürlich diesen Stempel auch nicht finden und ließ unsere Tochter nicht passieren! Was nun, alles Reden und Diskutieren half nichts, sie kam nicht durch die Kontrolle.
In meiner Not, dachte ich mir, wenn ich mich ganz breit vor das schmale Schalterfenster stelle, dann kann der hinter dem Fenster Sitzende nicht sehen, was vor dem Schalter passiert. Kurz Rosemarie von meinem Plan informiert, dass sie mit beiden Kindern hinter meinem Rücken in den Transitraum flüchtet, was dann auch geklappt hat, dann drängten sich schon die nächsten Reisenden an den Schalter und ich war, im wahrsten Sinne, weg vom Fenster! Ganz wohl war uns nicht, aber das waren wir ja in den letzten Monaten gewöhnt.
Nach ihrem Reisepass war unsere Tochter somit niemals in Moçambique gewesen. Beim Eintritt in den Transitraum erfolgte die Zollkontrolle ohne Probleme, nur ich musste eine recht ausführliche Leibesvisitation über mich ergehen lassen. Um 9: 35 wurden wir schließlich zum Flugzeug, eine IL62 der Interflug, gebracht. Die Kabine kam uns zunächst sehr kalt vor, denn sie war auf 20 °C heruntergekühlt worden! Wir atmeten erst einmal tief durch, wie die Kabinentüren geschlossen wurden. Aber die Maschine rollte nicht an! Nach geraumer Zeit wurde eine Ladeluke wieder geöffnet, um etwas auszuladen. Endlich um 10: 05 starte die Maschine. Es waren gute Sichtverhältnisse, wir flogen in 11.000 Meter Höhe mit einer Geschwindigkeit von 850 Kilometer pro Stunde. Nach ca. zwei Stunden überflogen wir Lusaka und nahmen Kurs auf Angola. Nach vier Stunden Flugzeit begann der Landeanflug auf Luanda, der Hauptstadt von Angola, wo wir um 14: 15 landeten.
Beim Ausrollen hatte man das Gefühl, wenn die Maschine jetzt nicht zum Stehen kommt, dann stehen wir nicht auf dem Rollfeld, sondern landen im Ozean. Es ging aber alles gut, denn die Maschine wurde rechtzeitig abgebremst! Der Luanda Airport empfing uns mit 30 °C, schwül und nicht sehr sauber. Nach etwas mehr als eindreiviertel Stunden erfolgte der Start und der Flug führte entlang der westafrikanischen Küste, bis wir um 18: 35 in Lagos landeten. Dieser Flughafen beeindruckte uns sehr, denn in Maputo und Luanda waren wir mit unserem Flugzeug ziemlich allein, aber in Lagos war unsere Maschine eine von sehr vielen. Wie wir zum Terminal rollten, landete schon die nächste Maschine usw. Hier waren es nur 23 °C. Der Transitraum war schon wesentlich besser eingerichtet und gepflegt, als wir es von Lissabon und Luanda kannten.
Wenn wir das, was wir in den nächsten Jahren erleben sollten, vorausgeahnt hätten, wäre es sicher angebracht gewesen, den Transitraum nicht in Richtung Interflug-Maschine, sondern in die Freiheit zu verlassen, uns wäre viel erspart worden. Auch wäre wohl unser Start in der Bundesrepublik einfacher verlaufen, denn ich war vierzig und nicht, wie bei der Übersiedlung in die Bundesrepublik, fünfzig Jahre alt. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wie wir vom Transitraum durch den Gang zur Abfertigung gehen. Warum haben wir uns nur so entschieden?
In Lagos wurde die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Um 19: 10 startet die Maschine, flog quer über den schwarzen Kontinent, im wahrsten Sinne des Wortes. Erst wie wir das europäische Festland erreichten, d.h. Italien überflogen, sahen wir unter uns ein Lichtermeer. Nun ging alles doch recht schnell, denn gegen 2 Uhr des 12. Februar 1980 landeten wir in Berlin-Schönefeld. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem wir vor 144 Tagen in die Ungewissheit gestartet waren.
Ohne Zollkontrolle erhielten wir um 3 Uhr unsere Koffer. Empfangen wurden wir von meiner Mutter und dem Fahrer, der uns wieder nach Hause bringen sollte. Schließlich kamen noch Rosemaries Schwester mit ihrem Vater. Er weinte, wie er uns in unserem abgemagerten Zustand sah. Gegen 4 Uhr starteten wir im schön geheizten Auto und waren gegen 6 Uhr wieder zu Hause. Rosemaries Mutter hatte alles bestens für unsere Ankunft vorbereitet.
Nach dem ich für dieses Kapitel Rosemaries Briefe, meine Aufzeichnungen und meine Erinnerungen verarbeitet habe, ist mir bewusst geworden, dass das ganze Gerede über die Sorgepflicht „des Arbeiter- und Bauern-Staates“ für seine Bürger während der Aussprachen über unseren Ausreiseantrag ein Hohn war, zu dem was wir in Maputo erlebt hatten.
Ich glaube heute, unsere Ausreisezeit begann nicht erst im Juni 1984 mit der Antragstellung, sondern im Herbst/Winter 1979/1980 in Moçambique. Es war ein langer Prozess des Loslassens, einfacher hätten wir es gehabt, wie oben bereits beschrieben, wenn wir in Lissabon oder spätestens in Lagos nicht wieder in das Flugzeug gestiegen wären!
Meine Rückmeldung in Berlin war mit einer Überraschung verbunden, denn mir wurde sofort ein erneuter Auslandsaufenthalt, und zwar auf Madagaskar, angeboten! Dieses Angebot habe ich aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt. Auf meinen Hinweis, dass der vorzeitige Abbruch meines Einsatzes sicher nicht gut war, erhielt ich zur Antwort: „Es wird gezählt wie viele Kader wir entsandt haben, nicht wann sie zurückkommen!“
Die Monate in Moçambique haben uns klargemacht, dass man sich politisch und moralisch aufgeben muss, wenn man die DDR im so genannten kapitalistischen Ausland vertritt, das konnten und wollten wir nicht.
Nur noch folgender Ausspruch des damaligen Sektionsdirektors: „Koll. Dr. Bode, Sie haben sich bei ihrem Einsatz in Moçambique vor den Schützengräben des Klassenkampfes so bewährt, dass ich Sie gerne als Kandidat für die Partei vorschlagen würde!“ Ich habe davon keinen Gebrauch gemacht!
Meine Behandlungen begannen sehr schnell, wofür meine Schwiegermutter, sie war Krankenschwester, gesorgt hatte und zogen sich über eine lange Zeit hin.
71 Der Barkas B 1000 war ein Kleintransporter von einer Tonne Ladekapazität und mit einem Zweitaktmotor ausgestattet. Er wurde in den Jahren 1961 – 1990 im VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt hergestellt.
72 Außenhandelsunternehmen der ehemaligen DDR
73 Airline von Moçambique (seit 1980 LAM)
74 Bidet
75 Mit »wir« meint sie unsere Tochter Constance
76 Schlange
77 Gemeint sind die Leute der Unigruppe aus der DDR.
78 Frente de Libertação de Moçambique, deutsch: Moçambiquanische Befreiungsfront.