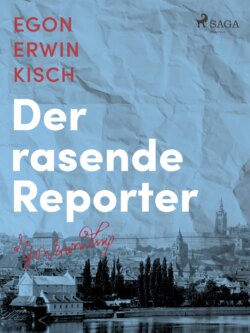Читать книгу Der rasende Reporter - Egon Erwin Kisch - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. DIE FAHRT AUF DEN KANÄLEN
Оглавление16. Okt. 1920.
Seit einer Woche fahren wir unaufhörlich westwärts.
Vor uns Horizont oder eine Biegung des Kanals oder eine Brücke oder ein Schleusentor.
Rechts ein Damm, links ein Damm — ein ew’ges Parallelogramm. In dessen Mitte wir sind.
Ist eine Drehbrücke in Sicht, unter der wir auch mit geneigtem Kamin nicht durchfahren können, oder eine Schleuse, dann ziehen wir die Dampfpfeife: „Ein großer Kahn ist im Begriffe, auf dem Kanale hier zu sein!“ (Man entschuldige das jämmerliche Deutsch dieses Satzes; der ist von Goethe.)
Das Wasser ist ruhig, wie der Teich eines fürstlichen Parkes. Wenn der Damm aus Stein ist, so weiden oben Ziegen, ist er sanft abfallendes, grasbewachsenes Erdreich, so kommen auch Kühe bis an den untersten Rand und spiegeln sich im Kanal. Pufft unsere Luftpumpe zufällig gerade Dampf aus — die Luftpumpe des „A. Lanna 6“, nebbich! — so jagen die blöden Kühe in äußerst komischen Sprüngen erschrocken davon.
Manchmal nennt sich das Parallelogramm, in dem wir uns befinden, zwei Tage lang: „Ems-Jade-Kanal“. Nachdem wir uns aber siebzig Kilometer lang an diesen Namen gewöhnt haben, führt es wieder wochenlang den Namen „Dortmund-Ems-Kanal“, und von übermorgen an, hinter Münster, ist es als „Rhein-Herne-Kanal“ zu signieren. Bald heißt das Land zu beiden Seiten „Ostfriesland“, bald wieder „Oldenburg“, dann heißt rechts „Holland“ und links „Hannover“, und dann wieder „Westfalen“ und dann „Rheinprovinz“. Aber es ist eigentlich immer dasselbe. Nur die holländische Landschaft ist von entschieden freundlicher Valuta.
In meiner Brieftasche habe ich schon dreißigerlei Notgeld. Nur holländisches nicht.
Manchmal heben uns die Schleusen in die Höhe, manchmal senken sie uns. Manchmal müssen wir bloß eine Viertelstunde in diesem flüssigen Lift bleiben, aber manchmal, ja, manchmal eine halbe Stunde. Hinter Bevergern mündet der Mittellandkanal, der von Berlin kommt, in unsern, und dann geht es ein Stückchen entlang des Teutoburger Waldes.
Manchmal fragt uns der Schleusenwärter, was denn das für eine Fahne sei, die rot-blau-weiße? Aber es gibt wieder Schleusenwärter — so verschieden ist nun mal die Menschheit! — die schauen die Flagge an und fragen, aus welchem Lande wir kommen.
So jagt eine Sensation die andere. Man kommt gar nicht zu Atem!
Überall wird hier Torf geschürft. Wenn einen der Leute bei der Arbeit unversehens der Schlag trifft, so sinkt er ins Moor und bleibt uns mumifiziert erhalten. Eine solche Frau, zweitausend Jahre alt und ganz aus Torf, ist in Emden zu schauen. Im Museum für Kunst und Gewerbe. Hätte sich’s jene Frau vor zweitausend Jahren gedacht, daß sie etwas mit den Museen zu tun haben werde, mit der Kunst oder mit dem Gewerbe?
Übrigens ist Emden eine sehr liebe Stadt — sicherlich weitaus die netteste, die wir auf dem Ems-Jade-Kanal durchgenommen haben. Sie hat wahrscheinlich nach dem bekannten Kriegsschiff „Emden“ ihren Namen. Wie sie früher hieß, weiß ich nicht. Aber jedenfalls muß sie schon früher dagewesen sein und einen Namen gehabt haben. Denn sie hat einen „Fußballklub von 1902“. Die Leute haben hier eine Vorliebe für die Niederlande, was sich darin ausdrückt, daß sie zumeist holländische Namen haben: „Hinrich van Tjater“, „ter Bjöch“, und so; sogar „Ihlsen“ steht auf einer Firmentafel, — bekanntlich der feinste Name Skandinaviens, der Name, mit welchem Redakteur Lynge in Kristiania für seine Zeitung krebsen geht.
Ad vocem: Zeitung. Was ist denn los in der Welt? Zeitungen haben wir schon lange nicht mehr gelesen. Man legt abends vor irgendeiner Brücke an oder auf offener Strecke. Weit und breit kein Haus, nicht einmal eine der verfallenen Windmühlen, die noch immer klappern, weil sie nicht leben und nicht sterben können. Sie klappern sogar noch lauter als die, die in Betrieb sind. Landen wir in einer Stadt, wie z. B. in Aurich, so haben wir nur soviel Zeit, ein Telegramm an die Firma in Prag aufzugeben, daß „A. Lanna 6“ hier eingetroffen, an Bord alles wohl. Zuweilen können wir uns einen geräucherten Aal und Batscharizigaretten zu 50 Pfennig das Stück kaufen und nach Brot fragen. Aber wir kriegen keines, weil wir keine Brotmarken haben.
In Düthe, d. h. bei Düthe, wo wir eben angelegt haben, gibt’s überhaupt außer einem Briefkasten kein öffentliches Gebäude. Nicht einmal ein Geschäft, nicht einmal ein Wirtshaus. Ein Zeitungsblatt war nicht zu haben, nicht einmal ein ganz altes. (Und ich hätt’s doch so gebraucht!)
Zu Dykhausen, hinter Wilhelmshaven, wo wir Kessel und Pumpen vom Meerwasser und seinen Rückständen zu befreien und Süßwasser zu nehmen hatten, war auch ein Gasthaus vorhanden, und zwei Zeitungen lagen auf dem Tisch: „Anzeiger für Harlingerland“, amtliche Zeitung für den Kreis Wittmund, und „Der Gemeinnützige“, fortschrittliches Tageblatt für Oldenburg und Ostfriesen, 113. Jahrgang, in Varel erscheinend. Das Blatt ist entschieden schwer zu lesen, wenigstens für Zugereiste. An der Spitze der Tagesnachrichtenrubrik stand in fetten Lettern die große Sensationsnachricht von Oldenburg und Ostfriesland:
125 Enter waren gestern in Varel
zum Verkauf aufgeführt.
Nicht minder wichtig scheint die Meldung zu sein, daß beim Klootschießen und Bosseln des Vereins „Lat’n susen“ in Brockhorn der Bredemann Klaas den Best für einen Wurf von 80,10 Meter errang. — Übrigens ist Dykhausen kein gewöhnliches Dorf: es hat auch eine Deckstation. Die beiden Hengste heißen „Exzellenz II.“ und „Eduard“. In jedem Bauernhaus, in dem ich schüchtern anfragte, ob ich ein paar Eier bekommen hönnte, hängen die Photographien von „Exzellenz II.“ und „Eduard“ eingerahmt an der Wand. In der Wirtsstube wird das Porträt Hindenburgs von denen der beiden Hengste flankiert. Gegenüber ist das Wappen Frieslands mit dem Spruch: „Eyala freya fresena!“ (Willkommen, freies Friesenland), rechts davon der Stammbaum von „Eduard“, links der Stammbaum von „Exzellenz II.“.
In Emden meldeten wir uns in der Bunkerzentrale Am Ratsdelft, um Kohle zu nehmen. Dort sagte man uns, daß deutsche Schiffe 380 Mark für die Tonne zu zahlen haben, ausländische aber 94 Gulden — holländische Gulden nämlich. Das war uns zuviel, und wir mußten uns entschließen, schleichzuhandeln. Von einem Bagger, der die beim Löschen und Bunkern an Kohlenplätzen ins Meer gefallenen Kohlen gefördert hatte, kauften wir unter der Hand eine Tonne um 190 Mark. Aber es war kein gutes Geschäft. Die Kohle war ausgewässert, machte viel Schlacke, der Rost unserer Kessel ist ohnedies für Steinkohle nicht eingerichtet, und der alte Struha hatte viel Plage.
Den ganzen Tag schaufelte und kratzte er im Maschinenraum unten, und wenn er heraufkam, setzte er sich auf einen umgestülpten Kübel und starrte vor sich hin. Ich habe den alten Struha im Verdacht, daß er ein Philosoph ist.
Wenn man ihn z. B. auf einen Riesenkran aufmerksam macht oder auf einen der Bagger, die das Wasser in einem ungeheuren, ununterbrochenen schwarzen Wasserfall über Deck schwemmen, äußert er phlegmatisch: „Das ist alles ein Scheißdreck im Vergleich zur Allmacht Gottes.“
Von mir pflegt er zu sagen: „Der ist wie ein Greißler — wenn er aufs Schiff kommt, so sitzt er schon auf seinen vier Buchstaben.“ Ich habe mir dieses Bild erklären lassen und erfahren, daß sich eben ein „hokynar“, wenn er auf eines der Passagierdampferchen der Moldau kommt, nicht erst nach einem freien Sitzplatz umschauen muß: er stellt seinen Rückenkorb nieder und setzt sich darauf.
Der alte Struha spricht wenig, nur mit dem Kessel hört man ihn manchmal zanken, aber alles, was er spricht, ist voll solcher Beobachtungen und Vergleiche.
Er wohnt vorne in der Kajüte mit dem Kapitän. Achter, in der Kombüse von zwei Meter im Quadrat, leben der Lotse, der Bootsmann Franta Cihlarik und ich. Bis Wilhelmshaven haben die Lotsen an Land geschlafen, und ich hatte Schlafraum in einer der beiden Kojen, die so niedrig in die Wand geschnitten sind, daß ich nicht einmal die Nase rümpfen dürfte, ohne sie an den „Plafond“ anzustoßen. Ich mußte mich also vor jeder derartigen Emotion hüten ... Ein Sarg war ein Dom dagegen! Seitdem wir aber den Dollart-Meerbusen passiert haben und immerfort nur durch den Kanal dampfen und nicht bei Städten nächtigen können, sondern dort, wo uns die polizeiliche Sperrstunde der Schleusen eben überrascht, seither schlafe ich — noch ärger. Auf dem Fußboden der Kombüse nämlich, weil der Flußlotse gekommen ist, der von Wilhelmshaven bis Preßburg 8000 Mark kriegt und Anrecht auf eine Koje hat. Also bin ich sozusagen aufs Pflaster geworfen, auf den Fußboden. Morgens schmerzt mich dann das Rückgrat so, daß ich glaube, gar nicht aufstehen zu können. Aber wenn unter mir die Schraube zu rattern beginnt, muß ich entsetzt aufspringen. Dann koche ich Kaffee. Das ist die einzige häusliche Tätigkeit, zu der mich Franta noch zuläßt. Nur einmal hat er mich auch die Suppe kochen lassen, doch das wird ihm, wie er ehrenwörtlich versichert, bis zu seinem Tode leid tun.
Der Franta hat überhaupt ein Kreuz mit mir. Zu seinen Obliegenheiten gehört es unter anderm, Deck und Wohnräume reinzuhalten. Es fällt mir jedoch schwer, meine Schlafstelle, meinen Manuskriptenschrank, meinen Schreibtisch, mein Badezimmer und dergleichen in der zwei Quadratmeter großen Kombüse so zu verstecken, daß es die gewohnte Ordnung nicht stört.
Auf den Kanälen hat Franta viel zu tun. Ununterbrochen kommen Brücken in Sicht, dann hat er zu schätzen, ob wir unter dem Brückenbogen durchfahren können oder das Signal zum Aufziehen, Drehen oder Auseinanderschieben der Brücke geben müssen. Können wir durchfahren, so stellt er sich auf den Maschinenaufbau und zerrt den Schlot des Schiffes herab. Mindestens vierhundert Brücken sind wir auf der Kanalfahrt begegnet, und vor jeder hat er den schwarzen Zylinder tief gezogen.
Fährt uns ein Dampfer entgegen, so läuft er, den Freihalter, den umflochtenen Korkballen, wie ein Lasso in der Hand, um ihn dort dazwischenzuwerfen, wo ein Anprall zu befürchten steht. Legen wir an, springt er in weitem Bogen ans Land und rammt die Eisenpflöcke in den Boden und schlingt das Tau um sie und die Belegspöller, die stählernen Spulen, die auf Deck geschmiedet sind. Stößt er mit den spitzigen Stangen vom Ufer oder vom Kanalrand ab, oder eine schwimmende Schilfinsel aus unserem Wege, und ich rufe ihm zu: „Franto, píchej vodu!“ so wird er wütend und erklärt mir, er sei kein Flößer, steche also kein Wasser.
Der Bootsmann hat einen Wochenlohn von 240 Kronen und während der Prag—Preßburger Weltumsegelung freie Verpflegung, sowie für jede Überstunde, welche außerhalb der achtstündigen, wöchentlich 48 Stunden betragenden Arbeitszeit geleistet wird, 7 Kronen 50 Heller; der Kapitän und der Maschinist bekommen 264 Kronen pro Woche und 8 Kronen 25 Heller per Überstunde. Am Sonntag werden die Überstunden doppelt bezahlt.
Unser Kapitän hat hellblaue Augen, hellbraunes Gesicht, hellblonde Haare und hellklingendes Lachen. Er lacht beständig und steht den ganzen Tag am Steuer, nur wenn der Lotse oben ist, sitzt er in der Kajüte und schreibt den Rapport, und am Abend kümmert er sich darum, wo wir Kohle kriegen könnten; und wenn man unverschämte Preise nennt, so lacht er sich schief darüber, weil es uns ja gar nicht einfällt, soviel zu bezahlen!
Wenn ich oben auf dem Kapitänsstand stehe, so erzähle ich ihm Witze, daß er Tränen lacht, auch wenn das Ausweichen im Kanal noch so schwierig ist und gerade ein plumper Kartoffelschleppzug uns entgegenkommt. Die Situation ist ernst, aber meine Witze sind eben so gut, daß er wohl oder übel lachen muß. Das begreife und billige ich. Aber von der Drehbrücke bei Lingen rief uns der Brückner „2 Mark 30 Pfennig“ zu, und streckte uns auf einer 5 Meter langen Stange einen Klingelbeutel zu, in dem schon die unterschriebene Quittung lag, die wir herauszunehmen und dafür 2 Mark 30 Pfennig hineinzulegen hatten, ohne auch nur eine Sekunde zu stoppen. Und über diesen Klingelbeutel lacht Kapitän Jirsch noch mehr als über meine Witze. Das finde ich unbegreiflich!
Ein Spalier riesiger Betriebe und Speicher flankiert beinahe seit Münster unsern Weg bis in das Industriereich der Ruhr. Schon dort begann die Welt der Schwerindustrie: das Pumpwerk an der Lippe, die Überbrückungen (auf Brückenkanälen fuhren wir 20 Meter hoch über Flüssen), das Kanaltor der nach Dortmund führenden Abzweigungen bei Henrichendorf und das kolossale Schiffshebewerk ebendort sind Weltwunder. Bei Schleuse 7 von Herne hatten wir die Scheitelhöhe des Kanals erreicht, wir wurden nun nicht mehr gehoben, sondern auf der kurzen Strecke von 42 Kilometer, die wir bis Ruhrort zurückgelegt haben, um 42 Meter gesenkt. Auf sechsgleisigen Brücken donnerten Eisenbahnzüge oberhalb unserer Köpfe, 60 Meter über uns, so daß Franta Cihlarik unser zwei Meter hohes Kaminchen eigentlich nicht hätte ducken müssen. Er tat es aber doch: „Nech’ me, ich bin’s schon so gewohnt, unter einer Brücke den Schlot einzuziehen!“ Elektromobile auf Schienen ziehen die Schleppzüge, oft sechs Zillen von je 1000 Tonnen Erz oder Steinkohle, in und aus den Kammern. Auf Fördertürmen der Zechen, auf Kranen von 40 000 Kilogramm Tragkraft (4000 Kilogramm hat der größte Kran im Holleschowitzer Hafen) und dreißig Meter Spannweite, auf Kandelabern und Petroleumreservoiren und Essen und Schloten ruht der rußige Himmel wie ein schwarzer Baldachin. Bergehoch über dem Schiffchen kreuzen sich auf einer Seilbahn hinter Herne Kohlenwaggons, entlang des Kanals fahrend; dort wo das Drahtseil über den Kanal führt, ist unter die Waggons ein Schutznetz gespannt. (Unerhörte Filmmöglichkeiten: Versteck des Verbrechers im Greifer eines Krans, er wird in den Bunker einer Seilbahn entladen, man bemerkt und verfolgt ihn im nächsten Seilwagen, Sprung auf das Schutznetz usw.)