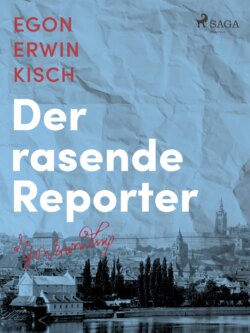Читать книгу Der rasende Reporter - Egon Erwin Kisch - Страница 9
II. DER MOLDAUDAMPFER IM SEESTURM DES WATTENMEERES
ОглавлениеAn Bord „A. Lanna 6“, Ems-Jade-Kanal, am 8. Oktober 1920.
Schon am Abend der Ankunft in Cuxhaven war der Lotse, den wir in Hamburg für die Fahrt übers Meer geheuert hatten, an Land gegangen und gleich darauf an Bord zurückgekehrt: er habe eben aus Hamburg die telegraphische Nachricht bekommen, sein Schwiegervater sei gestorben. Hoffentlich finde er einen Kollegen, der uns von der Elbmündung über das Meer führen werde.
Als wir morgens aus den allzu eng in die Wand geschnittenen Kojen des „A. Lanna 6“ krallten, brachte er den Kollegen und empfahl sich von uns: „zum Begräbnis des Schwiegervaters“. Dem Stellvertreter hatte er allerdings dieses Märchen nicht aufgebunden, sondern ihm aufrichtig gesagt, er traue sich nicht mit unserem Süßwasserkasten über eine bewegte See. Weniger ehrlich war er in seiner Auskunft über den Führerlohn gewesen; nach langem Zögern hatte er für die Stellvertretung 400 Mark bewilligt und hinzugefügt, jetzt bleibe ihm nichts mehr als das Reisegeld für die Rückfahrt nach Hamburg. (Wir erfuhren dies freilich erst auf hoher See von dem Ersatzmann, der nicht wenig ungehalten darüber war, nun von uns zu hören, daß sein Kollege morgen in Hamburg für die Führung 1300 Mark einstreichen wird.)
Unser neuer Lotse, ein Krabbenfischer, kennt sich auf dem Wattenmeer so genau aus wie in den Taschen seiner trangetränkten Hose, — jedoch kann er nicht in diese Taschen, da seine Wasserstiefel bis zum Schritt reichen. Auch er besieht unsern Maschinenraum nicht besorgnislos, denn einen Dampfer ohne Süßwasserreservoir und ohne Destillator für Salzwasser hat er wohl noch nie in seinem langen Seeleben gesehen. Mit dieser Nußschale soll man über den Ozean? Er lugt auf Ventilator und Glasständer, klopft Röhren und Kondensator ab; auf unserer Fahrt durch das Brackwasser hat sich noch nicht viel Salz angesetzt, und unsere Kessel könnten auch drei Tage durch Salz aushalten, entscheidet er. Die Trossen, mit denen Kamin und Rettungsboot festgemacht sind, prüft er nochmals.
Um neun Uhr morgens (7. Oktober) stach Th. M. S. „Lanna 6“ in See, die „Alte Liebe“, den Molokopf von Cuxhaven, rundend. Fort Kugelbake, sozusagen der Grenzstein zwischen Elbe und Weltmeer, liegt erst vor uns, aber wir spüren das Jenseits schon jetzt. Luft ist wie Meer: salzig und naß. — Und der Wind läßt uns taumeln. — Der alte Maschinist Struha, seit sechzehn Jahren haust er da unten im Kesselraum von „A. Lanna 6“, hat kein Vertrauen zu dem flüssigen Salz, das auch den Speiseröhren seines Kessels gar nicht schmecken will. Podskal hat keinen Molo, und Pelc-Tirolka keinen Leuchtturm, — hier aber steckt alles voll von solchen Kinkerlitzchen (sracicky), und Kompaß und Riesenseekarte sind auch nicht dazu angetan, beruhigend zu stimmen: Wie soll man sich auf dem Wasser auskennen, wo keine bekannten Ufer, ja, überhaupt keine Ufer, und keine bekannten Gasthäuser, ja überhaupt keine Wirtshäuser sind? Beim Wenza Kucera im Hafenwirtshaus in Holleschowitz wäre uns allen wohler, obwohl der ein alter Grobian ist.
„Wenn’s sakramentisch wird“, so macht der alte Struha sein Testament, „wenn’s sakramentisch wird, dann verkriech’ ich mich im Maschinenraum, daß es mich nicht hinauswerfen kann ...“
Der Kommandatore von „A. Lanna 6“, Herr Jirsch, war Zugführer bei den Pionieren und hat die Tagliamento-Mündung befahren, und der Bootsmann, der Franta Cihlarik, ist sehr stolz auf seine Karriere bei der k. u. k. Kriegsmarine: „Já byl Bootsmannsmaat - Torpedoinspektor, pane!“
An „Elbe V“ kommen wir vorüber, dem ersten der fünf Leuchtschiffe, die die Hafenausfahrt flankieren; die Bemannung dieser Signalschiffe ist sechs Wochen an Bord, dann vierzehn Tage auf Urlaub an Land, jahraus, jahrein. Ein Motorboot jagt hinter uns her und preit uns an: „Reichswasserschutz! Halt!“ Die Polizisten springen auf Deck und lassen sich unsere Papiere vorweisen; es ergibt sich, daß wir keine Schieber sind, die unter fremder Flagge ein deutsches Schiff ins Ausland verschachern wollen, wir haben bloß in Unkenntnis der Verhältnisse es unterlassen, das Duplikat der Ausfahrtsbewilligung, vom Reichsverkehrsministerium (Schiffahrtsabteilung) ausgestellt, abzugeben.
Gut brennt die Sonne, aber die Luft ist mistig. Rechts ist ein Leuchtturm zu sehen, es scheint, als rage er direkt aus dem Wasser. Jedoch er steht auf einer Insel, zu der man bei Ebbe vom Festland aus im Wagen fahren kann: Insel Neuwerk, Schlupfwinkel und Flottenstützpunkt Klaus Störtebekers, des heiligen Seeräubers und Feindes der Hansaschieber. Jedes Watt, jedes Tief, jedes Riff birgt hier die Erinnerung an ihn und seine Taten. Von Duhnen aus hatte Klaus Störtebeker einen unterirdischen Gang angelegt bis in seine Feste Rützebüttel, die wir gestern in Cuxhaven sahen. Die heutigen Bewohner Neuwerks, fünf Bauern, ein Schullehrer und zwei Leuchtturmwächter, so erzählt unser Lotse, fühlen sich als Störtebekers Erben: sie räubern, was das Zeug hält, stecken Massen von Strandgut ein (überall sehen wir Wracks, und wenn uns nicht ohnehin schon übel zu Mute wäre, diese Mementa mori könnten uns das Gruseln lehren!) und scheren sich den Teufel um die Obrigkeit. Die Bauern sind allesamt schwere Millionäre, zwei oder drei sind auch adelig; das Hotel „Zur Meereswoge“ hat saftige Preise, die Schule wird von neun Kindern besucht. Die gesamte männliche Bevölkerung von Neuwerk, der Schulmeister einbegriffen, bildet die Bemannung des Rettungsbootes. Bei den Signalraketen bleiben nur die Frauen.
Vor Hunde-Balje, elf Uhr vormittags, ist ein Seehundfischer verankert; bereits vorher haben wir etliche Seehunde auftauchen und die neue Flagge anglotzen sehen. Scharf dreht der Wind nach Süd. Er reißt rücksichtslos unser Schraubendampferchen herum. Der Wind schaukelt, und das Wasser schaukelt, — wie wir schaukeln, mag man sich denken! Hochauf schlagen Wellen, sie geißeln Deck und Deckaufbau; bevor wir die Kajütenluken geschlossen haben, ist schönste Überschwemmung darin, und sogar in das Kaminloch springt eine Woge.
Der Kamin! Er ist lebensüberdrüssig. Bald neigt er sich steuerbords, bald will er sich auf der linken Seite in die feindliche Flüssigkeit schmeißen. Die Trossen zerren ihn, reißen ihn zurück, und stöhnen ob der Anstrengung.
Schwer balanciert man auf Deck. Backbords sieht man auf dem Watt von Scharhörn Menschen sich placken; sie bergen Balken. Vor drei Wochen ist hier ein Floß im Werte von 40 000 000 Mark gestrandet, das größte Floß der Welt. Von Schweden her kam es, von vier Schleppern gezogen über das Wattenmeer, und wollte nach Amsterdam; 13 500 Baumstämme, manche 15 Meter lang, in einer Breite von 16 Metern nebeneinander und in einer Höhe von 6 Metern übereinander geschichtet, von Ketten zusammengehalten. In Splitter aber rissen die Wellen diese Stahlketten. 3000 Balken wurden in Cuxhaven ans Land geschwemmt, 3000 auf die Insel Neuwerk, 5500 hierher nach Scharhörn. Jeder Balken war auf 160 Mark versichert, und wer der Assekuranzgesellschaft in Cuxhaven einen der Stämme liefert, erhält 100 Mark. Wir sehen die Armen von Cuxhaven sich mühen, die Stämme gegen die See zu rollen. Kommt unversehens die Flut, können die Leute nicht mehr vom Meere zurück, sind verloren ... Unser Lotse spuckt seine Prieme weit über Bord: „Böse Arbeit das!“
Wird es uns wie dem Floß ergehen? Der Magen nickt Bejahung... Das Wasser wascht unsere Kleider und das Deck wieder rein und spült unsere Gesichter ab, — Dankbar werfen wir unsere Galle in die See.
„A. Lanna 6“ fährt mit Volldampf voraus. Mühselig ist das Vorwärtskommen, schwieriger als bei Klecan und Kralup. Früher machten wir sieben Meilen die Stunde. Jetzt stemmt sich uns der Wind entgegen.
Zwischen Scharhörn-Riff und „Elbe I“, dem letzten der fünf Leuchtschiffe an der Elbeausfahrt, sind wir um 4 Uhr 20 Minuten nachmittags, und schon wenden wir backbord, nehmen westlichen Kurs gegen den Leuchtturm „Roter Sand“, das am schwersten erbaute Merkzeichen der Wesereinfahrt. Auch am Leuchtschiff der Wesereinfahrt müssen wir vorbei, obwohl wir nicht nach Bremerhaven wollen, sondern gleich hinüber in den Jadebusen. In Wilhelmshaven, an der Mündung der Jade, wollen wir heute noch landen.
Wird es glücken? Immer dunkler tönen sich die unendlichen Flächen über uns und unter uns. Wellen und Wolken sind eins. Sterne und Leuchtfeuer sind eins. Wir sind auf gleicher Höhe mit den Nordseeinseln, aber nicht einmal Wangeroog, die östlichste (geschweige denn Norderney!), ist sichtbar. Ostfrieslands Küste erkennen wir erst, da wir auf drei Seemeilen an sie herangerückt sind. Unser Kamin qualmt, die Schraube arbeitet, trotzdem auf dem Ventilator des Kessels und auf den Saugpumpen sehr starke Salzstalaktiten von fünfzehn Zentimeter Länge wachsen, die Kolben schlagen auf und nieder, aber es scheint, als ob wir stehen.
Da, bei Minsener Sand, kommt das Glück, „ergriff mich die Flut und riß mich nach oben“. Ergriff uns die Flut, rasch schwemmt sie uns in den Jadebusen, fast bis in den Hafen, fast bis an den Kai. Kreidebleich stehen wir auf Deck, 51 Seemeilen auf einem Moldauschiffchen, in stürmischer See, — c’est trop. Ach, armer „A. Lanna 6“, Don Quichotte des Wassers, du siehst ramponiert aus! Morgen heißt es, alles Seewasser auspumpen, die Salzkristalle abschlagen, die Rohre reinigen und Süßwasser nehmen.
Rings um uns der riesige Kriegshafen, Wilhelmshaven. Jung ist das Gesicht dieser Stadt, riesig ihre Figur, aber scharf tritt ihr hippokratischer Zug hervor. Gesprengte Schiffe, ein versenkter Hulk, auf dem deutsche Modelle waren, ablieferungsbereite, zum Transport zurechtgemachte Docks, verödete Bassins. Die Stadt stirbt.
Von unseren neuartigen Wimpeln angelockt, kommen friesische Schulknaben zu unserem Schiff, um Briefmarken zu erbetteln. Sie wollen wissen, woher wir kommen. Der alte Struha ist aber nicht zu Auskünften aufgelegt:
„Reknou tem parchentum, ze jsme z Maniny, aby to vedeli! “
So sage ich den Kindern, daß wir von der Manina kommen, damit sie’s wissen. Aber die haben keine Ahnung davon, daß die Maninaheide hinter Prag liegt, und glauben, wir seien aus Manila.