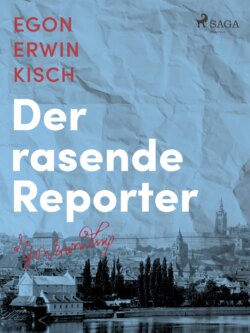Читать книгу Der rasende Reporter - Egon Erwin Kisch - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. AUF DEM RHEIN
ОглавлениеKöln, 28. Okt.
Die direkte Strecke Prag—Preßburg läuft ab Ruhrort auf dem Rhein.
Das ist aber nicht der Rhein der Idylle, nicht der rebenumsponnene Rhein des Volksliedes von Trunk und Liebe. Der fängt erst oben bei Bonn an. Auch nicht der Rhein des Schlachtgesanges, der Kriegsgeschichte von 1870, nicht der Rhein, über den ich — genau zwei Jahre sind es her — gekommen war, als es dort in der größten Menschenmauer aller Zeiten zu rieseln begann. Der Rhein liegt Tagereisen weiter südlich, im Elsaß.
Verlangst du in Duisburg oder in Düsseldorf einen Reiseführer vom Rhein, so schaut man dich groß an. Ja, eine Schiffahrtskarte mit Tiefenzeichen, Klippen und Leuchtfeuern — die kannst du haben. Aber ein Touristenweg ist hier nicht.
Keine Ruine, keine Loreley, kein Felsen, kein Passagierdampferchen mit gurrenden Hochzeitspärchen verirrt sich hier herunter, kein Liedersänger pries den Preis des Niederrheins, kein Feuilletonist seine Reize. Das Mädchen, dessen Denkmal man sehen kann, ist keineswegs ein minnigliches Lieb, kein Nixchen, das sich mit goldenem Kamme das goldene Haar kämmt, kein Ännchen von Tharau, im Gegenteil, „Jeanne Sebus, jeune fille de 17 ans“ (so steht es auf dem Monument, das ihr Napoleon 1809 setzen ließ), die bei resolutem Rettungswerk den Tod fand. Und auch diese Individualaktion, diese Personalverherrlichung hat kein Gegenstück. Die hier vollbrachten Werke sind Massenaktionen des Alltags, und Klio hätte sie in ihrer (stark vernachlässigten) volkswirtschaftlichen Rubrik zu verzeichnen. Keinen oder alle Namen hätte sie zu nennen, keinen oder alle Namen der Hunderttausende, die in den Hochöfen und Kohlengruben und Werften und Kanzleien schuften. Keinesfalls bloß die Namen der Nutznießer der Konjunktur, die sich dann als die Initiatoren aufspielen, die Krupp, die Thyssen, die Stinnes! Selbst die Natur, die hier ihre Kohlenspeicher innehat, darf nicht allzusehr überschätzt werden. Sie ist nicht mehr als eine einflußreiche Rohmateriallieferantin und hat privat einen Kunstgeschmack, der mit Unrecht lange genug als Standard der Ästhetik angenommen wurde.
Die Wolken und Wälder und Wiesen zu preisen, die (sagt man) die Allmacht Gottes beweisen, — nie hab’ ich’s getan! Die Alpen der Arbeit, die schwärzesten Nächte der Tunnels und Docks und Stollen und Schächte, die Äste im Kran, Grotten aus Eisen und Felsen aus Ziegel! Aus Drähten und Leinen wachsen dir Flügel, aus Glas und Gas wird Sonne und Mond, eherne Drähte mit kupferner Spitze fangen wie Tennisbälle die Blitze, während uns Gummi von Plagen verschont. Die Forste der Schlote, erschaffen vom Willen, der Dampfsirene befehlendes Schrillen, die Wolken des Rauches, die Gletscher der Kraft, der Lasten tiefstürzende Lawinen, die Strömung der Räder und der Turbinen: alles das, was der Mensch sich selber erschafft, das zeugt von Allmacht! Hierher sollen wir treten, hier sei unsere Andacht, hier laßt uns beten, den Namen des Menschen benedeien, hier laßt uns beten, daß mehr er vollbringe, daß ihm auch das Schwerste, das Letzte gelinge: sich selbst zu befreien.
Vorläufig steht allerdings auf Schleuse Nr. 1 des Herne-Rhein-Kanals ein belgischer Soldat und notiert jede Tonne, die in den Ruhrorter Hafen einläuft.
Ruhrort ist der größte Binnenhafen der Welt. Selbst wir, doch geradeswegs aus Hamburg kommend, selbst wir müssen staunen über die Zahl und Größe der Schiffe, die sich in den sechs Hafenbecken und im Hafenmund aneinanderquetschen. Sie kamen alle der Fahrt wie wir: aus dem Kanal, vom Ruhrrevier. Und müssen auf den Rhein und den hinauf bis nach Straßburg, wo der Franzose ihre Frachten übernimmt, zwei Millionen Tonnen als Lösegeld, nein, es heißt jetzt moderner: „Kriegsentschädigung“, nein, noch moderner: „Wiedergutmachung“. Auch viele belgische Schiffe sind hier, und Holländer. Das war aber bereits im Frieden so, und die alten Aufschrifttafeln im Hafen sind komisch mit ihren fast gleichlautenden Übersetzungen ins Holländische; so liest man unter dem Aviso „Anker schleppen verboten“ die Worte: „Anker slepen verboden“.
Es ist für einen Moldaudampfer ein Kunststück, im Hafen von Ruhrort-Duisburg Kohle zu nehmen. Zuerst versuchten wir’s an der Schütte, einer schiefen Ebene, auf deren einer Seite man den Kohlenwaggon umstülpt, damit die Kohle auf das unten im Rhein verankerte Schiff etwa fünf Meter tief hinunterrutscht. In der starken Strömung so zu verankern, daß unsere Bunkerlöcher genau in die Verlängerung der Schütte kamen — schon das war ein schwieriges Manöver. Aber als es soweit war, half uns das gar nichts. Unser Deck ist viel zu niedrig, viel zu weit von der Mündung der Schüttfläche entfernt, die Bunkerlöcher viel zu klein, das Gangbord zu schmal, als daß die herabfallende Kohle gerade hineinfallen würde. Mehr als die Hälfte ginge über Bord. Läßt man aber die Kohle auf die Mitte des Schiffes fallen, um sie gegebenenfalls dann in die Bunkerlöcher zu kehren, so prallt das herabfallende Material so heftig auf das Kesseldach, daß es von dort auch wieder in das Wasser springt, und wenn man die Bordwand noch so sehr durch Bretter erhöht.
Beinahe ein Vormittag vergeht mit diesen Versuchen. Endlich geben wir sie auf, lichten Anker und fahren zu einem Ladekran, daß dieser uns das Heizmaterial an Bord reiche. Doch auch hier hindert die Schmalheit unseres Gangbordes den Greifer daran, sein Maul aufzusperren, um auf uns zu kotzen. Deshalb läßt man ihn auf das Kesseldach baumeln und öffnet ihn dann ganz langsam. Ganz langsam — denn sonst bräche unter dem Gerölle das Blechdach zusammen. Sticht doch auch so der Steinschlag heftig genug gegen unsere Körper und Gesichter, und die Splitterchen fliegen in unsere Augen und in die Poren unserer Wangen. Schön sehen wir aus!
Aber nachdem der eiserne Rachen des Krans zweimal ausgespuckt hat, also zehntausend Kilogramm (3000 Mark) an Bord sind, ist unsere Fütterung vollendet. Wir können die Rheinfahrt beginnen.
Sofort nach den ersten Schritten auf dem Rhein ist unserem braven Moldaudampfer ein Malheur geschehen.
Unter der großen Ruhrort-Homberger Brücke war das. Links von uns war ein Schleppzug mit breiten Kohlenkähnen, „Hugo Stinnes“, der gleichfalls rheinaufwärts fuhr, rechts von uns der mächtige Brückenpfeiler, an dem sich die Strömung in wuchtigem Strudel brach. Dem Schleppkahn ausweichend, gerieten wir in das wilde Wasser, und unser Steuer hatte im Kampfe mit diesem so viel zu tun, daß es den Rissen des Lotsen am Steuerrad nicht mehr zu gehorchen vermochte.
Ein Ruck — und „Lanna 6“ stieß mit dem Bug auf den Kohlenkahn an. Es war ein furchtbarer Krach. Wir alle stürzten zu Boden. Die Fensterscheiben am Kapitänsstand zersplitterten. Das Trinkwasserfaß sauste in weitem Sprung auf die Bordwand und prallte von dort aufs Deck zurück. Der Eisenherd in der Kombüse fiel um wie ein Stück Holz, die Kaffeetöpfe sausten spritzend auf die Erde. Von Stühlen und Tischen gar nicht zu reden.
Mit „Volldampf rückwärts!“ wichen wir aus, taumelten noch etwas, aber bald richtete sich unser Schiff wieder gerade und konnte von neuem vorwärts, das Fluchen auf dem Kohlenkahn überhörend. Ein Arbeiter in blauer Bluse und mit schwarzem Vollbart drohte uns fürchterlich. Ob es wohl Herr Hugo Stinnes selbst war ...?
An Bord des „A. Lanna 6“ sah es arg aus, alles drunter und drüber. Gar übel war der Anblick, der sich uns bot, als wir die Niedergangsluke zum Freiraum im Steven öffneten. Die Farbtöpfe verschüttet und ineinandergeflossen. Die Scheiben der Laternen und der Zylinder zerschlagen. In diesem Raum, der die Rumpelkammer des Schiffes ist, aber doch seine Ordnung hatte, war jetzt ein Tohuwabohu, Ölkannen, Werkzeuge, Drahtseile, alles durcheinander.
Das Schlimmste jedoch wußten wir noch nicht: daß wir ein Leck hatten. Erst etwa eine Stunde später, als wir schon mit voller Kraft und halber Wirkung die Rheinströmung zu überwinden suchten und von unserem Schiffszusammenstoß als von einer glücklich abgewendeten Gefahr und einem überstandenen Abenteuer unserer Vergangenheit sprachen, bemerkte der Bootsmann, die Kajüte auskehrend, zwischen Bretterritzen des Fußbodens ein verdächtiges Schimmern. Er machte große Augen, hob eines der Bretter empor.
„Uz jó!“ Und laut rief er es auf Deck: „Deláme vodu.“ Ja, wir machten Wasser.
Es stand schon über den Traversen, bis an den Fußbodenrand der Kajüte, 30 Zentimeter hoch. Der Lotse ließ stoppen, der Maschinist brachte die Pumpe, die bisher, festgeschraubt, zum Kesselfüllen ein seßhaftes Leben geführt hatte, der Bootsmann trug den Schlauch unter Deck, und sie begannen zu pumpen. Der Kapitän und ich krochen in den Freiraum, das Leck zu suchen. Es war bald gefunden. Der Bug hatte sich stark gekrümmt, der ganze Steven war infolge des Anpralls nach rechts verbogen, und dadurch waren die Nieten und das Blech gesprungen. Aus vier Löchern der Bordwand strömte das Wasser des Rheins in dickem Strahl in unser Schiff, und durch die Ritzen floß es auch, wie ein Wasserfall.
Während achter nach Leibeskräften gepumpt wurde, verstopften wir vorne die Löcher mit Werg, so gut es ging. Es ging ganz gut. Bald war die Bordwand einigermaßen dicht gemacht, und statt des Sees unter unsern Füßen war es jetzt bloß eine Pfütze. Nun fuhren wir wieder mit Vollkraft stromaufwärts, mit einer Geschwindigkeit von acht Kilometern, und abends im Hafen von Köln trat an Stelle der provisorischen Restaurierung eine definitive.
Denn aufs Trockendock brauchte unser Schiff nicht zur Reparatur. „A. Lanna 6“ behält seine Schramme, seinen Renommierschmiß, bis an sein dereinstiges seliges Ende zur Erinnerung an seine Weltumsegelung im September, Oktober und auch November 1920.