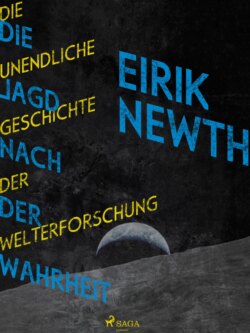Читать книгу Die Jagd nach der Wahrheit: Die unendliche Geschichte der Weltforschung - Eirik Newth - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Bibliothek von Alexandria
ОглавлениеDie Schrift ist eine seltsame Erfindung. Wenn wir diesen Satz lesen, dann scheint in unserem Kopf eine Stimme zu sprechen. Die Worte, die diese Stimme ausspricht, werden im Gehirn gelagert, jedenfalls für einige Zeit. Denn das allermeiste von dem, was wir lesen (und hören, sehen, schmecken, riechen und fühlen), vergessen wir bald wieder. Das muss auch so sein, sonst wäre unser Gehirn bald von Eindrücken und Wissen überfüllt.
Ein Buch ist eine Art erweitertes Gedächtnis, das Wissen unverändert über Jahrhunderte hinweg aufbewahrt. Nirgendwo können wir Gedanken besser lagern als in Büchern, und deshalb ist es kein Wunder, dass Philosophen und Forscher schon früh Bücher verfasst haben. Im Lauf der Zeit kam eine ziemliche Büchermenge zusammen. Tausende und abertausende von Büchern. Ein ganzes Meer von Wissen.
Wissen ist eine schöne Sache, aber zu viel des Guten wird zum Problem. Angenommen, ein Wissenschaftler hat eine gute Idee. Wie kann er sicher sein, dass vor ihm noch niemand diese Idee hatte? Das geht nur, wenn er sich in eine große Bibliothek begibt und die Bibliothekare um Hilfe bittet.
Das Wort Bibliothek ist griechisch und bedeutet „Buchlager“, und genau das ist eine Bibliothek. Dort werden viele Bücher aufbewahrt, und ohne Bibliothekar wären wir in ihr ganz und gar hilflos. Ein Bibliothekar ist wie der Steuermann auf einem Schiff: Er kann nicht alle Seekarten auswendig, aber er weiß, wie er den richtigen Kurs finden kann. Der Bibliothekar hilft, das Wissen zu finden, das wir brauchen.
Bibliotheken sind für die Gesellschaft so wichtig, dass es sie vermutlich schon in den ersten Großstädten gab. Die älteste uns bekannte Bibliothek ist eine viertausend Jahre alte Sammlung von Tontafeln, die aus der babylonischen Stadt Nippur stammt. Die Griechen hatten viele Bibliotheken. Die größte stand in Alexandria in Ägypten. Sie soll rund eine halbe Million Papyrusrollen enthalten haben – bis zu neun Meter lange Streifen eines papierähnlichen Stoffes, der aus Papyrusschilf vom Nil hergestellt wurde. Auf diesen Rollen wurde niedergeschrieben, was griechische Forscher, Philosophen und Künstler im Lauf der Jahrhunderte dachten.
Aus allen griechischen Städten und Kolonien kamen Philosophen und Forscher, um in diesen Rollen zu lesen. Viele blieben in Alexandria und machten so die Stadt zu einem wichtigen Forschungszentrum. Auch die Bibliothekare forschten. Einer der Leiter der Bibliothek, Eratosthenes, berechnete als Erster den Erdumfang. Mit einer einfachen Technik kam er zu einem fast richtigen Ergebnis.
Eratosthenes hatte gehört, dass die Sonne im Sommer genau über der Stadt Syene südlich von Alexandria stand. Mittags warfen Gebäude, Menschen oder Bäume dort keine Schatten. Eratosthenes wusste, dass das in Alexandria anders war. Die Sonne stand um diese Jahreszeit tiefer am Himmel, und alle Gegenstände hatten kurze Schatten.
Dass die Sonnenstrahlen zur selben Zeit auf Syene gerade auftrafen, während sie in Alexandria schräg fielen, brachte Eratosthenes zu der Überzeugung, dass es möglich sein müsse, die Erdkrümmung zu berechnen.
Eratosthenes stellte einen Mann an, der die Entfernung zwischen den beiden Städten messen musste, indem er auf dem Weg nach Syene seine Schritte zählte. Danach maß Eratosthenes aus, wie die Sonne über beiden Städten am Himmel stand. Als er die Entfernung zwischen den Städten mit dem Unterschied der Sonnenposition am Himmel verglich, kam er zu dem Ergebnis, dass der Erdumfang irgendwo zwischen 35 000 und 45 000 Kilometern liegen musste (die wirkliche Zahl beträgt 40 075 Kilometer). Das ist ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass Eratosthenes nur über sehr einfache Hilfsmittel verfügte.
Eratosthenes galt als klügster Mann seiner Zeit, und er wusste viel darüber, was griechische Entdecker, Kaufleute und Krieger auf ihren Reisen gesehen hatten. Deshalb konnte er eine Weltkarte zeichnen. Damals gab es mehrere Weltkarten, aber die des Eratosthenes war vermutlich die erste, auf der die Maßstäbe im Verhältnis zur Größe der Erde stimmten. Eratosthenes war einer der Forscher, die die Wissenschaft Geografie begründet haben. Dieses Wort ist Griechisch und bedeutet „die Erde zeichnen“, schließlich wird in der Geografie das Aussehen der Erde beschrieben.
Einige Jahrhunderte später versuchte ein anderer Wissenschaftler in Alexandria eine noch bessere Weltkarte zu zeichnen. Er hieß Ptolemäns und lebte ca. 100 bis 178 n. Chr. Ptolemäns wird oft als letzter großer griechischer Naturphilosoph bezeichnet. Vor allem sein Buch über Astronomie hat ihn berühmt gemacht.
Wie fast alle anderen Naturphilosophen seiner Zeit war Ptolemäus, wie er auch genannt wird, ein Anhänger des aristotelischen Bildes der Welt und des Universums. Aber er wusste auch, dass Aristoteles nicht alles hatte erklären können, was sich am Himmel abspielte. Sonne, Mond und Sterne waren kein Problem. Die bewegten sich, als seien sie an durchsichtigen Kugeln befestigt, die um die Sonne kreisten, genau wie Aristoteles es behauptet hatte.
Anders sah die Sache bei den fünf den Griechen bekannten Planeten aus: Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Normalerweise bewegen sie sich langsam von Osten nach Westen. Aber ab und zu ändern sich ihre Bewegungen, die Planeten machen kehrt und wandern einige Monate lang nach Osten. Dann machen sie abermals kehrt und bewegen sich wieder ganz normal von Osten nach Westen. Wie kann das möglich sein?
Die einfachste Erklärung war, dass die Planetenkugeln aus irgendeinem Grund bremsen und sich rückwärts drehen. Aber Ptolemäus war mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Wie Aristoteles glaubte er, dass im Weltraum strenge Ordnung herrsche. Die Planetenkugeln hatten sich in sauberen Kreisen und immer in derselben Richtung und im selben Tempo zu bewegen.
Deshalb entwickelte er seine eigene Variante des aristotelischen Kugelsystems. Ptolemäus stellte sich vor, dass jede von diesen riesigen Planetenkugeln noch kleinere, ebenfalls rotierende Kugeln aufwies. Und die Planeten waren an diesen kleinen Kugeln befestigt. Vermutlich baute Ptolemäus ein mechanisches Modell seiner Himmelsmaschinerie. Und das „ptolemäische System“ zeigte eine Planetenbewegung, die ungefähr mit dem übereinstimmte, was am Himmel zu beobachten war.
Die Vorstellung, die Welt sei von an Kugeln befestigten Kugeln umgeben, die in hohem Tempo durch das Weltall wirbelten, wirkte auch damals schon reichlich sonderbar. Aber Ptolemäus hielt das nicht für ein großes Problem. Er lebte zu einer Zeit, in der nicht das als Wahrheit galt, was mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Wahrheit war das, was mit den Gedanken des Aristoteles übereinstimmte.
Ptolemäus behandelt all diese Themen in seinem Buch „System der Mathematik“, das auf Griechisch Syntaxis mathematike hieß. Dieses Buch enthielt auch eine erweiterte Liste der hellsten Sterne am Himmel, die auf den Schriften des Astronomen Hipparchos beruhte. Die meisten Namen von Sternbildern, die wir noch heute verwenden, stammen aus der Syntaxis. Über vierzehnhundert Jahre lang war dieses Werk das wichtigste astronomische Lehrbuch.
Die Tatsache, dass Ptolemäus eigentlich seine Vorgänger nur noch ergänzte, war ein Hinweis darauf, dass die große Zeit der griechischen Philosophie ihrem Ende entgegenging. Ein Grund für diesen Niedergang war der Aufstieg Roms zur europäischen Großmacht. Die Römer waren praktisch denkende Leute, sie entwickelten einfache Maschinen und Geräte, und noch immer können wir ihre Bauwerke und Straßen bewundern. Die Römer entwickelten auch Gesetze und Regeln, die in unserem Rechtswesen bis heute zu finden sind, und wir verwenden weiterhin den römischen Kalender und die römischen Monatsnamen. Sogar die Buchstaben, wie sie hier stehen, haben die Römer als Erste verwendet.
Aber tieferes Denken und Forschen fanden die Römer nicht weiter interessant. Das überließen sie den Griechen. Für die Römer galt als Wahrheit über die Natur zumeist das, was die Griechen gedacht hatten, und nicht das, was sie selber sehen konnten. Die Römer hatten zum Beispiel gute Krankenhäuser, deren Ärzte gemerkt haben müssen, dass das, was griechische Wissenschaftler über die inneren Organe der Menschen geschrieben hatten, nicht immer mit ihren eigenen Erfahrungen übereinstimmte. Aber irgendwelche Konsequenzen haben sie offenbar nicht daraus gezogen.
Da die römischen Kaiser die Philosophie nicht verboten hatten, wurden während der ganzen Römerzeit an der Akademie und an ähnlichen Schulen weiterhin Wissenschaftler und Philosophen ausgebildet. Und so hätte die Philosophie vielleicht für einige Jahrhunderte auf Sparflamme weitermachen können, ehe sie einen neuen Aufschwung nahm. Vielleicht wäre ein neuer Aristoteles aufgetreten, um der Forschung frisches Leben einzuhauchen.
Stattdessen endete alles mit einer Katastrophe. Denn die große Bibliothek von Alexandria, in der es schon einmal beim Angriff Cäsars im Jahr 47 v. Chr. gebrannt hatte, ging endgültig in Flammen auf.
Da nur sehr wenige Kopien der leicht brennbaren Papyrusrollen existierten, ging durch diesen Brand sehr viel vom griechischen Wissen über Geschichte, Kunst und Kultur für immer verloren.
Wir wissen, dass vermutlich Brandstiftung im Spiel war, kennen aber die Brandstifter nicht. Wir wissen auch, wer zuletzt die Bibliothek geleitet hat: die Mathematikerin und Philosophin Hypatia nämlich, die so berühmt war, dass Studenten aus dem gesamten Römischen Reich nach Alexandria kamen, um von ihr unterrichtet zu werden.
Hypatia wurde im Jahr 370 n. Chr. geboren, ihr Vater war Mathematiker. Vermutlich versuchte sie, die mathematischen Regeln zu verbessern, die wir in Euklids Buch Die Elemente (vgl. S.) und in der Syntaxis mathematike des Ptolemäus finden.
Ihre Aufgabe war bestimmt nicht leicht, wir wissen ja schließlich, was die meisten griechischen Philosophen von philosophierenden Frauen hielten. Außerdem ließen sich damals in Alexandria viele zum christlichen Glauben bekehren. Ihnen galt die Philosophie als Symbol für das vermeintlich heidnische griechische Wissen. Hypatia war eine sehr wichtige Philosophin, und vermutlich aus diesem Grund wurde sie im Jahr 415 von den Christen ermordet. Dieser Mord hatte zur Folge, dass die restlichen Philosophen Alexandria verließen.
Bald darauf zerfiel auch das Römische Reich, und in Europa kam es zu einer endlosen Folge von Kriegen. Die christliche Kirche wurde derweil immer mächtiger. In Griechenland rieten die Priester den Menschen, sich auf die christlichen Tugenden zu konzentrieren und ihre Zeit nicht mit Grübeleien über den Ursprung aller Dinge zu vergeuden. Im Jahr 529 wurde die Athener Akademie geschlossen, was für die griechische Wissenschaft das Ende bedeutete.
Historiker, die erforschen, wie die Menschen zu verschiedenen Zeiten gelebt haben, teilen die Geschichte der Menschheit gern in Perioden ein. Die Glanzzeit der griechischen Philosophie wird als „klassische Periode“ oder „Antike“ bezeichnet, die achthundert Jahre nach dem Ende des Römischen Reiches heißen „Mittelalter“. Oft ist vom „finsteren Mittelalter“ die Rede, weil sich damals eine Art geistige Finsternis über Europa legte.
Viele Christen glaubten nun wieder, die Erde sei eine flache Scheibe. Krankenhäuser wurden geschlossen, weil die Priester erzählten, Kranke könnten geheilt werden, wenn sie zu Gott beteten. Freie Diskussionen wurden verboten, und eine neue Vorstellung von Wahrheit machte sich breit: Das einzig Wahre war das, was mit der Bibel übereinstimmte. Wer etwas anderes hören wollte, musste andere Erdteile aufsuchen.