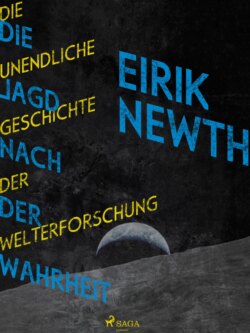Читать книгу Die Jagd nach der Wahrheit: Die unendliche Geschichte der Weltforschung - Eirik Newth - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Algebra und Alchimisten
ОглавлениеWir alle neigen dazu, uns für etwas Besseres zu halten als andere. Jungen halten sich für besser als Mädchen, Christen glauben, Muslimen überlegen zu sein, Weiße verachten Dunkelhäutige.
Das liegt zum Teil an unserer Erziehung. Aber Affenforscher haben nachgewiesen, dass Schimpansen ähnlich empfinden. Die Schimpansen leben in Gruppen, genau wie die Menschen. In der Regel fürchten sie sich und werden wütend, wenn ein fremder Schimpanse sich ihrer Gruppe nähert. Schlimmstenfalls bringen sie den Fremden um. Affen und Menschen sind eng miteinander verwandt. Dass wir dieselbe Angst empfinden, weist eigentlich darauf hin, dass sie Menschen und Affen angeboren ist.
Bei der Jagd nach der Wahrheit dürfen wir das nicht vergessen. Forscher sind nicht anders als andere Menschen, wenn es um Gefühle geht. Deshalb haben auch sie fremde Völker verachtet und nicht glauben wollen, dass auch die sich ihre Gedanken machten und die Natur erforschen konnten. In Europa war es üblich, Völker, die im Dschungel ein einfaches Leben führten, als „primitive Wilde“ zu bezeichnen. Erst seit einigen Jahrzehnten sehen wir das anders.
Nehmen wir zum Beispiel die Polynesier, die auf Inseln im Stillen Ozean leben. Dieses riesige Meer bedeckt die Hälfte unseres Planeten, und die Inseln, die die Polynesier bewohnen, sind im Vergleich dazu winzig klein. Im Stillen Ozean von einer Insel zur andern zu segeln ist ungefähr so, als würde ein Raumschiff in einem Sonnensystem von Planet zu Planet geschickt, in dem die Entfernungen riesig groß sind, weshalb man ganz genau steuern muss, um sein Ziel zu erreichen.
Die Polynesier hatten nur einfache Karten aus geflochtenem Stroh und Muscheln, aber sie wussten sehr viel über Sonne, Mond, Sterne, Meeresströmungen, Vögel, Wind und Wolken. Dieses Wissen hatten sie vermutlich teuer erkauft – mit Menschenleben. Das gilt für das meiste Wissen, das die Menschheit sich im Lauf der Zeit angeeignet hat. Damit wir wissen, dass eine Pflanze giftig ist, muss irgendwer diese Pflanze essen und krank werden.
Das erinnert an die Jagd nach der Wahrheit, wie die alten Griechen sie betrieben haben. Aber das bedeutet nicht, dass alle Völker ihre Philosophen hatten. Es gibt wichtige Unterschiede. Erinnern wir uns an Thales und das Wasser. Er interessierte sich nicht für Wasser, weil es nützlich ist oder weil er glaubte, die Götter würden sich über sein Interesse freuen. Thales versuchte, eine einfache Erklärung für das zu finden, was in der Natur vor sich geht.
Die Polynesier wussten sehr viel über die Bewegungen von Sternen und Planeten am Himmel. Aber wir wissen nicht, ob sie versucht haben zu erklären, warum der Himmel sich zu bewegen scheint. Und ob jemand die Frage gestellt hat: „Was sind Planeten und Sterne überhaupt?“ Aus Polynesien kennen wir keine dem Thales vergleichbare Gestalt, ebenso wenig wie unter den Wikingern und Samen in Nordeuropa, den Mongolen in Asien, den Massai in Afrika und den meisten anderen Völkern. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass wir nicht genug über die Geschichte dieser Völker wissen.
Der Wunsch, die Natur zu erforschen, ist so alt wie die Menschheit selber, aber nicht alle Menschen stellen Fragen so wie die Griechen. Uns sind nur zwei andere Regionen bekannt, in denen solches Denken vor unserer Zeit üblich war: China und das arabische Reich vor etwa tausend Jahren.
Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als in Athen die Akademie geschlossen wurde, waren die meisten Araber arme Nomaden, die die Wüstengebiete der arabischen Halbinsel durchstreiften (die Gegend, in der das heutige Saudi-Arabien liegt). Kaum jemand außerhalb dieses Gebietes wusste damals etwas von der Existenz dieses Volkes.
Aber schon zweihundert Jahre später erstreckte sich das arabische Reich von Indien bis Spanien. Nur selten ist in der Geschichte der Menschheit ein Volk so rasch so mächtig geworden. Wie war das möglich?
Vor allem war dafür der Kaufmann Mohammed verantwortlich, der um 570 n. Chr. in der Stadt Mekka auf der arabischen Halbinsel geboren wurde. Mit vierzig Jahren gelangte Mohammed zu der Überzeugung, er sei ein Prophet – jemand, der einen besonders guten Kontakt zu Gott hat. Obwohl Mohammed anfangs auf großen Widerstand stieß, konnte er schließlich die Macht über seine Landsleute gewinnen, weil er ein glänzender Redner und Heerführer war.
Nach seinem Tod waren die Araber überzeugt, dass nur Mohammed die Wahrheit über Gott gesagt hatte. Und wie die Christen wollten die Mohammedaner, die auch Muslime oder Moslems genannt werden, andere Völker davon überzeugen, dass sie Recht hatten. Deshalb eroberten sie zunächst die Nachbarländer der arabischen Halbinsel. Das mächtige Römische Reich gab es nicht mehr, und die tüchtigen arabischen Heerführer konnten fast alle Gegner besiegen. In manchen Ländern bedeutete der Islam für Frauen, Arme und Sklaven ein besseres Leben. Deshalb ließen sich viele gern zu dieser neuen Religion bekehren.
Anfangs hatten die arabischen Herrscher nichts gegen Forschung und Philosophie. Die Araber waren ein neugieriges Volk, und nachdem sie so lange in öden Wüstengegenden gelebt hatten, interessierten sie sich für die Länder, die sie eroberten. Sie versuchten, von den besiegten Völkern zu lernen. Die Araber hatten große Achtung vor den griechischen Philosophen und bewahrten viele griechische Bücher auf, die sie bei ihren Kriegszügen erbeutet hatten.
In Bagdad wurde eine Kopie von Platons Akademie gegründet, das sogenannte „Haus der Weisheit“. Hier wurden die Schriften Platons, Aristoteles’ und anderer Philosophen von arabischen Forschern übersetzt, zum Beispiel um das Jahr 800 n. Chr. die Syntaxis des Ptolemäus. Auf Arabisch hieß dieses Buch „Almagest“, das bedeutet „das Größte“, und unter diesem Namen ist es noch immer bekannt. Der Almagest hat auch dafür gesorgt, dass viele Sterne arabische Namen haben. Wenn wir zum Beispiel in einer Winternacht zum rötlichen Stern Beteigeuze (ausgesprochen „Betelgös“) im Orion hochblicken, dann wissen wir jetzt, dass dieser Name aus dem Arabischen stammt und „Schulter des Riesen“ bedeutet.
Die Araber übersetzten auch die Bücher von Hippokrates und Galenos und bauten die damals besten Krankenhäuser der Welt. Das größte davon war das Mansur-Krankenhaus von Kairo in Ägypten, in dem es eigene Abteilungen für Kranke mit Fieber, Durchfall, Augenleiden und Verletzungen gab. Patienten, die aus dem Mansur-Krankenhaus entlassen wurden, erhielten fünf Goldstücke, damit sie überleben konnten, bis sie wieder arbeitsfähig waren. Auf diese Weise haben die Araber auch eine Art Krankenkasse eingeführt, was in Europa erst im 20. Jahrhundert passierte.
Ähnliches ließ sich in vielen weiteren Bereichen beobachten. Die Araber sammelten Wissen und wandten es nutzbringend an. Sie waren keine so fähigen Forscher wie die alten Griechen und hatten auch keinen Philosophen, der sich mit Aristoteles messen konnte. Aber zum Ausgleich griffen sie bereitwillig Erfindungen auf, die andere Völker gemacht hatten.
Die wichtigste Erfindung, die die Araber übernahmen, stammte nicht aus Griechenland, sondern aus Indien. Diese Erfindung wird noch immer in aller Welt genutzt, wir alle haben jeden Tag damit zu tun, ohne weiter über ihre Herkunft nachzudenken. Bei dieser Erfindung geht es um Zahlen. Die Inder hatten seit Jahrtausenden Zahlen verwendet. Wie die Sumerer (vgl. S. 16) bauten die Inder schon vor mehreren tausend Jahren große Städte, und das geht bekanntlich nicht ohne Zahlen und Mathematik. Aber in Indien gab es noch einen weiteren Grund, sich für Zahlen zu interessieren. Die indische Religion, der Hinduismus, operiert nämlich mit Zahlen – mit sehr großen Zahlen.
Wenn eine Religion uns erzählen will, wie alt die Welt ist, heißt es oft, die Welt sei vor einigen Jahrtausenden erschaffen worden. Die Bibel berichtet, die Welt sei etwas älter als viertausend Jahre. Aber der Hinduismus liebt höhere Zahlen: Dort heißt es, die Welt sei vor Jahrmilliarden entstanden. So große Zahlen wurden damals im Alltag der Menschen nicht gebraucht – erst im 20. Jahrhundert rechnen wir mit Milliardenbeträgen. Deshalb gab es anfangs keine Möglichkeiten, um solche Zahlen aufzuschreiben.
Die Griechen lösten dieses Problem, indem sie alle großen Zahlen als „Myriade“ bezeichneten, mit einem Wort also, das wir heute nur noch sehr selten benutzen und nur dann, wenn etwas in unbestimmt großer Anzahl vorhanden ist. Aber die Inder wollten sich damit nicht begnügen. Deshalb machten sie eine wichtige Erfindung: eigene Zeichen für die Zahlen nämlich.
Die Griechen benutzten für die verschiedenen Zahlen normale Buchstaben. Die römischen Zahlen, die in einigen Zusammenhängen noch heute verwendet werden, werden ebenfalls durch Buchstaben dargestellt. Bei den Römern ist der Buchstabe I dasselbe wie 1, V bedeutet 5, X ist 10, L ist 50, C ist 100 und M 1000. Man kann sich vorstellen, zu welchen Problemen das geführt hat. Zahlen und Wörter ähnelten einander, und wenn Zahlen und Wörter nebeneinander standen, konnte das einen Mathematiker ziemlich in Verwirrung stürzen. Ein weiteres Problem war, dass in der römischen Schreibweise sogar kleine Zahlen lang und kompliziert werden konnten. Die Zahl 337 zum Beispiel wird als römische Zahl so geschrieben: CCCXXXVII.
Wenn für Zahlen eigene Zeichen entwickelt werden sollen, ergibt sich das Problem, wo wir die Grenze ziehen wollen. Es gibt schließlich eine unendliche Menge von Zahlen. Wir können eine so große Zahl nennen, wie wir wollen, wir werden immer eine noch größere finden. Deshalb ist es unmöglich, für jede Zahl ein eigenes Zeichen zu entwickeln.
Die Inder fanden heraus, dass jede Zahl dargestellt werden kann, indem wir einfach zehn Zeichen immer neu miteinander kombinieren. Aber das geht nur, wenn die Stellung des Zeichens verrät, womit es malgenommen werden muss. Beim indischen Zahlensystem ist die Reihenfolge der Zahlen sehr wichtig.
Das ist nicht ganz leicht zu erklären, und ich will versuchen, es an einem Beispiel zu verdeutlichen. Schauen wir uns die Zahl 3764 an, deren Schreibweise mithilfe des indischen Zahlensystems entstanden ist. Der Platz am weitesten rechts im indischen Zahlensystem ist der Einerplatz. Dass bei der Zahl 3764 die 4 am weitesten rechts steht, bedeutet, dass ihr Wert gleich 4 mal 1 ist. Links neben dem Einerplatz kommt der Zehnerplatz. Wenn dort die 6 steht, bedeutet das eigentlich 6 mal 10. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt weiter nach links gehen, erhält das Zahlensymbol, das dort steht, einen größeren Wert. Deshalb muss die Zahl links vom Zehnerplatz mit 100 malgenommen werden. Da dort eine 7 steht, ist der Wert dieser Zahl 7 mal 100. Die 3 ganz links steht auf dem Tausenderplatz. Das bedeutet, dass ihr Wert 3 mal 1000 beträgt. Alles zusammen ergibt 3000 + 700 + 60 + 4.
Wenn wir bei unserem Beispiel die 3 und die 7 vertauschen, erhalten wir die Zahl 7364, die fast doppelt so groß ist. Allein die Stellung der verschiedenen Zeichen bestimmt also die Größe der Zahl. Bei den römischen Zahlen ist das anders. Die Zahl 3764 wird dort so geschrieben: MMMDCCLXIV, die Zahl 7364 wird dagegen so dargestellt : MMMMMMMCCCLCIV. Daran sieht man, wie verwirrend die Mathematik im alten Rom gewesen ist.
Aber nicht alle Zahlen enthalten einen Einer, und was machen wir dann? Es ist vielleicht nicht leicht zu glauben, aber mit diesem Problem haben sich Mathematiker jahrhundertelang herumgequält. Auch dieses Problem konnten die Inder lösen. Sie dachten sich ein Zeichen aus, um anzuzeigen, dass dieser Platz in der Zahl leer war. Dieses Zeichen sieht so aus: 0. In der Zahl 450 bedeutet 0, dass es in dieser Zahl keine Einer gibt. In der Zahl 703 bedeutet 0, dass es keine Zehner gibt.
Ohne das Zeichen, das wir Null nennen, könnte das indische Zahlensystem nicht richtig funktionieren. Wir wissen nicht, wann diese geniale Idee aufgetaucht ist. Einer der ersten Mathematiker, die über die Null schrieben, war Brahmagupta, der im Jahr 598 n. Chr. in der Stadt Sind im heutigen Pakistan geboren wurde.
Ein Riesenvorteil liegt bei den indischen Zahlen darin, dass sich mit ihnen sehr viel leichter rechnen lässt. Wenn man zwei große indische Zahlen addieren will, braucht man nur die eine unter die andere zu schreiben und die Zahlen an den verschiedenen Plätzen zusammenzuzählen. Die Zehner werden zu den Zehnern dazugezählt, die Hunderter zu den Hundertern und so weiter.
Für Griechen und Römer dagegen war das viel schwerer. Auch für einfache Rechenarten wie Malnehmen und Teilen brauchten sie einen Rechenschieber, eine Art Zählgerät.
Den Arabern ging sehr schnell auf, dass sich mit den indischen Zahlen sehr viel leichter rechnen ließ als mit römischen oder griechischen. Der erste arabische Wissenschaftler, der begriff, wie wichtig das für die Wissenschaft war, war Al-Khwarizmi aus dem Iran. Er arbeitete in Bagdad im Haus der Weisheit, und er schrieb unter anderem Bücher darüber, wie sich mithilfe der Mathematik eine Erbschaft unter den Hinterbliebenen verteilen ließ. Er schrieb auch ein wichtiges Mathematikbuch namens Al-Gebr (das bedeutet: „Verbindung getrennter Teile“). Seither wird der Zweig der Mathematik, der sich mit Zahlen befasst (alles, was nicht Geometrie ist), als Algebra bezeichnet.
Auch Kaufleute machten sich die neuen Zahlen zu Nutze und halfen, dieses Wissen in der ganzen arabischen Welt zu verbreiten. Mit dem indischen Zahlensystem konnten die Kaufleute viel leichter kopfrechnen. Schnell rechnen zu können ist für Kaufleute in diesem Teil der Erde noch immer wichtig. Denn während wir Gegenstände kaufen, die mit Preisschildern versehen sind, diskutiert in vielen Ländern noch immer der Käufer mit dem Verkäufer über den Preis der Ware.
Obwohl es unserem Gehirn Probleme macht, große Zahlen zu erfassen, hat die indische Erfindung uns doch immerhin ein Gefühl für Zahlen gegeben. Automatisch wissen wir, welche Zahl größer ist, 1000 oder 228. Die Länge der Zahl verrät alles. Wie viel schwieriger war das für die Römer: Die Zahl CCXXVIII (228) ist kleiner als die Zahl M (1000), sieht aber viel größer aus.
Im 12. Jahrhundert begannen die Araber, mit europäischen Kaufleuten Handel zu treiben. In Europa wurden damals noch die römischen Zahlen benutzt. Die Europäer merkten wahrscheinlich schnell, wie viel besser die Araber rechnen konnten, aber sie durften die neue Technik nicht erlernen. Im christlichen Europa galten die Araber nämlich als Gehilfen des Teufels, deren Kundschaft angeblich aus der Hölle stammte. Erst im 16. Jahrhundert wurden die indischen Zahlen fast überall in Europa eingeführt.
Andere Erfindungen ließen sich nicht so leicht übergehen. Im 13. Jahrhundert lernten die Araber eine fantastische neue Erfindung aus China kennen: ein schwarzes, scharf riechendes Pulver.
Europäer und Araber führten immer neue Kriege gegeneinander, und auf dem Schlachtfeld lernten die Europäer die neue Erfindung kennen. Wenn Schießpulver angezündet wird, kommt es zu einer heftigen Explosion. Das lässt sich waffentechnisch nutzen. Wenn zum Beispiel Schießpulver in ein am einen Ende geschlossenes Rohr gepresst wird, dann jagt das Rohr in hohem Tempo durch die Luft, sobald wir das Pulver anzünden. Solche Raketen waren in China seit dem 10. Jahrhundert bekannt.
Wenn eine geringere Pulvermenge in einem an einem Ende geschlossenen Metallrohr untergebracht wird und wir eine Kugel darauflegen, dann saust die Kugel aus dem Rohr, sobald wir das Pulver anzünden. Die Kugeln aus solchen Kanonen waren viel gefährlicher als die Steine, die mit den von den Griechen verwendeten Katapulten geschleudert werden konnten.
Schießpulver war also für die Entwicklung neuer Waffen von ungeheurer Bedeutung, und es hat im Lauf der Zeit zahllosen Menschen das Leben gekostet. Deshalb ist es eine wirklich betrübliche Feststellung, dass der Erfinder des Schießpulvers vermutlich eine Medizin entwickeln wollte, die helfen sollte, das Leben der Menschen zu verlängern.
Wir wissen nicht, wer das Pulver erfunden hat, vermutlich war es ein chinesischer Alchimist. Als Alchimisten wurden Menschen bezeichnet, die alle möglichen Stoffe miteinander vermischten. Metalle wurden geschmolzen, Steine zerschlagen und in Wasser aufgelöst, Pflanzen und Bäume wurden zu Pulver verbrannt. Es gab fast überall auf der Welt Alchimisten, die tüchtigsten aber fanden sich in Arabien und China.
Die Alchimisten waren keine wirklichen Naturforscher, wie es die alten Griechen gewesen waren. Sie wollten zwar die Unterschiede zwischen den verschiedenen Stoffen in der Natur kennen lernen, aber es interessierte sie nicht weiter, warum diese Stoffe sich so sehr unterschieden. Die meisten Alchimisten wollten Reichtum erwerben. Sie hielten es für möglich, aus anderen Metallen Gold herzustellen. Diese Vorstellung hatten sie vermutlich von den Sumerern (vgl. S. 16) übernommen, die rund drei Jahrtausende v. Chr. durch das Vermischen der Metalle Kupfer und Zinn das neue Metall Bronze hergestellt hatten.
Da der Entdecker eines Verfahrens zur Herstellung von Gold der reichste Mensch der Welt werden würde, verbrachten manche Alchimisten ihr ganzes Leben mit dem Vermischen von Stoffen. Sie kamen niemals zu der Erkenntnis, dass es unmöglich ist, Gold durch das Einschmelzen und Vermischen von anderen Metallen herzustellen. Trotzdem war ihre Arbeit nicht ganz vergebens.
Die Alchimisten erfanden nämlich das Labor, einen Raum, der nur zum Forschen eingerichtet ist, und sie erfanden auch viele Instrumente, die in einem Labor verwendet werden. Glaskolben, Schmelzöfen und genaue Waagen wurden zuerst von Alchimisten benutzt. Außerdem entdeckten sie einige wichtige chemische Stoffe. Im 8. Jahrhundert n. Chr. versuchte der arabische Alchimist Jair ibn Hayyan, ein Lebenselixier herzustellen, eine Art Medizin, die gegen alle Krankheiten gleichzeitig wirksam sein sollte, ein sogenanntes Allheilmittel. Das gelang ihm nicht. Stattdessen entdeckte er die Essigsäure, den Grundbestandteil des Essigs.
Essigsäure ist ein ätzender, stinkender Stoff, der heutzutage in der Industrie viel verwendet wird. Alchimisten stellten auch den nützlichen Stoff Salmiak her, der unter anderem in Waschpulvern enthalten ist, und Alkohol, der nicht immer so nützlich ist.
Die chinesischen Alchimisten waren mehr am Lebensexilier interessiert als am Gold. Aber da auch sie nicht begriffen, was beim Vermischen von Stoffen passierte, war das genauso wenig von Erfolg gekrönt. Ihre Elixiere enthielten oft Giftstoffe wie Quecksilber und Arsen, und deshalb starben bisweilen Kranke, denen sie ihre „Lebensmedizin“ verabreicht hatten. Auch mehreren Kaisern von China wurde dieses Schicksal zuteil.
Aber auf dieselbe unvorsichtige Weise erfanden sie auch das Schießpulver. Irgendwann im 9. Jahrhundert vermischte ein chinesischer Alchimist aus Zufall Holzkohle, Schwefel und einen Stoff namens Salpeter und zündete die Mischung an. Wir wissen nicht, ob er das überlebt hat. Ein Buch aus dem Jahr 850 berichtet jedoch, dass Alchimisten sich Hände und Bart versengten, wenn sie mit dieser Mischung experimentierten, und dass schon mehrere Laboratorien abgebrannt waren.
Vermutlich stellten die Alchimisten fest, dass Schießpulver einen dichten Behälter sprengt, wenn es angezündet wird. In China war Feuerwerk sehr beliebt, und deshalb wurde Schießpulver in Papierrollen gefüllt, die mit großem Krach explodierten, wenn das Pulver angezündet wurde. Solche „Chinaböller“ sind noch immer überall auf der Welt beliebt, wenn es etwas zu feiern gibt. Die ersten Raketen wurden ebenfalls auf Festen zum Spaß abgeschossen, aber bald ging den Chinesen auf, dass das Pulver auch für Waffen verwendet werden kann. Bei einer großen Schlacht im Jahr 994 wurden erstmals Raketen benutzt. Bald darauf wurden in Fabriken hunderte von Kriegsraketen hergestellt.
Im 11. Jahrhundert verbreitete sich auch außerhalb von China das Wissen, wie Schießpulver hergestellt wird. Kaufleute brachten es ins arabische Reich und nach Europa. Der Kaiser von China erkannte sehr bald, wie gefährlich Schießpulver in den Händen der Feinde sein konnte. Deshalb verbot er im Jahr 1067 privaten Kaufleuten, die Bestandteile des Schießpulvers zu verkaufen. Aber der Kaiser kam zu spät. Schließlich war das Rezept zur Pulverherstellung wichtig, nicht die einzelnen Zutaten.
Eines der größten Probleme bei der Jagd nach der Wahrheit ist, dass wir nicht immer wissen, welche Folgen eine Erfindung nach sich ziehen kann. Es war kein purer Zufall, dass der Erfinder des Schießpulvers aus China stammte. Die Chinesen haben nämlich hunderte von wichtigen Entdeckungen und Erfindungen gemacht, die das Leben der meisten Menschen erleichterten. In China wurde zum Beispiel zum ersten Mal ein Eisenpflug benutzt, mit dem sich viel besser pflügen ließ als mit den alten Holzpflügen. Die Chinesen stellten auch als Erste fest, dass sich die Ernte vergrößert, wenn das Korn in Reihen gesät wird, und sie entwickelten das erste Gift, um schädliche Insekten zu töten.
Die Chinesen bohrten nach Öl, nutzten die Wasserkraft, stellten Kunststoffe her und benutzten schon tausend Jahre früher als die übrige Welt Papiergeld. Viele ihrer Erfindungen verwenden wir noch heute, zum Beispiel Landkarten, selbst leuchtende Farbe, Spielkarten, Streichhölzer, Schubkarren, mechanische Uhren, Spagetti, Regenschirme, das Schachspiel, Steigbügel, Bücher, Angelruten mit Kurbeln und das Steuerruder. Manches von dem wurde aber auch zwei- oder mehrmals an unterschiedlichen Orten und unabhängig voneinander erfunden.
In China fehlte zwar eine Einrichtung wie die Akademie in Athen, aber es gab dort dennoch viele tüchtige Forscher. Die Chinesen hatten schon lange vor den Griechen den Sternenhimmel studiert, und sie entdeckten unter anderem die Flecken auf der Sonne. Chinesische Mathematiker waren mindestens so tüchtig wie ihre indischen und arabischen Kollegen und erfanden ein Zahlensystem, das dem indischen ähnlich ist.
Chinesische Ärzte behandelten viele gefährliche Krankheiten und verfügten über verschiedene Impfstoffe (vgl. S 144ff).
Der chinesische Arzt Chang Chi, der um das Jahr 200 v. Chr. lebte, erkannte, dass manche Krankheiten durch falsche Ernährung entstehen. Er erklärte, wie solche Mangelerkrankungen geheilt werden konnten. Erst im 18. Jahrhundert verfügten auch europäische Ärzte über dieses Wissen.
Diese vielen Entdeckungen und Erfindungen trugen dazu bei, dass China zu einem der reichsten und mächtigsten Länder der Welt wurde. Die Araber fürchteten und achteten die Chinesen aus gutem Grund.
Aber seit damals hat sich einiges geändert. Sowohl in China wie auch in Arabien wurde für lange Zeit die Jagd nach der Wahrheit eingestellt. Wie in Europa nach der Römerzeit wurden auch dort irgendwann keine bedeutenden Entdeckungen und Erfindungen mehr gemacht.
Einer der Gründe, warum es in China dazu kommen konnte, kann das chinesische Denken sein. Der größte Philosoph der chinesischen Geschichte hieß K’ung-fu-tzu. Er lebte um das Jahre 500 v. Chr. und stellte Regeln auf, wie die Gesellschaft funktionieren und wie die Menschen miteinander umgehen sollen.
Konfuzius, wie wir ihn heute schreiben, war auf Gesetz und Ordnung erpicht. Die Menschen sollten die Gesetze befolgen und dem Kaiser und anderen mächtigen Personen gehorchen. Ehefrauen mussten ihren Männern gehorchen, die Jugend musste die älteren Leute respektieren. Ein Problem bei diesem Denken ist, dass es nicht mehr leicht ist, Fragen zu stellen.
Am Anfang meines Buches habe ich dazu aufgefordert, zu zweifeln und nicht einfach alles zu glauben. Solche Zweifel sind in gewisser Hinsicht das genaue Gegenteil der Lehre von Konfuzius. Er empfiehlt uns, denen zu glauben, die älter sind und über eine längere Ausbildung verfügen als wir. Dieses Denken bringt uns beim Forschen jedoch nicht weiter. Oft stellen nämlich junge Menschen mit ausgefallenen Ideen die richtigen Fragen, während ältere Forscher oft in ihrem gewohnten Denken verharren.
Im Lauf der Zeit wurde es in China immer schwieriger, Fragen zu stellen und neue Ideen Gehör finden zu lassen. Auf diese Weise ging es damals bergab mit den Chinesen – am Ende vergaßen sie sogar ihre eigenen Erfindungen. Als europäische Priester im 17. Jahrhundert den Chinesen ihre mechanischen Uhren zeigten, waren die Chinesen zutiefst beeindruckt. Sie wussten nicht mehr, dass sie einst selber vergleichbare Zeitmesser erfunden hatten.
Auf ähnliche Weise entwickelte sich die Lage im arabischen Reich. Obwohl arabische Wissenschaftler tüchtig waren, konnten sie nicht so viele Fragen stellen wie die griechischen Philosophen. Ihre Religion behauptete, die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu kennen, weshalb sie sich nicht weiter damit befassen sollten. Deshalb wagten nur wenige Araber, dasselbe zu sagen wie Demokrit: dass Gott für die Natur und das Leben der Menschen keine Bedeutung habe.
Die arabische Gesellschaft hatte teilweise dieselben Probleme wie die griechische. Die Araber verboten ihren Frauen das Forschen, und sie hatten Sklaven, weshalb es nicht nötig war, arbeitssparende Erfindungen zu machen. Im Lauf der Zeit wurde die Religion immer strenger, und immer mehr Fragen wurden verboten. Die Entwicklung war in dieser Hinsicht dieselbe wie in Europa. Die Religion läutete ein Mittelalter ein, in dem als Wahrheit galt, was im Koran stand, dem heiligen Buch.
Die Jagd nach der Wahrheit erinnert an einen Staffellauf. Nicht jeder Läufer hat die ganze Zeit die Stafette in der Hand, aber sie ist immer unterwegs. Und um das Jahr 1300 gaben die Araber die Stafette wieder an die Europäer zurück.