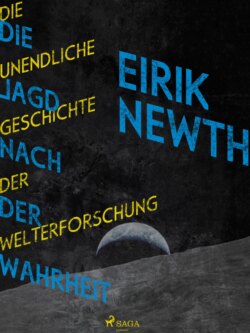Читать книгу Die Jagd nach der Wahrheit: Die unendliche Geschichte der Weltforschung - Eirik Newth - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Aristoteles
ОглавлениеAristoteles gehört zu den wenigen griechischen Philosophen, über die uns recht viel bekannt ist. Das liegt unter anderem daran, dass noch über zweitausend Seiten seiner Schriften erhalten sind. Deshalb wissen wir mit ziemlicher Sicherheit, dass er im Jahr 384 v. Chr. in der Stadt Stagira geboren wurde und dass sein Vater Leibarzt des Königs von Makedonien, einem Königreich in Nordgriechenland, war.
Was Aristoteles als junger Mann gedacht hat, wissen wir nicht, vielleicht weckte der Beruf seines Vaters bei ihm das Interesse an allem, was in der Natur wuchs, kroch und krabbelte. Als Sohn eines reichen Mannes konnte Aristoteles lernen, was er wollte, und deshalb begab er sich mit siebzehn Jahren nach Athen, der wichtigsten Stadt in Griechenland.
Dort gab es die Akademie, eine Art Philosophenschule. Die Akademie war im Jahr 387 v. Chr. von dem Philosophen Platon gegründet worden, der noch immer unterrichtete, als Aristoteles sein Studium aufnahm.
Platon interessierte sich nicht sonderlich für die Natur. Er hielt das, was wir sehen können, nicht für die wahre Wirklichkeit. Er glaubte, dass sich hinter allem in der Natur ein unsichtbarer Plan oder eine Idee dieses Gegenstandes versteckt, und nur diese Idee sei wirklich, nicht das Ding selber. Platon würde sagen, das Buch, das wir in Händen halten, ist nur ein Schatten des wirklichen Buches, einer weit über unsere Welt erhabenen Idee.
Nach Platons Vorstellung sollten sich die Philosophen auf die Ideen konzentrieren, und das war nur durch Denken möglich. Platon fand es sinnlos, die Natur zu studieren. Da sich die Mathematik oft mit Zahlen und Figuren beschäftigt, die nur in der Vorstellung der Menschen existieren, hielt Platon sie für die einzige Wissenschaft, die überhaupt der Mühe wert war.
Platons Gedanken waren nichts Neues. Sein großer Lehrmeister, Sokrates, hielt das Studium der Natur sogar für gleichbedeutend mit einer Geisteskrankheit. Es liegt auf der Hand, dass solche Vorstellungen Naturforscher nicht gerade weiterbringen. Trotzdem gelang Platon etwas, das für alle Forscher von großer Bedeutung war. Seine Gründung der Akademie erwies sich als gute Idee. Denn wenn sich Philosophen aus dem ganzen Land an einem Ort treffen, können sie voneinander lernen und mit anderen Philosophen diskutieren.
An der Akademie wurden mehr als achthundert Jahre lang Philosophen ausgebildet, und noch heute haben alle Forscher Schulen besucht, die Ähnlichkeit mit dieser Akademie haben. Heute heißen solche Schulen zwar Universitäten, aber die dort ausgebildeten Leute werden weiterhin als Akademiker bezeichnet.
Aristoteles freundete sich mit Platon an, aber er war nicht immer derselben Meinung wie sein Lehrer. Er glaubte zum Beispiel, dass das, was wir sehen, wirklich ist, nicht eine bloße Idee. Deshalb glaubte er auch, dass wir aus der Beobachtung der Natur sehr viel lernen können. Aristoteles war der erste griechische Philosoph, der ernsthafte Naturstudien betrieben hat.
Das war keine leichte Aufgabe, denn in der Natur geht es nicht gerade ordentlich zu. Steine, Wolken, Wasser, Tiere und Pflanzen, alles wuselt durcheinander, und nur wenig scheint auf einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Bestandteilen der Natur hinzuweisen.
Für unser Alltagsleben spielt das keine große Rolle. Das menschliche Gehirn hat sich dem Chaos in der Natur angepasst und löst das Problem dadurch, dass alles, was wir sehen, in Gruppen eingeteilt wird. Alles, was einen braunen Stamm und eine grüne Krone hat, landet in der Gruppe „Bäume“. Alles, was groß und weiß ist und sich am Himmel bewegt, gilt für uns als Wolke. Alles, was ein Fell, vier Beine und scharfe Zähne hat, wird von uns sehr schnell in die Gruppe „Raubtier“ einsortiert. Man braucht nicht über alles nachzudenken, was man sieht, sondern kann es in einer passenden Gruppe unterbringen. Dadurch kann man schneller denken, und das kann sich bezahlt machen, wenn man plötzlich einem Wesen mit Fell, vier Beinen und scharfen Zähnen gegenübersteht.
Aber man braucht nicht lange im Wald unterwegs gewesen zu sein, um zu erkennen, dass es verschiedene Bäume gibt. Manche haben runde Blätter, andere gezackte. Manche scheinen überhaupt keine Blätter zu haben, sondern spitze Nadeln. Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch bei Blumen, Tieren und Steinen machen. Es gibt tausende und abertausende von verschiedenen Typen, ob wir es nun mit lebenden Wesen oder leblosen Gegenständen zu tun haben.
Das wusste auch Aristoteles, und im Lauf einiger Jahrzehnte studierte er über fünfhundert unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten. Aristoteles interessierte sich für die Ähnlichkeiten der unterschiedlichen Arten, mit denen er sich beschäftigte. Tanne und Kiefer sind zwar unterschiedliche Baumarten, aber sie haben doch mehr Ähnlichkeit untereinander als beispielsweise Tanne und Birke. Aristoteles glaubte, dass Tier- und Pflanzenarten, die Ähnlichkeit miteinander haben, auf irgendeine Weise miteinander verwandt sind. Deshalb bezeichnete er auch Affen als eine Art Mittelding zwischen Menschen und anderen Säugetieren.
Besonders interessierte Aristoteles zunächst das Meer. Er beschäftigte sich ausgiebig mit Tintenfischen und Krustentieren. Er stellte auch fest, dass Delfine keine Fische sind, sondern Säugetiere, die Luft einatmen.
Viel Zeit verbrachte er damit, die Vermehrung von Tieren zu untersuchen. Wenn er ein Hühnerei in verschiedenen Stadien der Befruchtung öffnete, sah er, dass ein kleiner Punkt im Ei zu einem Embryo und dann zu einem Küken wurde. Aristoteles gilt als Begründer der Wissenschaft vom Leben – der Biologie – und der Wissenschaft der vorgeburtlichen Entwicklung von Tieren – der Embryologie.
Aristoteles stellte eine „Rangliste“ auf, in der Tiere und Pflanzen aufgeführt wurden. Ganz unten in dieser Rangliste standen die Pflanzen, die sich nur vermehren und wachsen können. Über ihnen stehen die Tiere, denn sie können sich außerdem noch bewegen. Ganz oben stehen die Menschen, die auch denken können. Von dieser Rangordnung sind bis heute die meisten Menschen überzeugt.
Aristoteles schrieb viele Bücher über seine Beobachtungen. Er beschreibt darin, wie Lebewesen aussehen, wie sie sich bewegen, was sie essen und wie sie sich vermehren. Kein anderer Philosoph hatte so viele Interessen wie Aristoteles. So schrieb er auch Bücher über Politik, Kunst, Moral und Astronomie.
Viele Griechen hatten damals bereits den Sternenhimmel studiert, aber Aristoteles hielt als Erster die Erde für eine Kugel – ein mutiger Gedanke in einer Zeit, in der die meisten Philosophen und überhaupt die meisten Menschen die Erde als flache Scheibe betrachteten. Dazu hatten sie schließlich allen Grund, da die Welt nun einmal nicht kugelförmig wirkt.
Beobachtungen bei einer Mondfinsternis hatten Aristoteles zu der Überzeugung kommen lassen, dass die Welt eine Kugel ist. Mondfinsternisse sind nur bei Vollmond möglich; sie beginnen damit, dass der Mond sich nach und nach orange verfärbt. Dann schiebt sich eine runde, dunkle Fläche vor den Mond. Diese Fläche verdeckt den Mond eine Zeit lang, dann verschwindet sie wieder.
Viele Menschen glaubten, die Götter färbten den Vollmond schwarz, um den Menschen Angst einzujagen. Aristoteles dagegen hielt die runde Fläche für den Schatten, den die Erde wirft, wenn sie von der Sonne beschienen wird. Der Schatten ist immer rund, und das ist nur möglich, wenn die Welt eine Kugel ist. Wenn die Welt eine Scheibe wäre, würde sie ab und zu schräg zur Sonne liegen. Und dann könnten wir bei einer Mondfinsternis nur einen dunklen dünnen Schattenstreifen sehen.
Aristoteles hatte noch ein weiteres Argument: Schiffe, die sich vom Land entfernen, scheinen hinter dem Horizont zu verschwinden. Zuerst verschwindet der Rumpf, dann das Segel und schließlich die Mastspitze. Das ist nur möglich, wenn die Welt kugelförmig ist, erklärte er. Die meisten Philosophen ließen sich davon überzeugen, und seither hielten die Akademiker die Welt für eine Kugel.
Aristoteles wandte dieselbe Technik an wie Thales von Milet. Er versuchte, ein Phänomen in der Natur durch Dinge zu erklären, die in der Natur vorkommen. Mondfinsternisse sind keine göttliche Mahnung, sie entstehen ganz einfach dadurch, dass eine Kugel einen Schatten wirft. Man kann selber sehen, wie Aristoteles sich das vorgestellt hat, wenn man den Schatten, den ein Tennisball an die Wand wirft, mit dem eines Tellers vergleicht. Wenn man den Teller in verschiedenen Positionen hält, sieht man, was ich meine.
Aber es reicht nicht, die Natur zu beobachten und eine Erklärung für das zu suchen, was wir sehen. Für dasselbe Phänomen gibt es oft mehrere Erklärungen, die ein Forscher auseinander halten muss. Aristoteles stellte eine Reihe von Regeln auf, wie Forscher vorgehen sollten. Solche Denkregeln werden „Logik“ genannt, und ein Großteil der Arbeit des Aristoteles handelt von Logik. Darüber schreibt er in einem Buch namens Organon (das bedeutet „Werkzeug“). Der Titel ist gut gewählt, denn Aristoteles hat den Forschern mit seinem Buch ein echtes Werkzeug an die Hand gegeben.
An dieser Stelle möchte ich mit einem für die Jagd nach der Wahrheit wichtigen Wort bekannt machen: Theorie. Das Wort kennt jeder. Manchmal hat es einen negativen Beiklang. Ein unpraktischer Mensch, der im Alltag nicht zurechtkommt, wird zum Beispiel oft als „Theoretiker“ bezeichnet. Und wenn wir sagen: „Ach, das ist ja nur eine Theorie“, dann bringen wir damit zum Ausdruck, dass eine Behauptung so vage ist, dass wir uns nicht weiter drum zu kümmern brauchen.
Aber die Forscher sehen das alles ganz anders. Wenn sie erklären wollen, was sie in der Natur sehen, dann brauchen sie dazu Theorien. Deshalb gehört es zur Aufgabe der Forscher, solche Theorien zu entwickeln. Wir können durchaus behaupten, die Jagd nach der Wahrheit sei eine Jagd nach neuen Theorien.
Zwischen einer Theorie und einer Idee besteht ein großer Unterschied. Wir alle können Ideen über das, was sich in der Natur abspielt, jederzeit aus dem Ärmel schütteln. Es ist kein Problem, eine andere Erklärung für Mondfinsternisse zu finden als die, die Aristoteles uns hinterlassen hat. Ich kann zum Beispiel sagen: „Eine Mondfinsternis findet statt, wenn eine große Vogelschar am Mond vorbeifliegt.“
Das ist eine lustige Idee, aber keine Theorie. Wenn andere Forscher meine Idee ernst nehmen sollen, muss ich Fragen beantworten können wie: „Warum bleiben die Vögel stumm, wenn sie am Mond vorbeifliegen? Warum fliegt die Vogelschar immer in Kreisformation, wenn sie sich über den Mond bewegt? Vogelscharen fliegen normalerweise dicht über unseren Köpfen. Wie ist es also möglich, dass die Menschen an verschiedenen Orten die dunkle Fläche vor dem Mond gleichzeitig sehen?“
Wenn meine Idee als Theorie durchgehen soll, muss ich all diese Fragen und noch viele weitere beantworten können. Und wenn meine Theorie eine Überlebenschance haben soll, muss ich andere Forscher überzeugen, dass meine Vogelschar-Idee eine bessere Erklärung für Mondfinsternisse bietet als die Theorie des Aristoteles.
Eine Theorie zu entwickeln lässt sich mit dem Bau eines Hauses vergleichen (und unter Forschern ist wirklich vom „Aufbau einer Theorie“ die Rede). Es ist eine mühselige Arbeit. Wie ein Maurer die Steine so aufeinander legen muss, dass ein solides Haus entsteht, so muss ein Forscher dafür sorgen, dass viele verschiedene Fragen eine Antwort finden. Und dabei hilft ihm die Logik des Aristoteles. Sie hilft Forschern, die Gedanken ihrer Theorie in die richtige Reihenfolge zu bringen und eventuelle Fehler und Mängel zu entdecken.
Oft heißt es, die Naturforschung habe mit Aristoteles eingesetzt. Aber sie hat auch mit ihm aufgehört – für nahezu achtzehnhundert Jahre. Denn Aristoteles war so bedeutend, dass viele spätere Philosophen nicht glauben mochten, dass er sich jemals geirrt haben könnte. Sie vergaßen ganz einfach, dass Aristoteles gesagt hat: „Wahrheit ist der Gedanke, der am ehesten mit der Natur übereinstimmt.“ Sie dachten stattdessen: „Wahrheit ist der Gedanke, der am ehesten mit Aristoteles übereinstimmt.“
Das führte dazu, dass sich tüchtige Philosophen, die anderer Ansicht waren als Aristoteles, mit ihren Ideen nicht durchsetzen konnten. Ein solcher Fall war Aristarchos von Samos, der um das Jahr 320 v. Chr. geboren wurde. Wie Aristoteles hatte er beobachtet, dass sich Sonne, Mond und Planeten über den Himmel bewegen. Aber er hatte dafür eine ganz andere Erklärung als der berühmte Aristoteles.
Aristoteles glaubte, die Erde stehe im Zentrum des Universums, während Sonne, Planeten und Sterne, an großen, durchsichtigen Kugeln befestigt, um sie kreisten. Diese Vorstellung lag durchaus nahe, denn der Himmel scheint sich wirklich um die Erde zu drehen. Die Sonne geht jeden Tag im Osten auf und im Westen unter, und das gilt auch für die Sterne und alle anderen Himmelskörper.
Aristarchos glaubte aber, dass sich die Sonne im Zentrum des Universums befindet und die Erde und die anderen Planeten sich um sie drehen. Der Himmel scheint sich von Osten nach Westen zu bewegen, weil sich die Erde in die Gegenrichtung dreht, von Westen nach Osten. Davon kann man sich selber ein Bild machen.
Man richte seinen Blick auf einen Gegenstand, zum Beispiel auf ein Bild an der Wand, und drehe den Kopf von rechts nach links. Das Bild scheint sich nach rechts zu bewegen. Man dreht seinen Kopf in eine Richtung, und das, was man sieht, wandert in die Gegenrichtung. Genauso ist es am Himmel, meinte Aristarchos. Die Erde dreht sich von Westen nach Osten, und der Himmel scheint in die Gegenrichtung zu rotieren.
Aristarchos versuchte auch, unsere Entfernung zu Sonne und Mond zu berechnen. Er kam zu dem Ergebnis, die Sonne sei zwanzigmal weiter von der Erde entfernt als der Mond. Diese Zahl ist etwa zwanzigmal zu klein, aber wenn man bedenkt, dass Aristarchos kein Fernrohr und keine modernen Instrumente hatte, war es doch eine beeindruckende Leistung.
Obwohl Aristarchos seine Ansicht mit ebenso guten Argumenten untermauern konnte wie Aristoteles, wissen wir doch fast nichts über ihn. Die Philosophen, die nach ihm kamen, haben seine Schriften nicht aufbewahrt. Er interessierte sie nicht weiter, weil er anderer Ansicht war als Aristoteles. Fast achtzehnhundert Jahre mussten vergehen, ehe seine Gedanken wieder auftauchten, diesmal an einem ganz anderen Ort in Europa.