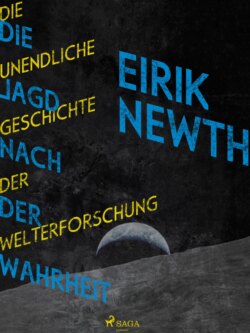Читать книгу Die Jagd nach der Wahrheit: Die unendliche Geschichte der Weltforschung - Eirik Newth - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Europa kommt wieder nach vorn
ОглавлениеAls in Europa die Neugier auf die Natur wieder erwachte, geschah das zuerst innerhalb der Kirche, die die Verantwortung für alles Wissen und Denken trug. Wer im Mittelalter eine Ausbildung haben wollte, musste Priester, Mönch oder Nonne werden. Mönche und Nonnen lebten in besonderen Gebäuden, die „Kloster“ genannt werden. Dort sollten sie ihre Zeit vor allem mit Beten verbringen. Sie durften nicht heiraten und mussten strenge Regeln einhalten.
In Wirklichkeit war dieses Leben aber nicht immer so streng. Wer „Robin Hood“ gelesen hat, diese Geschichte eines englischen Helden aus dem Mittelalter, der erinnert sich vielleicht noch an Bruder Tuck, den fetten und faulen Mönch, der gern trank und sich prügelte. Sein Beispiel zeigt, dass sehr unterschiedliche Menschen ins Kloster gingen, nicht nur die frommen.
Zum Beispiel die Neugierigen. Vor tausend Jahren gab es in Europa kein Haus der Weisheit und keine Akademie mehr. Im Kloster dagegen war eine Art Ausbildung möglich, und dort gab es auch Bibliotheken. Im 11. Jahrhundert wurden dort neue Bücher in Gebrauch genommen, Bücher, die Aristoteles, Ptolemäus und andere griechische Philosophen geschrieben hatten.
Die Araber hatten die Werke der griechischen Philosophen aufbewahrt, und viele Bücher in den Klostern waren aus dem Arabischen übersetzt worden. Bücher zu übersetzen ist immer schon ein schwieriges Handwerk gewesen, manchmal kann es sogar lebensgefährlich sein. Im Mittelalter führten Araber und Europäer gegeneinander Krieg. Mönche mussten sich als Muslime verkleiden oder sogar die Religion wechseln, um sich die Bücher zu verschaffen. Ein solches Konvertieren wurde manchmal mit dem Tode bestraft.
Wenn die arabischen Bücher in den Klöstern eintrafen, wurden sie nicht ins Englische oder Italienische übersetzt, sondern ins Lateinische, die alte Sprache Roms. Das Latein hatte den Untergang des Römischen Reiches überlebt, weil die Kirche es benutzte. Die Bibel war schon längst ins Lateinische übersetzt worden, und Messen wurden auf Latein gelesen. Die Menschen sprachen Gebete in einer Sprache, die die meisten von ihnen nicht verstanden! Aber die Verwendung des Lateinischen hatte auch ihre Vorteile. Da alle Nonnen und Mönche Latein lesen konnten, hatte ein Mönch in Mainz ebenso großen Nutzen von einem Buch wie eine Nonne in Rom.
Wenn ein Buch fertig übersetzt war, dauerte es aber noch lange, bis alle, die ein Exemplar haben wollten, auch wirklich eins besaßen. Damals mussten alle Bücher mit der Hand Wort für Wort abgeschrieben werden. Das sogenannte Kopieren von Büchern wurde zu einem eigenen Beruf. Es ist klar, dass die Bücher deshalb von Fehlern nur so wimmelten, und wer damals Bücher las, konnte sich nicht darauf verlassen, dass zwei Kopien genau dieselben Wörter enthielten.
Bücher können gefährlich sein. Manche Mönche und Nonnen, die die griechischen Philosophen gelesen hatten, fingen an, auf neue Weise zu denken. Sie hatten gehört, dass die Wahrheit allein in der Bibel zu finden sei. Aber bei Aristoteles erfuhren sie, dass die Menschen die Wahrheit selber finden können, wenn sie die Natur studieren. Der bekannteste dieser Mönche war der Engländer Roger Bacon. Er gehörte zu Europas größten Aristoteles-Experten, und er wurde wegen seiner fantastischen Prophezeiungen über das Ende der Welt berühmt.
Um das Jahr 1250 schrieb Roger Bacon: „Es ist möglich, Wagen herzustellen, die sich ohne Pferde bewegen und die von einer wundersamen Kraft angetrieben werden. Es ist möglich, Flugmaschinen zu bauen, bei denen ein Mann, der mitten in der Maschine sitzt, die Flügel zum Schlagen bringen kann.“ Man kann sich denken, dass viele Bacon für verrückt hielten.
Aber was den Anführern der christlichen Kirche Angst machte, waren Roger Bacons Vorstellungen von Forschung. Er war nämlich nicht nur ein Anhänger des Aristoteles, er fand außerdem, der Grieche sei nicht weit genug gegangen! Es reiche nicht aus, die Natur zu studieren, um Wissen zu erwerben. Die Menschen müssten auch durch Experimente zu neuen Erkenntnissen gelangen, schrieb Roger Bacon. Bei einem Experiment wird aktiv etwas mit der Natur gemacht, sie wird beeinflusst, und wir erfahren dadurch, ob unsere Annahmen wirklich zutreffen.
Bei einem Experiment kann man zum Beispiel ein kleines Modell der Natur herstellen und versuchen, mit seiner Hilfe eine Aussage über die ganze Natur zu machen. Ich werde das genauer erklären. Wenn man in einem Ruderboot sitzt, fällt einem auf, dass die Ruder, die ins Wasser ragen, in der Mitte einen Knick zu haben scheinen. Es sieht so aus, als wären sie gleich unterhalb der Wasseroberfläche verbogen. Wenn man die Ursache genauer untersuchen will, ist es reichlich mühselig, dabei die ganze Zeit in einem Boot zu sitzen. Man kann aber auch eine Schüssel mit Wasser füllen und einen Bleistift hineinhalten. Dann sieht man, dass auch der Bleistift einen Knick hat.
Schüssel und Bleistift sind ein Modell des Wassers in einem See und der Ruder, die man hineinhält. Es ist leichter, mit dem Modell zu arbeiten, und das, was man dabei lernt, gilt auch für die wirkliche Natur. Das war ein neuer Gedanke, und Roger Bacon hielt ihn für sehr wichtig. Er meinte, dass Forscher durch Experimente mehr Wissen erwerben als durch Beobachtung. Und eines Tages wissen sie dann genug, um eine Maschine zu bauen, die fliegen kann.
Wir können leicht verstehen, dass die meisten von Bacons Kollegen seinen Gedanken tiefes Misstrauen entgegenbrachten. Und Bacon hielt sich auch nicht an seine eigenen Worte. Vermutlich hat er nur wenige Experimente selbst ausgeführt. Das mit der Schüssel und dem Bleistift hat er allerdings wohl tatsächlich selbst ausprobiert. Roger Bacon hat nämlich sehr viel darüber geschrieben, wie Licht sich durch Wasser fortpflanzt.
Ihm war klar, dass ein Stock im Wasser deshalb einen Knick zu haben scheint, weil die Lichtstrahlen beim Übertritt von der Luft ins Wasser ihre Richtung ändern. Dieser Vorgang wird Lichtbrechung genannt. Bacon wusste auch, dass wir sehen, weil unsere Augen Lichtstrahlen erkennen. Wir sehen einen Bleistift, weil er die Lichtstrahlen zu unseren Augen reflektiert. Wenn die Lichtstrahlen ihre Richtung ändern, wie das im Wasser der Fall ist, dann ändert sich auch das Aussehen des Bleistifts.
Bacon wusste auch, dass Lichtstrahlen ihre Richtung ändern, wenn sie Glas durchdringen. Er war nicht der Einzige, der diese Entdeckung machte. Im 13. Jahrhundert war bereits vielfach bekannt, dass Lichtstrahlen sich in verschiedene Richtungen lenken lassen, wenn Glas auf unterschiedliche Weise geschliffen wird. Wenn eine runde Glasscheibe so geschliffen wird, dass sie in der Mitte am dicksten und an den Rändern am dünnsten ist, dann werden die Lichtstrahlen, die durch diese Scheibe gehen, so gebeugt, dass sie sich an einem Punkt hinter der Scheibe treffen. Wenn Sonnenlicht durch die Scheibe geht, wird dieser Treffpunkt glühend heiß. Deshalb wurde er Brennpunkt genannt. Da die geschliffenen Glasscheiben ähnlich aussahen wie das Gemüse Linsen, erhielten sie dessen Namen.
Im Jahr 1280 entdeckte der Italiener Salvina degli Armati, dass Glaslinsen mehr können, als nur das Sonnenlicht zu konzentrieren. Wenn wir älter werden, haben wir oft Probleme damit, Dinge in unserer nächsten Nähe zu sehen. Dieses Phänomen wird „Weitsichtigkeit“ genannt. Schuld daran ist die Tatsache, dass die Augen im Alter ihre Form verändern. Wenn aber vor ein weitsichtiges Auge eine Linse gehalten wird, kann es wieder scharf sehen. Armati hielt vor beide Augen eine Linse, befestigte sie an einer Art Rahmen, der auf der Nase ruhte, und hatte die Brille erfunden.
Unscharfe Sicht ist und bleibt eines der häufigsten Probleme, mit denen wir Menschen uns herumschlagen. Wer eine Brille trägt, weiß, wie wichtig diese Erfindung war. Das älteste Bild eines Brillenträgers zeigt einen Mönch, und das ist kein Zufall. Mönche lasen sehr viel, und früher mussten sie damit aufhören, wenn die Weitsichtigkeit einsetzte. Aber die Brille ermöglichte es ihnen, ihre Arbeit bis ins hohe Alter fortzusetzen.
Die neue Erfindung war bald sehr beliebt bei allen, die sich eine Brille leisten konnten. Die Brillenmacher, die Optiker genannt wurden, öffneten in den großen Städten Europas ihre Läden. Aber die Optiker erkannten schnell, dass sie nicht bei allen Weitsichtigen die gleiche Linse verwenden konnten. Manche Leute brauchten dicke Linsen, andere dünne. Außerdem gab es viele Menschen mit Sehschwächen, denen die Optiker nicht helfen konnten. Nämlich die, die weiter entfernte Dinge nicht klar erkennen konnten, die Kurzsichtigen.
Wenn ich als Kurzsichtiger eine Brille für Weitsichtige aufsetze, sehe ich noch weniger. In ganz Europa versuchten Optiker, dieses Problem zu lösen. Aber erst im 16. Jahrhundert gelang es ihnen, Linsen herzustellen, die Kurzsichtigkeit ausglichen. Diese Linsen waren in der Mitte dünn und an den Rändern dick.
Weil immer neue Patienten zu den Optikern kamen, die unterschiedliche Brillentypen brauchten, mussten die Optiker experimentieren. Die Optiker mussten also das tun, wozu die Wissenschaftler so wenig Lust hatten.
Das galt nicht nur für die Optiker. Um das Jahr 1300 entwickelten sich die Verhältnisse in Europa ziemlich gut. Die Städte wurden größer, die Bevölkerungszahlen wuchsen, Wälder wurden gerodet, um neuen Boden urbar zu machen, und neue Erfindungen wurden in Gebrauch genommen. Zwei der wichtigsten Erfindungen waren das Wasserrad und die Windmühle. Beide waren seit Jahrhunderten bekannt, erst jetzt aber erwiesen sie sich wirklich als nützlich. Vielerorts fehlte es an Arbeitskräften. Ein Wasserrad, das in einer Schmiede an eine Säge oder einen Blasebalg angeschlossen wurde, konnte die Arbeit von mehreren Menschen oder Tieren verrichten. Eine Windmühle drehte sich ganz von allein, und der Müller brauchte sie nur noch in Stand zu halten und Getreide nachzufüllen.
Die Maschinen mussten so gut wie möglich funktionieren, und deshalb wurden sie immer wieder verbessert. Deshalb gab es um diese Zeit die ersten Ingenieure, Fachleute für Maschinen und Technik. Für diese Erfindungen bezahlten häufig reiche Kaufleute, die noch reicher werden konnten, wenn sie noch effektivere Maschinen besaßen. Im belgischen Flandern gab es riesige Hallen, in denen mithilfe von Maschinen aus Wolle und Leinen Tuche hergestellt wurden. Die Hallen hatten große Ähnlichkeit mit modernen Fabriken. In England und Deutschland konstruierten Ingenieure Pumpen, um Bergwerksgänge trocken zu halten.
Es ist deutlich zu sehen, wie stark sich die griechische Gesellschaft und das Europa des Mittelalters voneinander unterschieden. Es gab zwar im Mittelalter noch Menschen, die ihre Arbeitskraft anderen zur Verfügung stellen mussten, und für Frauen waren noch immer die meisten Ausbildungswege versperrt, aber es war doch sehr viel üblicher, Kenntnisse über die Natur praktisch anzuwenden. Wissen war nicht nur spannend – mit Wissen ließ sich auch Geld verdienen. Italienische Kaufleute, die in Nordafrika mit den Arabern Geschäfte machten, hatten erfahren, wie sehr indische Zahlen das Rechnen erleichtern. Diese Kaufleute gründeten Banken, die Geld verliehen. Auf diese Weise wurden die indischen Zahlen zur Geheimwaffe der größten Banken und der reichsten Familien in einigen norditalienischen Städten.
Um diese Zeit setzte sich auch die Erkenntnis durch, dass Klöster nicht die beste Ausbildungsstätte für junge Menschen waren, die in der Gesellschaft tätig sein sollten. Im 12. Jahrhundert wurden deshalb in Städten wie Oxford und Cambridge, Bologna und Paris Universitäten gegründet.
Anfangs waren die Universitäten eine Art Kopie von Platons Akademie. Sie waren Orte, an denen reiche junge Männer Philosophie, Mathematik, Alchimie, Astronomie und Theologie (die Lehre von der christlichen Religion) studieren konnten. Die Studenten wurden von Professoren unterrichtet, Fachleuten für die verschiedenen Wissensgebiete. Das Wort Professor stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „dem Publikum etwas sagen“, und genau das war anfangs die Aufgabe der Professoren. Sie forschten nur selten, viel lieber diskutierten sie miteinander. Und zwar oft über die unglaublichsten Themen.
Zum Beispiel zerbrachen sich die Theologen damals den Kopf über die Frage, ob die Seele eines Mannes nach seinem Tod sofort gen Himmel fährt oder ob sie bis zum Jüngsten Gericht warten muss. Sie überlegten auch, ob Frauen überhaupt eine Seele hätten, und sie versuchten zu berechnen, wie viele Engel auf einer Nadelspitze Platz hätten. Die Diskussionen der Professoren waren oft entsetzlich kompliziert, und sie brachten lange, verwickelte Argumente vor.
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wenn wir versuchen, einer Fernsehdiskussion zu folgen, dann stellen wir oftmals fest, dass die Teilnehmer lauter komplizierte Wörter verwenden, um etwas zu sagen, das sich auch viel einfacher sagen ließe. Komplizierte Argumente können sehr hilfreich sein, wenn wir versuchen, einer unangenehmen Frage auszuweichen. Aber sie erschweren auch das klare Denken. Und klares Denken ist bei der Jagd nach der Wahrheit unbedingt nötig.
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts versuchte ein englischer Mönch, daran etwas zu ändern. Er hieß Wilhelm von Ockham und studierte an der Universität Oxford Theologie. Dabei legte er sich so heftig mit seinen Professoren an, dass er von der Universität flog, ehe er seine Ausbildung beendet hatte. Für den Rest seines Lebens wanderte er von einem Kloster zum andern und schrieb Bücher, die großes Aufsehen erregten.
Wilhelm von Ockham war natürlich ein Christ, und viele seiner Schriften handeln von Gott. Aber er interessierte sich auch für die Logik, wie Aristoteles sie beschrieben hatte (vgl. S. 26). Er vertrat die Ansicht, die Menschen müssten ihre Vernunft gebrauchen und sich auf ihre Sinne verlassen, wenn sie verstehen wollen, was in der Welt passiert. Vor allem wollte er etwas gegen die komplizierten Diskussionen unternehmen, die in Klöstern und an Universitäten so beliebt waren. Deshalb stellte er eine Regel auf, um das Leben für Diskussionsteilnehmer und für Menschen, die verstehen wollen, was andere sagen, leichter zu machen.
Die Regel lautete ungefähr so: „Wenn man etwas beweisen will, dann beschränkt man sich auf die wirklich notwendigen Argumente.“ In der Wissenschaft ist ein Argument oft etwas, was ein Forscher beobachtet hat, es kann sich um eine mathematische Berechnung oder um das Ergebnis eines Experiments handeln. Oft können sehr unterschiedliche Dinge darauf hinweisen, dass der Forscher Recht hat. Und dann ist es wichtig, alles Überflüssige zu streichen, damit er und die Menschen, die seine Berichte lesen, nicht verwirrt werden.
Wichtig ist das, was ein Wissenschaftler sagen will, nicht, ob er es auf eine besonders ausgefeilte Weise sagt. Ockhams Regel ist noch immer eine große Hilfe bei der Jagd nach der Wahrheit. Studenten lernen sie an der Universität, Forscher wenden sie immer wieder an. Die Regel ist auch als „Ockhams Rasiermesser“ bekannt. Rasiermesser sind scharf, und Wilhelm von Ockham schnitt mit dieser Regel bei Diskussionen alles Überflüssige ab. Kein Wunder, dass er nicht sehr beliebt war!
Wilhelm von Ockham starb zwischen 1347 und 1350 im Alter von rund 65 Jahren in München. Es war kein Zufall, dass er gerade zu dieser Zeit starb, denn zu diesem Zeitpunkt erlagen in ganz Europa Millionen von Menschen einer Krankheit, die der „schwarze Tod“ oder die „Pest“ genannt wurde. Damals wusste niemand, wie diese Krankheit entstand. Die Menschen wussten nur, dass Kranke mit schwarzen Beulen am ganzen Leib und hohem Fieber fast immer zum Tode verurteilt waren. Ein Drittel der Bevölkerung Europas fiel dem schwarzen Tod zum Opfer, wie auch Millionen von Menschen in anderen Erdteilen. Der Pest war es egal, ob jemand arm oder reich war, und die damaligen Ärzte konnten nur zusehen, wie ihre Patienten starben. Auch Gebete, zu denen die Priester rieten, brachten keine Hilfe.
Man stelle sich vor, ein Drittel aller Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung stirbt innerhalb weniger Wochen. Einer von drei Menschen im Haus, wo wir wohnen, in der Straße, der Schule oder der Familie. Was wäre das für ein Gefühl, überlebt zu haben? Was spielte sich nach einer derart einschneidenden Katastrophe in den Köpfen der Menschen ab? Da es damals noch keine Meinungsumfragen oder Zeitungen gab, wissen wir nicht, wie die einfachen Menschen reagiert haben. Aber vielleicht haben damals viele ihren Glauben an Gott verloren.
Das kann jedenfalls eine Erklärung für die seltsame Entwicklung sein, die in Italien einsetzte, nachdem die Pest abgeklungen war. Man sollte eigentlich annehmen, dass eine solche Katastrophe die Gesellschaft vollständig zerstört. Zahllose Bauern und Arbeiter waren umgekommen, Kinder hatten ihre Eltern, Klöster und Universitäten viele ihrer fähigsten Gelehrten verloren. Nach einigen Jahrzehnten jedoch, als die Lage sich endlich wieder stabilisiert hatte, machte sich eine erstaunliche Veränderung bemerkbar.