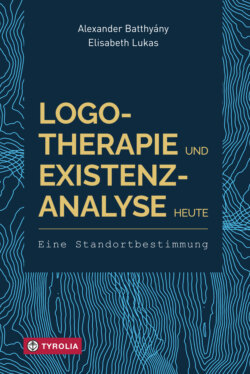Читать книгу Logotherapie und Existenzanalyse heute - Elisabeth Lukas - Страница 10
3. EINE STÄRKE DES MENSCHEN: ANDERE MENSCHEN
ОглавлениеBatthyány: Das ist ein wertvoller Denkanstoß. Im Grunde geht er nämlich einen erheblichen Schritt weiter als Frankls Glücksbestimmung: Nicht nur ist Glück, was einem erspart geblieben ist. Es birgt auch zusätzlich einen „gesonderten“ Auftrag zur Selbsttranszendenz, also zum Blick über den Tellerrand des eben nicht nur bedürftigen, sondern auch dankbaren, großzügigen, wohlwollenden und zum Teilen bereiten Ichs.
Dazu fällt mir eine wissenschaftliche Arbeit ein, die in einem der von der American Psychological Association herausgegebenen Sammelbände zur sogenannten „Positiven Psychologie“ erschienen ist.7 In diesem Band wurde vermessen, welche Stärken und Möglichkeiten im Menschen brachliegen – das ist ja das Programm der „Positiven Psychologie“. Viele Autoren, darunter einige der heute bekannteren psychologischen Forscher, versuchten sich an dem Thema. Man kommt allerdings nicht umhin, kritisch anzumerken: So schön an und für sich das Projekt der Positiven Psychologie auch sein mag, so sehr waren viele der Autoren allzu forciert optimistisch und erlagen daher der Versuchung, die Psychologie in ein fortwährendes Selbstoptimierungsprojekt und in weiterer Folge menschliches Leben insgesamt in ein überaus ambitioniertes „Glücksprojekt“ abgleiten zu lassen, in dem das Bewusstsein von Leid und Mangel und die tragische Trias aus Leid, Schuld und Tod (und paradoxerweise daher auch die Dankbarkeit) – oder auch nur das Anerkennen und Gutseinlassen des eben auch einmal Nichtvollkommenen – keinen rechten Platz haben. Der Perfektionismus fortwährender Selbstverwirklichung und -verbesserung und des immer Positiven nimmt da manchmal durchaus beklemmende Dimensionen an und ist angesichts des globalen Leids auch moralisch fragwürdig und schlichtweg unrealistisch. Wir werden noch im Laufe dieser Gespräche darauf kommen, warum und in welcher Hinsicht es einer so einseitigen Gewichtung und Überbetonung des Positiven an einem vernünftigen, reifen und gesunden Realismus mangelt – und auch, wie kostspielig sie psychologisch sein kann, wenn es etwa um Leidbewältigung und Mitgefühl und Frustrationstoleranz geht.
Aber ein einzelner Artikel stach aus dem erwähnten Sammelband heraus. Die bedeutende amerikanische Sozialpsychologin Ellen Berscheid von der Universität Minnesota beschrieb darin mit beeindruckender Feinfühligkeit die „größte Stärke des Menschen: andere Menschen“8. Berscheid machte daran sogar einen der wesentlichen Faktoren kultureller und sozialer Entwicklung fest.
Was Sie eben über generalisierte Einstellungswerte und die „samariterhafte Einstellung“ gesagt haben, kann man somit auch ausdehnen nicht nur auf zu teilende Güter, sondern auch für Fähigkeiten in Stellung bringen, die sich einsetzen lassen, um einander zu helfen, um füreinander da zu sein, und sich einzubringen. Das setzt nämlich erstens die Anerkennung der Bedürftigkeit des Menschen voraus (verschließt also nicht mehr die Augen vor dem Leiden oder den Nöten der Menschen), zweitens behält es aber auch den Wert der gegenseitigen Hilfsbereitschaft im Blick.
Bildlich gesprochen: Der Blinde kann den Lahmen tragen und der Lahme den Blinden führen, und beide bezeugen damit ja viel mehr als nur die Fähigkeit des Menschen, ihre jeweiligen Schwächen zu kompensieren. Sie bezeugen damit eben auch, dass andere Menschen – und unsere Bereitschaft, unsere Fähigkeiten mit ihnen zu teilen und in den Dienst des anderen zu stellen – tatsächlich eine der größten Stärken des Menschen sind. Zweitens werden diese Fähigkeiten ja erst dann ihrer eigentlichen sinnvollen Bestimmung zugeführt – davor waren es ja bloß Möglichkeiten. Nun aber, im Einsatz für und mit etwas oder jemand, der oder das nicht wieder man selbst ist, werden sie sinnvoll genutzt und verwirklicht.
Aber dieser Zusammenhang zeigt auch etwas noch Grundsätzlicheres über die Natur selbst. Man kann das auch philosophisch deuten und dann entfalten sich sehr schöne und tröstliche Implikationen für unser Welt- und Menschenbild: dass nämlich mit der Person, vor allem ihrem Potential zur Selbsttranszendenz, etwas in die Welt getreten ist, in dessen Hand sogar die Schwäche noch Zeugnis von Stärke werden kann.
Um zum Blinden und dem Lahmen zurückzukommen: Wir kennen aus der Natur zwar zahlreiche Beispiele der Symbiose und des biologischen Gleichgewichts und des gegenseitig Angepasstseins von Wirtstieren etc. – das ist ja gleichsam das „Erfolgsrezept“ der Natur: Zusammenarbeit und Ineinanderwirken.
Aber das, was Sie mit der „samariterhaften Einstellung“ beschreiben, geht weit darüber hinaus. Es ist uns im Unterschied zum Tier stets nur als Möglichkeit, also im Freiraum, gegeben. Das Teilen und die Großzügigkeit ist beim Menschen eben nicht, wie beim Tier, triebhaft vorbestimmt. Nichts treibt uns zur Großzügigkeit an. Mit anderen Worten: Im Menschen ist Teilen nicht einfach ein biologisches Programm, das automatisch abläuft, sobald wir irgendwo ein Defizit erblicken. Es ist etwas viel Wertvolleres: nämlich Ausdruck genuinen Wohlwollens – also ein Akt in Freiheit und Verantwortung bzw. der Akt in der Freiheit, wohlwollend und Anteil nehmend zu leben – oder eben nicht.