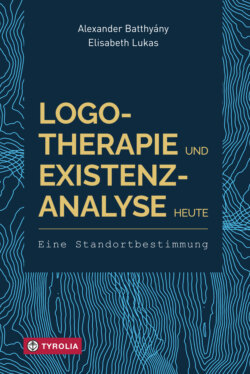Читать книгу Logotherapie und Existenzanalyse heute - Elisabeth Lukas - Страница 15
II. ZUR PSYCHOLOGISCHEN BEDEUTUNG REALISTISCHER MENSCHENBILDER 1. UNSER SELBSTBILD UND SEINE AUSWIRKUNGEN
ОглавлениеBatthyány: Wir sprachen zuletzt von der Not als Lehrmeister … es gibt aber auch noch andere und weitaus weniger glaubwürdige Lehrmeister, die unser Welt- und Menschenbild jedoch maßgeblich prägen. Es sind Lehrmeister, denen zugleich oft viel mehr und lieber Gehör geschenkt wird als der eigenen Not oder der Not der anderen. Ich denke da insbesondere an die Rolle der Wissenschaft, vor allem auch der Psychologie, bei der Prägung unseres Menschenbilds.
Wir beobachten ja in den letzten Jahren eine erneut entfachte breite Diskussion über die Grundfragen und das Wesen des Menschseins, wie sie in dieser Intensität vielleicht zuletzt zu Zeiten Darwins oder Freuds stattgefunden hat. Diese Entwicklungen hängen eng zusammen mit den Fortschritten der Neurowissenschaften, vor allem aber auch ihrer Popularisierung und Vereinfachung auf einen blanden Materialismus und Determinismus durch die populärwissenschaftlichen und Massenmedien. Auf die Materialismusdebatte brauchen wir hier jetzt nicht einzugehen – das würde ein eigenes Buch füllen und auf uns warten ja noch viele andere Themen, die besprochen werden wollen. Diejenigen, die sich für das Materialismusproblem interessieren und zu diesem Themengebiet nach Antworten suchen, finden aber ohnehin bereits eine Menge hervorragender Abhandlungen zu diesem Thema.22
Aber zum Determinismus gibt es einiges zu sagen – auch deswegen, weil es dazu einige empirische Befunde gibt, die uns in diesem Zusammenhang aus mehreren Gründen interessieren sollten. Sie belegen nämlich erstens den starken und direkten Zusammenhang zwischen dem, was wir tun, und dem, was wir über uns und den Menschen denken und glauben – bzw. ihm und uns zutrauen. Zweitens zeigen sie aber auch, dass ein doch erheblicher Teil unseres Verhaltens durch unsere Einstellungen änderbar ist. Und drittens – etwas weiter gedacht – zeigen sie daher auch: Wenn Einstellungen dauerhaft änderbar sind, ist auch Verhalten dauerhaft änderbar. Das ist vielleicht auch für all jene eine gute Botschaft, die sich immer wieder das Versprechen abnehmen, „von jetzt an anders zu handeln“, dann aber doch immer wieder rückfällig werden und nach einer Weile feststellen müssen, dass der bloße Vorsatz, etwas von nun an anders zu machen, noch lange nicht ausreicht, um diesen Vorsatz auch wirklich tätig umzusetzen. Die Forschung zeigt ebenso wie die Lebenserfahrung der wohl meisten: Eine zusätzliche Zutat ist vonnöten – und diese Zutat scheint nun ganz grundlegend die jeweilige Einstellung zu sein, und hierbei vor allem unser Selbst- und Menschenbild: Ermutigt es uns, frei und proaktiv von unseren Möglichkeiten Gebrauch zu machen – oder entmutigt es uns und stempelt es uns zum Opfer unserer inneren und äußeren Bedingtheiten ab?
Um das konkreter auszuführen: Jemand, der sich und sein Verhalten für weitgehend abhängig von Innen- und Außenzuständen betrachtet, wird vermutlich gar nicht erst – oder weniger intensiv – versuchen, seinen Bedingtheiten gegenüber Stellung zu beziehen.23 Das klingt nun zunächst sehr einfach und naheliegend – aber wie eng dieser Zusammenhang wirklich ist, belegen einige Experimente über die Wechselwirkung von Selbstbild und Handeln, die von Verhaltensforschern in den letzten Jahren durchgeführt worden sind.
Die Experimente folgten im Prinzip zumeist demselben Schema. Man nahm eine zufällige Stichprobe und teilte sie in zwei Gruppen ein. Beide Gruppen bekamen – unter irgendeinem Vorwand – einen Text zu lesen. Der Text der ersten Gruppe argumentierte in ziemlich überzeugender Weise dafür, dass der Mensch vollständig durch seine Innen- und Außenumstände determiniert sei („nicht anders könne“). Der anderen Gruppe wurde in ebenso überzeugender Weise dargelegt, der Mensch sei zwar in Maßen bedingt, aber es käme vor allem auf seine eigenen frei gewählten Entscheidungen an, wie er sich verhalte; der Mensch sei daher in relevanter Weise willensfrei („er könne stets auch anders“).
Für gewöhnlich verbirgt man in solchen Studien die wissenschaftlichen Hintergrundabsichten vor den Versuchspersonen, damit man Erwartungseffekte, Verfälschungen und Ähnliches möglichst ausschließen kann. So auch hier. Das Ziel war ja, die reine, unmittelbare Wirkung des Glaubens oder Unglaubens an die eigene Willensfreiheit auf das Verhalten des Menschen zu untersuchen. Zu diesem Zweck gab es eine sogenannte Coverstory. Bei den erwähnten Experimenten ließ man die Versuchspersonen glauben, sie würden an einer Reihe mehrerer kleiner Einzelstudien teilnehmen, die nichts miteinander zu tun hätten. Von der ersten Studie wurde den Versuchspersonen mitgeteilt, sie teste das Verhältnis von Textverständnis und Texterinnerung. Die Versuchspersonen bekamen je nachdem, welcher Versuchsgruppe sie (zufällig) zugeteilt wurden, einen vermeintlich brandneuen Artikel einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu lesen, in dem von angeblich definitiven und revolutionären Forschungsergebnissen berichtet wurde, denen zufolge nun wissenschaftlich zweifelsfrei erwiesen sei, menschliches Verhalten sei vollständig determiniert (für die „unfreie Gruppe“) bzw. nicht determiniert, sondern stünde im Einflussbereich der bewussten Entscheidungsfähigkeit der Person (für die „freie Gruppe“). Natürlich waren beide Artikel fiktiv, aber den Versuchspersonen verriet man dies nicht. Sie glaubten, dass sie gerade eine grundlegende wissenschaftliche Stellungnahme für oder gegen die eigene Willensfreiheit gelesen hätten.
Nach dem Stellen einiger für die eigentliche Forschungsabsicht unwichtiger Testfragen wurde dieser Teil der Studienreihe für beendet erklärt und die Versuchspersonen wurden auf das nächste Experiment vorbereitet. Dieses war dann das entscheidende Experiment, diente also der eigentlichen experimentellen Überprüfung der Frage, wie sich der Glaube an einen Pandeterminismus oder an die eben doch vorhandene Willensfreiheit auf das Alltagsverhalten der Versuchspersonen auswirke. So sollten die Probanden in einem dieser Folgeexperimente24 z. B. einige Rechenaufgaben im Kopf lösen. Die Anweisung lautete: Auf einem Computermonitor würden nacheinander 20 mathematische Probleme präsentiert werden, die mit etwas Geduld und Ausdauer durch Kopfrechnen zu lösen seien (1+8+18+12+19-7+17-2+8-4=? etc.). Die Versuchspersonen sollten die Lösungen auf einem bereitgestellten Blatt Papier notieren.
Jedoch merkte der Versuchsleiter entschuldigend an, dass aufgrund eines Programmierfehlers die richtige Lösung einige Sekunden nach Präsentation der Aufgabe automatisch auf dem Monitor aufscheinen würde. Das sei nicht gewollt – und er bat die Versuchspersonen um ihre Mithilfe: Sie sollten kurz, nachdem die Aufgabe auf dem Monitor erschien, die Leertaste der vor ihnen liegenden Tastatur drücken – damit könnten sie unterbinden, dass die Lösung auf dem Bildschirm präsentiert werde. Der Versuchsleiter betonte, dass er zwar nicht nachprüfen könne und werde, ob und wie oft die Versuchsteilnehmer die Leertaste drückten, um das automatische Aufscheinen der Lösung zu verhindern. Aber er bat sie inständig darum, nicht zu mogeln und die mathematischen Probleme wirklich selbständig zu lösen – also nicht einfach ohne Drücken der Leertaste darauf zu warten, dass die Lösung erscheine. Andernfalls wären die Versuchsergebnisse wertlos und die langen und aufwendigen Vorbereitungsarbeiten vergeblich gewesen.
Daraufhin verließ der Versuchsleiter unter irgendeinem Vorwand den Raum; die Versuchspersonen fühlten sich also unbeobachtet und sich selbst überlassen. In Wahrheit registrierte der Computer aber natürlich, wie oft die Studienteilnehmer die Leertaste drückten bzw. wie oft sie warteten, bis die Lösung von alleine erschien.
Die Versuchspersonen hatten somit die Gelegenheit, die frustrierend langweiligen Rechenaufgaben deutlich bequemer hinter sich zu bringen, indem sie einfach nicht die Leertaste drückten und lediglich darauf warteten, bis die Lösungen auf dem Monitor aufleuchteten. Auf diese Weise wurde ein direkter Konflikt zwischen lust- und unlustbestimmtem Verhalten einerseits und rücksichtsvollem und im weitesten Sinne wertorientiertem Verhalten andererseits herbeigeführt. Es wurde mit anderen Worten eben jene Verleitungs- oder Versuchungssituation provoziert, der der ichschwache Mensch so häufig erliegt mit der Begründung, „nicht anders gekonnt zu haben“.
Ziel des Experiments war es, zu untersuchen, ob es in einer solchen Situation einen Unterschied ausmache, ob die Teilnehmer zuvor davon überzeugt worden waren, dass sie willensfrei bzw. willensunfrei seien. Und tatsächlich zeigte sich ein höchst signifikanter Effekt des recht kurzen Überzeugungstextes: Die Versuchspersonen, denen zuvor glaubhaft gemacht worden war, sie seien „unfrei“, drückten wesentlich seltener die Leertaste (in 48 % aller Fälle) – schummelten also signifikant häufiger als die Versuchsteilnehmer, denen zuvor ihre Freiheit zugesichert und bestätigt worden war. Diese drückten in durchschnittlich 70 % der Fälle die Leertaste. Oder anders formuliert: Die sich unfrei denkenden Versuchspersonen schummelten durchschnittlich bei 52 % der Rechenaufgaben, die sich frei denkenden Versuchspersonen bei durchschnittlich nur 30 %. Zudem zeigte sich eine starke positive Korrelation zwischen dem Glauben an die menschliche Willensfreiheit und ehrlichem Verhalten. Je erfolgreicher die Manipulation also war (d. h. je eher die Versuchspersonen dem jeweiligen Text Glauben schenkten), desto stärker war der hier beschriebene Effekt.
Dieser Versuchsaufbau wurde mittlerweile in unterschiedlichen Variationen und Testkonstellationen wiederholt – mit immer demselben eindeutigen Ergebnis. Es zeigte sich u. a., dass Menschen, die nicht an ihre eigene Entscheidungsfreiheit glauben, signifikant aggressiver handeln gegenüber unbekannten Personen, von denen ihnen zuvor – in einer wiederum kontrollierten Laborsituation – mitgeteilt worden war, dass sie sie als Spielpartner für einen weiteren Test abgelehnt hätten (Prinzip: „Wie du mir, so ich dir“). Es zeigte sich, dass sie allgemein weniger zuvorkommend sind (Prinzip: „Das können andere machen, ich bin mit meinen eigenen Sachen beschäftigt. Ich habe nichts davon, andere zu unterstützen“). Es zeigte sich, dass sie sich in Gruppensitzungen sogar wider besseres Wissen angepasster verhalten (Prinzip: „Mir ist wichtig, was andere über mich denken. Ich brauche ihre Anerkennung, weil ich mich dann besser fühle. Also stimme ich ihrem Urteil zu, obwohl ich es eigentlich nicht teile“). Es zeigte sich, dass sie weniger kooperativ sind, wenn es darum geht, auf Bitte des Versuchsleiters freiwillig einige Minuten länger als nötig an einer Aufgabe zu arbeiten (Prinzip „Was kümmert mich der andere, wenn es um mich geht?“). Und es zeigte sich, dass sie weniger hilfsbereit sind, wenn dem Versuchsleiter scheinbar versehentlich ein paar Utensilien aus der Hand fallen.25
Einige dieser Experimente haben wir mit meiner Forschungsgruppe an der Universität Wien wiederholt, und es ist, wenn man es mit eigenen Augen verfolgt, wirklich verblüffend, wie stark eine derart kurze „Intervention“ – das Lesen eines persuasiven Textes – über den Umweg des dadurch geänderten Menschen- und Selbstbilds sich auf das Verhalten der Versuchspersonen auszuwirken vermag. Wir haben allerdings weniger die problematischen Auswirkungen des Glaubens an den Pandeterminismus untersucht, als vielmehr die aufbauenden und positiven Auswirkungen des wieder erstarkten Glaubens an die eigene Willensfreiheit.26 Auch hier waren die Effekte stark (und durchaus heilsam etwa bei Prokrastination und ängstlichem Vermeidungsverhalten). Kurzum, die Forschungsergebnisse bestätigen, dass es einen erheblichen und messbaren Unterschied ausmacht, was Menschen über sich denken und von sich glauben. Und dass dasjenige, was sie über sich glauben, zugleich relativ leicht zu beeinflussen ist. Man braucht den Leuten beispielsweise nur glaubhaft mitzuteilen, es sei „wissenschaftlich erwiesen, dass …“, und dann reicht schon ein wenige Paragraphen umfassender Text, um ihr Selbst- und Menschenbild und über diesen Faktor ihr (moralisch relevantes) Verhalten zu beeinflussen.
Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem weitaus umfassenderen Datensatz ähnlicher Versuchsergebnisse, die insgesamt die logotherapeutische Aussage bestätigen, es gebe einen ausschlaggebenden und zentralen Zusammenhang zwischen Menschenbild, Selbstbild und Verhalten: Sie zeigen, wie stark der Einfluss unseres Menschenbilds auf das Bild ist, das wir von uns selbst abgeben.
Ferner machen diese Befunde aber auch deutlich, wie hoch die Verantwortung der Psychologen und Verhaltenswissenschaftler und Therapeuten ist, wenn sie Theorien und Modelle über „den“ Menschen in Umlauf bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich im Klaren darüber sind, dass ihre Theorien und Modelle in der allgemeinen Öffentlichkeit schnell als „wissenschaftlich fundierte Wahrheit“ aufgefasst werden – und seien sie noch so unausgegoren, spekulativ, fraglich oder weltanschaulich voreingenommen … und welchen Schaden sie auch anzurichten vermögen.
Lukas: Die Schlussfolgerungen aus den erwähnten Experimenten sind in der Tat brisant, fast ein bisschen beängstigend. Bleibt zu hoffen, dass die beteiligten Versuchspersonen nach Beendigung der von Ihnen beschriebenen Experimente darüber aufgeklärt worden sind, dass die ihnen vorgelegten Artikel pro oder kontra die Willensfreiheit frei erfunden gewesen sind und keinerlei „definitiven und revolutionierenden Forschungsergebnissen“ entsprochen haben. Man hat ihnen hoffentlich im Nachhinein gestanden, dass sie belogen worden sind.
Meines Erachtens wäre ein aufrichtiges und die Sichtweise zurechtrückendes Endgespräch mit jedem einzelnen Probanden die Mindestpflicht der Versuchsleiter gewesen.
Batthyány: Ja, eine ausführliche nachträgliche Aufklärung („debriefing“) ist sogar vorgeschrieben in den Ethikrichtlinien für psychologische Experimente im Allgemeinen und insbesondere für solche, in denen die Versuchspersonen durch die Versuchsleiter bewusst getäuscht worden sind.
Lukas: (Wollte man den „advocatus diaboli“ spielen, könnte man überlegen, ob es „ehrwürdiger“ ist, zu wissenschaftlichen Zwecken zu mogeln – wie die Versuchsleiter – als zu Bequemlichkeitszwecken zu mogeln – wie manche Versuchspersonen –, aber auf dieses schlüpfrige Parkett will ich mich nicht begeben.)
Vom psychologischen Standpunkt aus fällt die ganze Chose unter die Dachkategorie der Suggestionen, deren Wirkungen seit Urzeiten bekannt sind. Im Negativen ist ein riesiger Bogen um sie zu machen. Was hat zum Beispiel allein die Vermutung, ein „unerwünschtes Kind gewesen zu sein“, schon an Unfug gestiftet, um nur ein winziges Detail aus den vielen problematischen Deutungen herauszugreifen, die das Leben eines Menschen vergiften können. Trotzdem wird die Frage des ursprünglichen Erwünschtgewesen-Seins nicht selten bei Anamnesen in psychologischen Praxen diskutiert. Im Positiven bedienen sich sämtliche „Wunderheiler“ seit der Antike der Suggestion. Selbst Frankl ist nicht davor zurückgeschreckt, sie gelegentlich für seine Zwecke einzuspannen.27
Darf ich Ihre Erläuterungen noch dahingehend ergänzen, dass jede Einflussnahme sowohl auf das Selbstbild als auch auf das Menschenbild einer Person äußerst behutsam und verantwortlich zu handhaben ist. Bei den obigen Experimenten ging es um Einflüsse auf das Selbstbild. Doch auch, was wir über andere Menschen glauben, welches Bild wir uns von (speziellen?) anderen machen, bestimmt entscheidend mit, wie wir jenen anderen begegnen. Hierzu ein irrwitziges Detail aus meiner Studienzeit:
Die 1960er Jahre waren die Jahre unzähliger Rattenexperimente in den Psycholabors. Eine der Anordnungen bestand darin, dass eine Ratte von einem Podest, auf das sie gesetzt wurde, zu einem zweiten Podest nur über ein elektrisch aufgeladenes Gitter gelangen konnte, dessen Überquerung ihr heftige Schmerzen bereitete. Warum sollte sie also über das Gitter laufen? Na, weil sich dort etwas Verlockendes befand. Im ersten Versuch setzte man ein hübsches Weibchen auf das zweite Podest. Das Männchen auf dem ersten Podest sah zwar begehrlich hinüber, verkniff sich aber den schmerzhaften Weg zu seiner Geschlechtspartnerin. Im nächsten Versuch bestückte man das zweite Podest mit duftender Nahrung. Die ausgehungerte Ratte auf dem ersten Podest lief zuckend und quietschend hinüber, um sich zu sättigen, aber als man sie sogleich wieder zurückversetzte, blieb sie hocken. Der Hunger war ihr doch lieber als der Schmerz. Im nächsten Versuch legte man ein Rattenjunges auf das zweite Podest und beobachtete die Rattenmutter auf dem ersten Podest. Was würde sie tun? Sie lief über das elektrisch aufgeladene Drahtgitter zu ihrem Jungen. Man setzte sie zurück, und wiederum lief sie zu ihrem Jungen. Man erhöhte die Stromstärke im Gitter, und wiederum lief sie zu ihrem Jungen. Sie lief so lange, bis sie tot war.
Mir ist dieses Experiment – gegen das heutzutage die Tierschützer vehement protestieren würden – in Erinnerung geblieben, weil es mich zutiefst ergriff. Umso eigenartiger aber war der Kommentar der damaligen Professorengilde. „Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass der Muttertrieb der stärkste Trieb ist, stärker noch als der Sexualtrieb oder der Nahrungstrieb. Alles, was Ihre Mütter folglich jemals für Sie getan haben, haben sie getan, um ihren eigenen stärksten Trieb zu befriedigen …“
Wir Studenten lachten – aber war es zum Lachen? War nicht mit wenigen Sätzen unser bisheriges Mutterbild umgestülpt, wenn nicht gar entwertet worden? Ach, wie gut, dass ich später in Frankls Vorlesung gestolpert bin! Dort erfuhr ich postwendend, dass es sich bei dem Professorenkommentar um eine unzulässige Projektion aus der menschlichen Dimension, in der sich so etwas wie selbstlose Mutterliebe findet, in die tierische Ebene der Triebe und Instinkte handelte – und mein Mutterbild war wieder okay.