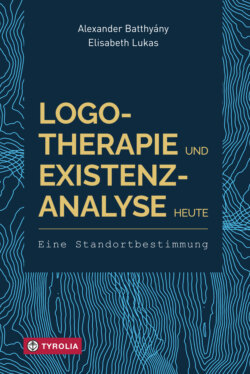Читать книгу Logotherapie und Existenzanalyse heute - Elisabeth Lukas - Страница 14
7. NOT UND EHRFURCHT
ОглавлениеBatthyány: Wenn wir nun den Weg von der Diagnose zur Therapie gehen wollten: Wie könnte ein solcher Ihrer Meinung nach aussehen?
Lukas: Schwer zu sagen. Ich weiß, in unserem Beruf gibt man sich mit diagnostischen Erwägungen nicht zufrieden. Man fragt sich sofort: Was wären denn Richtlinien für eine Therapie von Cyberkranken? Alle Logotherapeuten sind gut beraten, sich künftig intensiv mit dieser Frage zu beschäftigen. Überlegen wir: Gibt es einen Hinweis, den uns Frankl dazu hinterlassen hat? Er schrieb:
So ist die Zielsetzung der kollektiven Neurose dieselbe wie die der individuellen: Sie gipfelt und mündet aus in den Appell an das Verantwortungsbewusstsein … Wollen wir also unsere Patienten zum Bewusstsein ihres Verantwortlichseins bringen … dann müssen wir versuchen, uns den geschichtlichen Charakter des Lebens und damit die menschliche Verantwortung im Leben zu vergegenwärtigen … Dem Menschen … empfehle man zum Beispiel, einmal so zu tun, als ob er an seinem Lebensabend in seiner Biographie blätterte …18
Frankl führte an dieser Stelle aus, dass alle Details unverrückbar in den Abschnitten der eigenen Lebensvergangenheit festgeschrieben sind. Könnte man rückblickend eines davon ausradieren und verbessern, würde man das wohl oft gerne tun. Doch dieser Wunsch bleibt uns auf ewig versagt. Wie wäre es darum, schon während des Schreibens sorgsam darauf zu achten, dass die Details, die sich da verewigen, uns am Ende unseres Lebens nicht leidtun?19
Batthyány: Darf ich hier kurz einhaken – ich berichtete davon auch andernorts20, aber es passt so gut hierher, dass ich kurz davon erzählen möchte, wie mir eine ältere Deutschlehrerin in einem Hospiz eben diese Einsicht schilderte, obgleich sie Frankls Werk kaum kannte (außer sein Buch … trotzdem Ja zum Leben sagen). Wir trafen uns im Garten des Hospizes, in dem sie nun, schwerst herzkrank, ihre letzten Lebenstage verbrachte. Da saßen wir also unter einem schönen alten Apfelbaum und sie erzählte von ihrem Leben und war alles in allem recht versöhnt mit sich, ihrem Leben und auch ihrem baldigen Sterben. Dann fielen die Worte, die direkt anknüpfen an das, was Sie gerade zitiert haben. Sie sagte nämlich, dass ihre Lebensgeschichte nun zu Ende ginge, dass ich aber, als vergleichsweise junger Mensch, gut an mein Werk gehen solle – dass ich heute die Verantwortung tragen würde für das, was einmal in meiner Lebensgeschichte stehen werde. Es ist nicht leicht, die dichte und zugleich ungemein friedliche Atmosphäre dieses Gesprächs an einem Frühsommermorgen im Hospiz einzufangen. Aber ich muss sagen: Dieses Gespräch ist nun schon einige Jahre her, aber es ist seither eigentlich kaum ein Tag vergangen, an dem ich nicht an diese Worte denken musste.
Das Interessante aber ist: Frankl hat – und das schließt wieder an das Zitat an, das Sie soeben brachten – diesen Blick auf die eigene Endlichkeit und das Verdichten der eigenen Entscheidungen und Handlungen zur jeweils individuellen Lebensgeschichte ja auch therapeutisch als Weg der Vermittlung von Lebensverantwortung wie folgt vorgestellt:
Wir weisen den Kranken an, sich vorzustellen, sein Lebensablauf wäre ein Roman und er selbst eine entsprechende Hauptfigur; es läge dann aber ganz in seiner Hand, den Fortgang des Geschehens von sich aus zu lenken, sozusagen zu bestimmen, was im nächsten Kapitel zu folgen hat. Dann wird er statt der scheinbaren Last der Verantwortung, die er scheut und vor der er flüchtet, seine wesenhafte Verantwortlichkeit im Dasein als Freiheit der Entscheidung gegenüber seiner Unzahl von Möglichkeiten des Handelns erleben.
Noch intensiver können wir schließlich an den persönlichen Einsatz seiner Aktivität appellieren, wenn wir ihn dazu auffordern, sich vorzustellen, er sei an einem Endpunkt seines Lebens angelangt und im Begriffe, seine eigene Biographie zu verfassen; und eben jetzt halte er gerade bei jenem Kapitel, das von der Gegenwart handelt; und es liege nun, wie durch ein Wunder, ganz in seiner Hand, Korrekturen vorzunehmen; er dürfe gerade noch das, was unmittelbar darauf geschehen solle, ganz frei bestimmen … Auch das Vehikel dieses Gleichnisses wird ihn zwingen, aus dem Vollen seiner Verantwortlichkeit heraus zu leben und zu handeln.21
Nun, dass jemand, der so kurz vor dem eigenen Ende steht wie die oben erwähnte ältere Dame, diese Einsicht gewinnt, lebt und weitergibt, ist eine Sache. Eine andere ist es, mitten im Leben im Blick auf die eigene Endlichkeit einen Anstoß zur Verantwortung zu entdecken. Das hat etwas durchaus Drastisches an sich …
Lukas: Ja, Frankl fuhr schweres Geschütz auf. Er schlug vor, die Patienten mit ihrer Endlichkeit zu konfrontieren und ihnen ihre Lebensverantwortung von der Warte des Todes aus ans Herz zu legen. In seiner Genialität hat er wieder einmal exakt den Punkt getroffen. Ich gebe zu: Ich habe immer Widerwillen verspürt, wenn die Suchtprofis erklärten, „es müsse den Süchtigen erst miserabel genug gehen“, bevor sie sich zur Therapie aufraffen. Aber es stimmt, so traurig es ist. Wenn die Wahrnehmung des „Sinndrucks“ schwindet, hat der „Leidensdruck“ noch eine allerletzte Chance. Ähnlich operierte Frankl angesichts der Problematik pathologischer Zeitströmungen. Vom Faktum des Todes aus beleuchtet, ändern sich die Präferenzen. Deswegen möchte ich, was Präventiv- und Therapiemöglichkeiten betrifft, die Reihenfolge der aufgelisteten Beobachtungen umdrehen. Man wird damit beginnen müssen, die Auseinandersetzung mit den Schattenseiten des Lebens (inkl. Leiden und Sterben) voranzutreiben (4). Das wird – wie Frankl propagiert hat – das Verantwortungsbewusstsein für die Lebensnutzung schärfen (3). Daraufhin wird sich eine Dankbarkeit für vorhandene Sonnenseiten des Lebens einstellen (2) und der absurde Anspruch auf puren Lebensgenuss verlieren (1).
Tatsächlich zeichnen sich inzwischen derartige „Umkehrtrends“ vage ab. Deshalb möchte ich Sie gleichsam trösten: Ich sehe Grund zum „tragischen Optimismus“ (Frankl). Der Tod tastet sich mit seinen Fangarmen langsam durch die Fortschrittseuphorie hindurch. Die Autoabgase verpesten die Städte, die Klimaerhitzung verdorrt die Felder, der Plastikmüll besudelt die Meere, Viren breiten sich aus, die Schere zwischen Arm und Reich explodiert … Das von rasanten technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen überrumpelte menschliche Gewissen regt sich in den Weltbevölkerungen und müht sich, im Wettlauf aufzuholen. Es flüstert von globalen Megaaufgaben, die nur im friedlichen und konsensualen Miteinander bewältigt werden können. Mit steigender, bedrohlicher Not wird sein Flüstern eindringlicher werden und das Cybergesumme übertünchen.
Not lehrt Furcht und Ehrfurcht, was sich im (zu Unrecht spöttisch gebrauchten) Wort „Not lehrt beten“ niederschlägt. Not lehrt uns, dass uns alles nur „auf Zeit“ gehört, aber auch, dass uns dieses „auf Zeit Gehörige“ in einem Gnadenakt anvertraut ist. Und Beten nährt unsere Hoffnung, dass die Gnade immer noch waltet …
1Frankl, V. E. (2005). … trotzdem Ja zum Leben sagen. Bd. 1 der Edition der Gesammelten Werke. Hrsg. von Batthyány, A., Biller, K. und Fizzotti, E. Wien: Böhlau, 79. Genau genommen handelt es sich bei Frankls Formulierung um eine semantische Verkürzung des Satzes: „Glück ist das Nicht-Eintreten von dem, was einem erspart bleibt.“
2Lukas, E. In: Frankl, V. E. (1982). Der Wille zum Sinn. Ausgewählte Vorträge über Logotherapie. Bern: Hans Huber (3. Auflage), 290
3Lukas, E. (1971). Logotherapie als Persönlichkeitstheorie. Dissertation. Universität Wien
4Crumbaugh, J. C. & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. In: Journal of Clinical Psychology, 20 (2), 200–207
5Das österreichische Ausbildungsinstitut für Logotherapie und Existenzanalyse (ABILE) wurde 1994 mit ausdrücklicher Zustimmung Viktor Frankls gegründet und führt neben der regulären Psychotherapieausbildung auch Forschungsprojekte im Bereich der Psychotherapiewissenschaften an der Donau-Universität Krems aus.
6Vgl. dazu Lukas, E. (2014). Vom Sinn des Augenblicks. Hinführung zu einem erfüllten Leben. Kevelaer: topos plus, Kapitel „Die Sonnenseiten des Lebens bejubeln“
7Aspinwall, L. G. & Staudinger, U. M. (Eds.) (2003). A Psychology of Human Strengths: Fundamental Questions and Future Directions for a Positive Psychology. Washington, DC: American Psychological Association
8Berscheid, E. (2003). The human’s greatest strength: Other humans. In: Aspinwall & Staudinger. A Psychology of Human Strengths, s. Anm. 7
9Frankl, V. E. (1982). Theorie und Therapie der Neurosen. München: UTB
10Frankl, V. E. (1955). Pathologie des Zeitgeistes: Rundfunkvorträge über Seelenheilkunde. Wien: Deuticke
11Frankl, V. E. (2018). Psychotherapie für den Alltag: Rundfunkvorträge über Seelenheilkunde. Freiburg/Br.: Herder, 47
12Linville, P. W., Fischer, G. W. & Salovey, P. (1989). Perceived distributions of the characteristics of in-group and out-group members: Empirical evidence and a computer simulation. In: Journal of Personality and Social Psychology, 57 (2), 165; Struch, N. & Schwartz, S. H. (1989). Intergroup aggression: Its predictors and distinctness from in-group bias. In: Journal of Personality and Social Psychology, 56 (3), 364.
13Johnson, J. J. (2010). Beyond a shadow of doubt: The psychological nature of dogmatism. In: International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5 (3)
14Allers, R. (1963/2008). Abnorme Welten. Ein phänomenologischer Versuch zur Psychiatrie. Hrsg., kommentiert und eingeleitet von Batthyány, A. Weinheim/Basel: Beltz, 143
15Vgl. dazu die Kapitel „Viel Bildschirmzeit – wenig Empathie“ und „Vorbild und Beeinflussbarkeit“ in Lukas, E. (2018). Auf den Stufen des Lebens. Bewegende Geschichten der Sinnfindung. Kevelaer: topos premium
16Während anfangs noch eine gewisse Vorsicht beim Suchtmittelkonsum waltet, verliert sich diese immer mehr, weil die sukzessive Abhängigkeit einen häufigeren Konsum und/ oder eine laufende Dosissteigerung erfordert. Das nennt man „Toleranzverlust“. Der suchtmittelfreie Zustand wird vom Organismus immer weniger und schlechter „toleriert“.
17Vgl. dazu: Spitzer, M. (2015). Cyberkrank! Wie das digitalisierte Leben unsere Gesundheit ruiniert. München: Droemer
18Frankl, V. E. (1982). Der leidende Mensch. Bern: Hans Huber (2. Auflage), 197f.
19Diesen Gedankengang gipfelte Frankl in seiner imperativen Maxime auf: „Lebe so, als ob du zum zweiten Mal lebtest und das erste Mal alles so falsch gemacht hättest, wie du es zu machen – im Begriffe bist.“
20Batthyány, A. (2019). Die Überwindung der Gleichgültigkeit. Sinnfindung in einer Zeit des Wandels. München: Kösel (2. Auflage), 53f.
21Frankl, V. E. (2010). Logotherapie und Existenzanalyse. Texte aus sechs Jahrzehnten. Weinheim: Beltz, 22f.