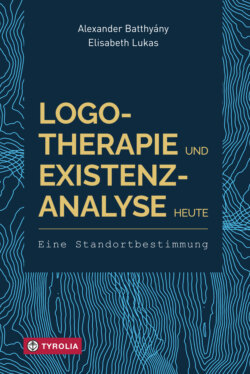Читать книгу Logotherapie und Existenzanalyse heute - Elisabeth Lukas - Страница 8
I. DIE PATHOLOGIE DES ZEITGEISTS IM 21. JAHRHUNDERT 1. GLÜCK IST, WAS EINEM ERSPART BLEIBT
ОглавлениеBatthyány: Wir werden in diesem Gespräch einige bisher noch selten so offen und im Detail diskutierte Fragen innerhalb der Logotherapie behandeln und dabei auch Debatten und Kontroversen ansprechen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten innerhalb der Logotherapie aufgekommen sind. Wir werden auch auf neuere Entwicklungen innerhalb der Logotherapie und benachbarter Forschungsgebiete eingehen. Und wir werden – und das vielleicht gleich zum Einstieg – auch auf Einsichten und Erkenntnisse im Werk Viktor Frankls hinleuchten, die noch verhältnismäßig wenig Beachtung gefunden haben; darunter auch einige, die sich vielleicht erst auf den zweiten oder dritten Blick erschließen. In diesem Zusammenhang muss ich gestehen, dass mir der innere Sinn eines solchen Impulses lange Zeit verborgen geblieben ist. Konkreter konnte ich über viele Jahre hinweg mit Frankls Definition von Glück relativ wenig anfangen. Frankl definiert Glück wie folgt: „Glück ist, was einem erspart bleibt“.1
Ich hatte den Satz zwar immer wieder gelesen; aber bis er richtig „angekommen“ ist, dauerte es tatsächlich ziemlich lange. Aber heute scheint mir: Die Einsicht, die in diesem scheinbar kleinen Satz verborgen ist, ist nicht weniger als der Weg zu eben einer jener kopernikanischen Wenden, von denen Frankl im Zusammenhang von tiefen Erkenntnisprozessen und lebensverwandelnden Einsichten gesprochen hat.
Ich will das an einem Beispiel illustrieren: Man geht zur Routineuntersuchung zum Arzt. Der Weg zu seiner Praxis ist eine dieser vielen alltäglichen Strecken durch die Stadt: Auf dem Weg kommt man an Blumenständen vorbei, an der Buchhandlung, an einigen Kleidungsgeschäften, an den Lebensmittel- und Blumenläden und Marktständen etc. Schließlich sitzt man im Wartezimmer der Arztpraxis, blättert in den dort ausliegenden Zeitschriften, liest sich vielleicht den einen oder anderen Artikel über Reiseziele, Rezepte und Theaterkritiken durch – und wird dann zum Arzt hineingerufen. Der Arzt begrüßt einen allerdings schon mit einem etwas ernsteren Blick und eröffnet einem dann überraschend, dieser oder jener Befund gefalle ihm nicht, dem müsse man weiter nachgehen, ob sich dahinter nichts Schlimmeres verberge. Jeder, der sich in diese Situation hineinversetzen kann, wird die Verwandlung der Welt nachvollziehen können, die eintritt, sobald diese Welt mit einem Male so unerwartet und grundlegend bedroht ist. Sie ist auf einmal in Frage gestellt. Und: Sie ist dadurch eine andere geworden. Auf dem Heimweg beobachtet man die Sorglosigkeit anderer – es ist genau dieselbe Sorglosigkeit, die man selbst auf dem Hinweg noch mit ihnen teilte, ohne sie allerdings je gewürdigt oder Dankbarkeit darüber empfunden zu haben. Man sieht auf dem Weg nach Hause dem alltäglichen Treiben auf der Einkaufsstraße zu, und es wird einem klar: „Diese Menschen haben etwas, was ich eben verloren habe: Sorgenfreiheit. Diese Sorgenfreiheit hätte ich auch gerne wieder.“ Eine Patientin formulierte es einmal sehr treffend: Sie sprach in eben diesem Zusammenhang von der „unerlebten Fröhlichkeit“ der Menschen, die gar nicht mehr wahrnehmen, wie sorglos und frei sie eigentlich durch die Einkaufsstraßen flanieren.
Es wird einem in solchen Situationen unmittelbar bewusst, was für ein Glück es beispielsweise bis zu diesem Tag gewesen ist, alles das zu erleben, was auf dem Hinweg noch ein kaum je hinterfragtes oder etwa dankbar anerkanntes Geschenk gewesen ist: beispielsweise am Schaufenster einer Buchhandlung stehenzubleiben, sich einige der neuen Buchtitel anzusehen, die man als Nächstes lesen könnte, oder die Kleidung der kommenden Saison – und sich auf die kommende neue Jahreszeit zu freuen, oder die Vielfalt und Farbenpracht der Blumen des Blumenstands auf sich wirken zu lassen etc. Kurz: Auf einmal leuchtet einem auf, wie interessant, wie lebenswert, wie großzügig und wie sorgenfrei das Leben die meiste Zeit gewesen ist. Und mit diesem Gedanken wird einem klar, wie dankbar man die ganze Zeit über selbst für das scheinbar belanglose, „selbstverständliche“ Alltagsglück hätte sein können.
Wenn man sich nun weiter vorstellt, dass man eine Woche später zum Nachfolgetermin geht – die Laborwerte liegen nun vor, und der Arzt eröffnet einem die gute Nachricht, dass alles in Ordnung sei; es war nur eine harmlose und vorübergehende Infektion, die die Blutwerte verfälschte, also ein Fehlalarm. Es lässt sich leicht ausmalen, wie nach dieser erfreulichen Nachricht auf dem Weg nach Hause dieselbe Einkaufsstraße in neuem Licht erstrahlt. Nur: Was ist dieses neue Licht eigentlich? Es ist das Licht der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit wofür? Dafür, dass man nur seinen Alltag wieder hat; mehr ist ja nicht geschehen. Die eigentliche Wandlung fand daher im Inneren statt: das dankbare Bewusstsein, dass das vermeintliche belanglose und selbstverständliche Alltagsglück weder belanglos und schon gar nicht selbstverständlich ist, sondern eben ein Glück.
Anders gesagt: Wir gewöhnen uns manchmal so sehr an das, was wir haben – und sind oft im selben Ausmaß so beschäftigt mit dem, was wir gerne hätten oder haben zu müssen glauben, dass die Dankbarkeit für das Gelungene, Heile, Gute atrophiert, also unterversorgt wird und abstirbt. Und dann ist es oftmals erst das Bedrohtsein oder der Verlust des bis dahin als selbstverständlich Hingenommenen, die uns vor Augen führen, wie beschenkt wir die ganze Zeit gewesen sind. Und wie blind für das Schöne, Gute und Gelungene wir womöglich diese ganze Zeit über waren.
Kurz: Dieser scheinbar kleine Satz birgt auf gleich mehreren Ebenen eine tiefe und tatsächlich positiv lebensverändernde Weisheit. Er öffnet die Tür zu einer natürlichen und echten, weil eben begründeten und wirklich empfundenen Dankbarkeit – also einer Dankbarkeit, die nicht nur als „moralische Pflicht“ oder als Lippenbekenntnis dem Leben entgegengebracht wird, sondern die wirklich lebensnahe und erlebnisecht erfahrbar ist. Glück ist tatsächlich, was einem erspart bleibt.
Lukas: Zu dieser Einsicht möchte ich Sie beglückwünschen. Aus dem enormen Fundus logotherapeutischer Einsichten haben Sie mit dem angesprochenen „Impuls“ etwas sehr Bedeutsames herausgepickt. Tatsache ist, dass die Dankbarkeitsvergessenheit grassiert wie eine böse Infektionskrankheit.
Mir ist dies schon als junge Dissertantin Anfang der 1970er Jahre aufgefallen, und damals hielt sich die „Infektion“ noch in Grenzen. Die erbärmliche Kargheit der Nachkriegsjahre war den Erinnerungen vieler Europäer noch nicht entschlüpft. Trotzdem hatte der Wohlstand bereits seinen Siegeszug angetreten und damit ein irrationales Anspruchsdenken zu schüren begonnen. Die Kenntnis von Frankls Trilogie „Schöpferische Werte“, „Erlebniswerte“ und „Einstellungswerte“ im Hinterkopf ging ich damals im Zuge meiner Dissertation daran, nach einer Befragung von 1000 Zufallspersonen die erhaltenen Antworten auf deren Werteladung abzutasten. Dabei fiel mir auf, dass es eine Reihe von Antworten gab, die auf meine Frage nach Sinnfindung im Leben die Freude über positive Faktoren und/oder die Bereitschaft, diese eigenen Schätze mit anderen Menschen zu teilen, benannten. Diese Antworten streiften lediglich die „Erlebniswerte“ und ähnelten eher den „Einstellungswerten“ mit umgekehrten Vorzeichen. Offenbar gibt es nicht nur großartige und sinnorientierte Einstellungen zu Kummer und Leid, sondern ebensolche zu den Gnadenfüllhörnern, die sich gelegentlich über uns öffnen.
Ich besprach mich mit meinem Mentor, und Frankl stand der Idee einer Erweiterung seiner Definition der „Einstellungswerte“ um die „generalisierten Einstellungswerte“ (Lukas) wohlwollend gegenüber. Schlussendlich erbrachte die Aufschlüsselung der Werteladungen der Antworten aus meiner Befragung eine spannende Verteilung. Die drei „Hauptstraßen der Sinnfindung“ (Frankl) waren von jenen Befragten, die ihr Leben als sinnvoll deklarierten, folgendermaßen betreten worden: von 50,40 % über die „schöpferischen Werte“, von 23,26 % über die „Erlebniswerte“ und von 26,34 % über die „Einstellungswerte plus generalisierten Einstellungswerte“ (= 100 %). Rund die Hälfte fand also Sinn im Hineinwirken in die Welt. Rund ein Viertel fand Sinn im Empfangen der Schönheiten der Welt. Rund ein Viertel fand Sinn im Positionbeziehen zu Gegebenheiten der Welt – seien sie zum Weinen oder zum Lachen2.
Batthyány: Diese Arbeit – „Logotherapie als Persönlichkeitstheorie“3 – war, soweit ich weiß, die erste deutschsprachige Dissertation zur Logotherapie; und sie ist auch, gemeinsam mit dem „Purpose in Life-Test“ von James C. Crumbaugh und Leonard T. Maholick (1964)4, eine der von Frankl am häufigsten zitierten Arbeiten der empirischen Logotherapie.
Der historischen Vollständigkeit willen ist vielleicht noch zu erwähnen, dass Ihr Doktorvater, der damalige Ordinarius für Psychologie der Universität Wien, Giselher Guttmann – als Schüler von Hubert Rohracher ein Vertreter derjenigen, die die Psychologie als streng empirische Wissenschaftsdisziplin betrachten und zudem auch ein Pionier der Neuropsychologie –, nicht zuletzt unter dem Eindruck der von Ihnen erhobenen Daten zunehmend den Wert der Logotherapie sowohl als Persönlichkeitstheorie als auch als Psychotherapie zu erkennen begann.
Zumindest sagte mir dies Professor Guttmann knapp 30 Jahre später, als er dann wiederum als Doktorvater meine Dissertation betreute. Professor Guttmann war es auch, der vor diesem Hintergrund ihrer empirischen Glaubwürdigkeit über viele Jahre hindurch im österreichischen akademischen Diskurs immer wieder seine Stimme für die Logotherapie erhob und so maßgeblich darauf hinwirkte, dass die Logotherapie vom österreichischen Ministerium bzw. dem Psychotherapiebeirat als Richtlinienpsychotherapie anerkannt wurde und heute das psychotherapeutische Fachspezifikum des Ausbildungsinstituts für Logotherapie und Existenzanalyse (ABILE5) staatlich akkreditiert ist.
Aber um wieder den Anschluss an die Gegenwart zu finden: Ihre Forschungsarbeit wurde 1971 am Institut für Psychologie der Universität Wien eingereicht. Vor dem Hintergrund Ihrer langjährigen therapeutischen Beobachtungen, klinischen Erfahrung und Lehr- und Vortragstätigkeit seither: Ich frage mich, ob diese Prozentsätze der Werteschwerpunkte heute – immerhin knapp 50 Jahre später – ähnlich verteilt wären, wenn man diese Messung erneut durchführen würde?
Lukas: Nein, vermutlich würden die Prozentsätze heute anders aussehen. Ich vermute, dass sowohl die „Erlebniswerte“ als auch die „Einstellungswerte plus generalisierten Einstellungswerte“ unter die 25 %-Marke rutschen würden. Bei den „Erlebniswerten“ bin ich dessen nicht sicher, doch scheint mir, dass selbst überzeugte Internetfans das Surfen und Kommunizieren im Netz nicht mehr als „rein beglückendes Erlebnis“ erachten, sondern irgendwo zwischen Informationsgewinn, Zwang und Fesselung einordnen. Jedenfalls werden für sonstige beglückende Erlebnisse die Zeitfenster schmal. Für „Einstellungswerte“ angesichts von Leid dürften die schnell aufwallende Entrüstung und Wehleidigkeit verwöhnter Menschen arg groß sein. Und für „generalisierte Einstellungswerte“ fehlt vielerorts der Sensus der Dankbarkeit.