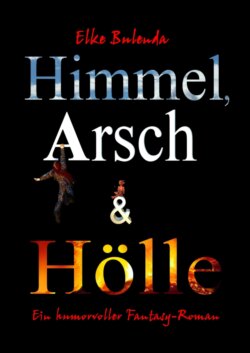Читать книгу Himmel, Arsch und Hölle! - Elke Bulenda - Страница 7
Das Geheimnis des Glücks ist die Freude in unseren Händen.
Оглавление(Ralph Waldo Emerson)
Freude in unseren Händen? Mal ehrlich, Ton in Händen zu halten ist in etwa so, als würde man in Dreck und Kacke greifen. Und ich weiß, wovon ich rede. In unserer Nordmann-Siedlung spielten wir Kinder mit fast nichts anderem, als Dreck und Kacke - es sei denn, Vater brachte mal eine Kiste Goldmünzen mit, in die wir unsere gierigen Händchen patschen durften. Holzspielzeug hatten wir auch, vor allem Knüppel, die wir uns mit wachsender Begeisterung gegenseitig auf die Schädel schlugen. Okay, vielleicht übertreibe ich ein wenig; selbstverständlich gab es bei uns auch Pferde, Kühe und Enten aus Holz geschnitzt, nur waren die nicht so handlich und schwer genug, um sie jemandem mit effizienter Wirkung auf den Kopf zu hauen. Im Gegensatz zu den heutigen Kindern, spielten wir am liebsten draußen, nach einem großen Regenguss, wenn sich unser Wikingerdorf in eine riesige Matsch-Landschaft verwandelte. Heutzutage bekommen moderne Mütter gleich eine Herzattacke, wenn sich ihre lieben Kleinen mal etwas in den Mund stecken, was zuvor schon den Boden berührte. Die Werbung suggeriert ihnen, dass das Wohl ihrer Kinder durch Viren, Bakterien und Keime bedroht sei, um ihnen etwas zu verkaufen, das 99,9%ige Keimfreiheit garantiert. Du meine Güte! Kinder müssen doch mal eine Kelle Sand fressen, damit ihr Immunsystem in Schwung kommt! Und schmutzig sollten sie sich auch machen dürfen und nicht wie kleine Barbie-Puppen herumstolzieren. Und wir Barbaren-Kinderlein haben Hände voll Dreck gefressen. Meistens steckte einer dem anderen eine Ladung in die Futterluke. Okay, und wenn man davon einmal Würmer bekam, wurde einem so viel Zwiebelsud zum Trinken eingetrichtert, bis sich die Parasiten hustend und spuckend von Dannen machten. Zum Glück durfte ich mich als Kind richtig dreckig machen. So schmutzig waren wir halben Portionen, dass unsere Mütter nur anhand der Stimmen erkennen konnten, welchen Dreckspatz sie sich zum Schrubben mit nach Hause nehmen mussten. Meine Mutter liebte den Pragmatismus und warf mich gleich in den angrenzenden Fjord. Diese Aktion diente schon der frühzeitigen Abhärtung, denn das Wasser war nicht immer warm. Diese Handlung ist auf keinem Fall herzlos zu nennen, denn so wurde ich automatisch zu einem guten Schwimmer.
Nun saß ich vor dem Lehmklumpen und sollte meiner Kreativität freien Lauf lassen. Das zumindest behauptete diese komische Öko-Schlunze, in ihrem selbstgestrickten Dress. Damit sah sie aus, wie eine halb Verweste im Leichensack. Wenn ich diese alten Weiber schon sehe, solche Schabracken, mit grauem Pagenkopf und einer Lesebrille am Goldkettchen ... Da bekomme selbst ich es mit der Angst zu tun. Die Leiterin des Töpferkurs hatte so etwas Wölfisches an sich. Wahrscheinlich war sie in ihrer Freizeit eine Lykanthropin. Und als Krönung, hieß sie auch noch Lupinia Semmeltopf. Missmutig beobachtete ich, wie sich alle, als wären sie die Verrückten, an ihrem Lehmbatzen zu schaffen machten. Ernestine durfte nicht mitkneten, sie würde mir nur den Fußboden versauen. Stattdessen saß sie auf der Töpferscheibe und ließ sich von jemandem, der Erbarmen mit ihr fand, dumm und schwindelig drehen. Schon allein vom Zusehen bekam ich Migräne. Die Wolfs-Töpferin bemerkte wohl meine Misere, weil ich den Klumpen mürrisch anblickte und mir dabei die Schläfen rieb.
»Ragnor? Schwierigkeiten mit der Kreativität? Dir wird doch irgendetwas einfallen, oder? Zum Beispiel, etwas, das dich schon heute morgen bewegt hat«, meinte sie wohlwollend.
Sofort schoss mir dieser räudige Kater ein, denn er hatte mich heute schon sowohl zum angewiderten, als auch wütenden Herumhüpfen gebracht. Und wenn das kein bewegender Moment war, fresse ich den Batzen Lehm!
»Okey-dokey«, täuschte ich innerliche Erleuchtung vor und begann zu kneten. Schnell bildete sich etwas Katzenähnliches heraus, das von der Töpferin begeistert aufgenommen wurde. Schließlich saß eine ganz passable Tonkatze vor mir. Euphorisch klatschte die Ökotante neben mir in die Hände.
»Alle mal herkommen! Nun schaut euch doch mal diese hübsche Katze an!«, jauchzte sie, und ich wäre nicht verwundert gewesen, wenn sie ein kleines Tänzchen aufgeführt hätte. Katzentanz, oder so etwas. »Komm Ragnor, lass sie uns in den Brennofen setzen. Nein, so etwas habe ich dir wirklich nicht zugetraut. Ich will nicht sagen, dass du unsensibel wärst, aber so eine filigrane Arbeit, sehr gut für deine, äh, Konstitution!«, sülzte mich diese Hippe voll.
»Halt, nee, nee!«, blockte ich ab. »Die ist doch noch gar nicht fertig! Hände weg!«, forderte ich mein künstlerisches Recht ein. Denn das Beste kam ja erst!
Wie ein Chirurg griff ich mir ein Modellierholz und traktierte damit das Tonkatzenvieh. Die Gerätschaft ließ ich stecken und nahm mir eine Modellierschlinge und stach sie mehrmals in das Kunstwerk. Danach kam der Lochschneider zum Einsatz. Letztendlich schnitt ich dem Vieh mit der Drahtschlinge den Kopf von den Schultern und legte ihn ihr vor die Katzenpfötchen.
»So, jetzt bin ich fertig, kann gebrannt werden«, kommentierte ich mein Werk, nicht ohne einer gewissen Genugtuung.
»Nein, ich weigere mich, etwas Gewalt verherrlichendes zu brennen! Ohnehin brauchen wir die Werkzeuge und das Holz würde beschädigt werden!«, mokierte sich die Lesebrillenträgerin.
Gut, dann wird das Kunstwerk Tote Katze eben niemals das Licht der Welt erblicken. So wurde es kurzerhand wieder zu einem nichtssagenden Klumpen Ton.
»Ragnor, ich verstehe nicht, wieso du die Katze nicht in ihrem vorherigen Zustand gelassen hast. Sie war doch schön!«, belaberte mich die Wölfische.
»Schön? Aber absolut nicht aussagekräftig und wenig brauchbar - in meinen Augen unnütz!«, gab ich lakonisch zu Protokoll. Für mich machte die Katze danach viel mehr Sinn.
»Wenn du auf Nützlichkeit plädierst, dann mache eben etwas davon und nicht so ein destruktives Zeug!«, belehrte sich mich weiter. Irgendwie erwartete ich schon, sie würde sich vor Aufregung mit dem Fuß hinter dem Ohr kratzen.
»Okay, wenn ich etwas Nützliches machen soll, dann brauche ich mehr Ton, und nimm mal jemand Ernestine von der Platte, ich habe keine Lust mit ihr nachher nur im Kreis zu laufen!«, gab ich zum Besten.
Da Ökotante die einzige mit sauberen Händen war, hob sie mit leicht angewiderter Miene das Socken-Monster herunter, was Ernestine brummeln ließ.
»Hier ist Ton, davon kannst du dir nehmen soviel du brauchst«, zeigte Lupinia in die Ecke, in der wirklich viel Ton lag.
»Oh, so viel Ton!«, grinste ich mit O-Ton in der Stimme. Doch man sollte den Bogen auch nicht zu sehr überspannen, sonst kam die Tussi noch auf den Gedanken, mich aus den Räumlichkeiten entfernen zu lassen. Tja, dann konnte ja nichts mehr schief gehen. Ich feuchtete mir die Hände an und warf den ersten Klumpen auf die Töpferscheibe und brachte ihn schon mal etwas in Form. Wenn Radegundis mir holt war, würde daraus sogar etwas werden, falls ich nicht an totalem Gedächtnisverlust litt. Zum Glück war es eine mechanische Töpferscheibe, denn mit einer motorisierten hatte ich bisher noch nicht gearbeitet. Ja, das Dreck-, Matsch- und Kacke-Spiel war bei uns im Dorf quasi immer die lehrreiche Vorschule des Töpferns gewesen. So bekamen wir schon mal das richtige Fingerspitzengefühl für Material und Motorik. Oder dachtet ihr, wir benutzten keine Teller und futterten unsere Speisen direkt von der Tischplatte? Damit es auch selbst nach der heftigsten Feier, hinterher noch immer genug Irdenes im Hause gab, musste jeder von uns mal an die Töpferscheibe. Seltsam, was so ein Brocken Lehm für Erinnerungen weckte. Und wie der Doc sagte, mussten diese Erinnerungen nicht immer negativer Natur sein. Ohnehin bin ich ein pragmatischer Typ, was eindeutig von meiner Mutter stammte. Und da ich für meinen neuen Hausstand noch dringend ein Essgeschirr brauchte, konnte ich mir gleich eines vor Ort werkeln. Natürlich esse ich nicht, aber man benötigt doch mal einen Teller, oder eine Tasse für einen Gast. Und die Zwerge würden voraussichtlich noch sehr oft zu Besuch kommen. Also, warum nicht etwas ganz Individuelles herstellen? Massenware gibt es doch schon zu Genüge. Mein erster Teller wurde wieder von mir platt gemacht, weil er noch ein wenig krungelig war. Doch der zweite Versuch klappte, und im nu hatte ich sechs Teller geformt. Gerade wollte ich mit den tiefen Tellern beginnen, als die Unterrichtsstunde schon vorüber war. Hätte ich nicht erst so eine blöde Katze modelliert, wäre ich schon wesentlich weiter. Aber morgen stand wieder Töpfern auf dem Plan und dann würde ich sehr bald das gesamte Service fertig bekommen. Zumindest war ich zufrieden, als mein erstes - seit 600 Jahren - eigenes Geschirr zum Vortrocknen im Regal stand. Klar, damals, als ich noch ein großer Macker im Dienste des Lord Seraphim war, besaßen wir natürlich feinstes Chinesisches Porzellan. Nur kam das sehr selten bei uns auf den Tisch. Bei den wilden Kindern? Sollte es etwa den weiten Weg über die Seidenstraße genommen haben, damit mir anschließend meine Rüpel-Kinder das Geschirr zerdepperten? Ohnehin waren die Tassen so klitzeklein, dass ich da niemals meinen Finger durch den Tassenhenkel bekam. Mit anderen Worten: Es sah zwar ganz hübsch aus, war aber im Grunde genommen völlig unpraktisch. Da lobe ich mir doch etwas Rustikales!
Im Gang wartete schon Diemal auf mich und grinste über beide Backen.
»Es steht 1:1! Du töpferst eindeutig besser als dein Socken-Monster.«
»Das lag vielleicht daran, weil sie nicht zum Zug gekommen ist. Aber ich habe echt keinen Bock, das Vieh zuhause zu baden«, gab ich zu Gehör. »Findest du nicht auch, dass die Kursleiterin wie ein Wolf aus einem Märchen aussieht? So wie der Wolf, der sich als Großmutter verkleidete. Der aus Rotkäppchen«, bemerkte ich.
»Hm, vielleicht liegt es an ihrer Mono-Augenbraue? Aber du bist auch zum Fürchten. Diese Katzennummer, die du da vorhin abgezogen hast. Mann! Das war echt ganz schön krank. Die drei kleinen Elfen, die gemeinsam an ihrem Ton gearbeitet haben ... Davon hat sich eine direkt in ihr Kunstwerk übergeben«, lachte Diemal. »Wir haben nun Pause. Was machst du jetzt?«, fragte sie mich.
»Hm, ich hole mir einen Kaffee und dann gehe ich Delia besuchen«, meinte ich daraufhin.
»Gut, dann sehen wir uns nach der Pause, zum Yoga«, nickte sie mir zu und ging ihres Weges. Es war schon etwas seltsam, dass Diemal ausgerechnet die gleichen Kurse belegte, für die auch ich eingeschrieben war. Mir schien, als habe Trixie eine kleine Spionin auf mich angesetzt. Auch wenn Diemal eine ziemlich entzückende Person ist.
Ich trabte in die Kantine, wo mir die gute Anna Stolz zu Mittag eine Überraschung versprach, und nahm einen großen Becher Kaffee mit auf den Weg. Leise klopfte ich an Delias Tür, die mir etwas verändert erschien.
Ja, genau. Das Schild mit der Aufschrift: "Bitte nicht stören! Orakel bei der Arbeit!", war nicht mehr da. Und ganz zu meiner Verwunderung öffnete Delia persönlich die Tür. Was war hier los? Im Normalfall lag sie in ihrem Bürobett und schlief den Schlaf der Gerechten. Ich war so baff, dass ich mir beinahe den Kaffee über die Füße kippte.
»Ah, Ragnor! Komm doch rein! Wo warst du solange?«, strahlte mich Delia an. Sie sah wunderschön aus und seit sie in anderen Umständen war, schien sie förmlich von innen zu leuchten.
»Äh, ja gerne. Ach, ich war in Honolulu, Bikinischönheiten betrachten«, entgegnete ich lakonisch und bückte mich durch die Tür. Auch das Innere ihrer Behausung hatte sich verändert. Das große Bett mit seinen vielen Regalen und Ablageflächen glänzte durch Abwesenheit und halb gepackte Kartons standen auf schon geschlossenen Kisten.
»Was ist denn hier los?«, fragte ich erstaunt, während ich ungläubig im Zimmer umherblickte.
»Simon und ich ziehen in die nächsten Ortschaft, in ein kleines, entzückendes Haus. Wir können unmöglich unser Kind in dieser Umgebung aufwachsen lassen«, meinte Delia und legte mir eine Hand auf den Arm. »Verstehe mich nicht falsch, wir mögen euch hier alle. Nur ist das nicht der richtige Aufenthaltsort für ein Baby.«
Ihre Worte hatte ich begriffen. Sie wollte nicht, dass ihr Kind unter Monstrositäten aufwuchs. Deshalb nickte ich, weil ich es nachvollziehen konnte.
»Aber was ist mit deiner Gabe? Du bist doch unser Orakel«, fragte ich nach.
»Weißt du, seit Sal weggegangen ist, hat sich hier vieles verändert ...«
»Ach ja, er hat dir nicht zufällig gesagt, wohin er wollte?«, hakte ich nach.
»Nein, ich kann auch nicht sehen wohin er gegangen ist, oder wo er sich befindet. Ich kann nicht ...«
»Wie du kannst nicht? Du kannst es mir nicht sagen, oder willst du es mir nicht sagen?«, unterbrach ich Delia etwas barsch.
»Ragnor, du verstehst mich nicht. Ich wollte sagen, dass seit Sals Verabschiedung bei mir überhaupt nichts mehr zu sehen ist. Frag mich nicht wieso, aber seit diesem Tag habe ich weder narkoleptische Anfälle, noch die Fähigkeit etwas zu orakeln«, meinte Delia und legte ihre Hand auf die sanfte Wölbung ihres Bauches, der seit der Trauung schon wieder etwas gewachsen war. »Natürlich habe ich mir schon große Sorgen um das Baby gemacht. Vor allem, wie ich es hinterher versorgen sollte, wenn ich doch ständig meine Anfälle bekäme. Aber es ist fast wie ein Wunder, weil ich ganz plötzlich geheilt bin!«, berichtete sie mir aufgeregt.
… Oh, dieser infame Kerl! Einerseits finde ich es wirklich nobel von Sal, Delia von ihrer Narkolepsie zu heilen, aber andererseits ist sie nun als Orakel keinen Pfifferling mehr wert. Was mich aber am meisten ärgerte war, dass durch den Verlust von Delias Fähigkeiten, die Möglichkeit ihn aufzuspüren nahezu unmöglich war. Klar, sollte er doch bleiben wo der Pfeffer wächst, nur ärgerte mich die Art seiner Taktik ganz schön. Als wäre er nicht mehr existent, hat er sämtliche Spuren seines Verbleibs gelöscht. Natürlich habe ich keine Sehnsucht nach Sal, alias Cornelius. Doch war ich wirklich ein wenig neugierig, wohin er sich so klammheimlich verzogen hatte. Oder eher, wo er sich versteckte. Damals schon, vor langer Zeit, floh er vor seinem Vampir-Dasein in den tiefsten Wald und lebte in seinem Turm wie ein Eremit. Das Dumme daran ist: Vor sich selbst kann man nicht weglaufen …
Da Delia nichts von Cornelius´ wahrer Identität wusste, spielte ich das Spielchen mit.
»Oh, das scheint wirklich ein Wunder zu sein. Ich muss gestehen, auch ich machte mir gewisse Sorgen um dich und den Jungen. Doch da du jetzt geheilt bist, steht deinem zukünftig-glücklichen Leben nichts mehr im Wege.«
Das ehemalige Orakel strahlte über das ganze Gesicht. »Ja, ich freue mich schon auf unser neues Heim. Ach, übrigens. In der Vorhersage habe ich mich ebenfalls geirrt. Es wird ein Mädchen. Hoffentlich kommt sie nach ihrem Vater. Es wäre wirklich schlimm, wenn sie auch die Sehergabe hätte«, sagte Delia und drückte mir einen Stapel Bilder in die Hand. Eigentlich konnte ich nicht besonders viel darauf erkennen. Es sah wie ein Tier aus, oder ein Alien. Doch als mir Delia erzählte, das wären Ultraschallaufnahmen ihres Babys, war ich ganz schön erstaunt. Noch nie zuvor sah ich ein Kind im Mutterleib. Woher auch, schließlich bin ich nicht Doktor Röntgen. Nur die Aura eines Kindes im Mutterleib kann ich erkennen, aber das Kind selbst nicht. Deshalb sah ich mir die Fotos etwas genauer an. 16.SSW stand auf den Bildern. Die in schwarz/weiß waren nicht so deutlich, aber die bunten, in 3D, waren ganz erstaunlich. Selbstverständlich hatte das Kind einen recht großen Kopf. Aber die Details waren schon erstaunlich. Klitzekleine Ohrenstummel waren schon erkennbar, und die Fäustchen waren an den Kopf gepresst, ganz so, als wollte die Kleine noch nichts von den Schlechtigkeiten dieser Welt hören. Unwillkürlich musste ich grinsen. Vielleicht ahnte das kleine Mädchen schon etwas? - Gewissermaßen eine Vorahnung?
»Wirklich ganz erstaunlich, diese moderne Technologie. Ja, es wird ein sehr schönes Kind, das sieht man jetzt schon. Und ich freue mich für dich und Simon, jetzt ein normales Leben führen zu können. Um ehrlich zu sein, eure Trauung war wohl die längste Zeremonie, die ich je erlebt habe«, schmunzelte ich. Delia nickte, stellte sich lächelnd auf die Zehenspitzen und gab mir einen Kuss.
In der Tat war die Trauung ziemlich ungewöhnlich gewesen. Sie wurde in der Kantine vollzogen, damit die geladenen Gäste bei dieser Feierlichkeit genügend Plätze fanden. Zuerst versuchten wir es im Stehen. Der Standesbeamte war unser seltsamer Zyklop aus dem Büro, dessen Verantwortung auch die Ausgabe für die Ausweise und Führerscheine umfasste. Reginald lautet sein Name, den Nachnamen habe ich vergessen, weil ich mir einfach keine Namen merken kann. Als er mit monotoner Stimme begann die Phrasen zu dreschen, kippte Delia in Trance vornüber, so dass ich sie schnellstens auffangen musste, damit die Gute sich nicht den Kopf stieß. Bei ihr kamen die narkoleptischen Anfälle meistens aus heiterem Himmel und währenddessen empfing sie ihre Visionen. Danach musste sie immer schnellstens festhalten was sie sah, sonst wäre es innerhalb von Minuten wieder verpufft und sie konnte sich beim besten Willen nicht mehr an das Erblickte erinnern. Nachdem sie das zweite Mal umkippte, diesmal nach hinten, organisierten wir uns ebenfalls ein paar Stühle und vollzogen die Zeremonie im Sitzen. Und das dauerte dann auch eine halbe Ewigkeit, was zur Folge hatte, dass nicht nur die Braut immer wieder weg dämmerte, sondern die Hochzeitsgesellschaft gleich mit. Zum Glück war Delia jetzt von diesem Fluch, den man aber auch als Segen betrachten konnte, geheilt. Zwar wusste ich nicht, wer jetzt an ihre Stelle treten sollte, doch für ihr zukünftiges Familienleben schien es eindeutig besser zu sein.
»Wenn deine Jungs wieder da sind, gibt es eine Einweihungsfeier«, meinte Delia und machte sich wieder ans Packen. »Unterstehe dich, wieder abzutauchen, du musst mich mindestens einmal in der Woche besuchen kommen.«
»Klar, komme ich dich besuchen!«, versprach ich ihr und schritt zur Tür. »Gut, meine Süße, ich muss jetzt zum Yoga. Tschüss. Weiß der Teufel, was ich da soll! Ich hoffe doch, dass ich die Auflösung des Knotens in meinen Beinen, noch vor Ende der Stunde erfahre«, beschwerte ich mich und trabte los. Delia lachte herzlich über meine Pöbelei und winkte mir hinterher.
Im Yoga fiel ich hauptsächlich durch mein lautes Schnarchen auf, als wir zum Schluss noch ein wenig Autogenes Training machten. Dieser Akt der totalen Entspannung erfreute unseren Lehrgangsleiter nur bedingt. Er war Inder und hieß so ähnlich wie Paramanamtam und trug einen senfgelben Turban. Selbst Ernestine schien gelangweilt und rollte sich bei mir ein und schnarchte ebenfalls. Offenbar war ich nicht so schnell wieder wach zu bekommen. Aber wie es mit dem Schlaf nun mal so ist, war mir gar nicht bewusst gewesen, überhaupt beim Autogenen Training weggedriftet zu sein. Etwas kitzelte mich an der Nase. So schnupperte ich und meinte:
»Hm, Liebes, dein Haar duftet so anders, aber echt gut. Lass mich noch ein wenig liegenbleiben, komm, kuschel dich an mich!«
Ein Kichern ertönte. »Sag noch mal "Liebes" zu mir und ich breche dir den Kiefer! Und kuscheln werde ich mit dir erst gar nicht. Aber du hast recht, mein Haar duftet wirklich gut!« Diemal schnupperte an einem ihrer beiden hüftlangen Zöpfe. »Aber um das Kompliment zurückzugeben: Du duftest auch nicht übel. Los, steh auf, es ist Zeit für´s Mittagessen!«
Mit hochrotem Gesicht schlug ich die Auge auf und blickte in die Deckenbeleuchtung, was zur Folge hatte, dass ich einem photischen Niesreflex erlag. Verdammt, ich dachte doch wirklich, es wäre meine Frau gewesen, die mich so zärtlich weckte, oder eher meine Ex-Frau. In gedrückter Stimmung schleppelte ich der Zwergin hinterher und erreichte die Kantine, wo ich großzügigerweise am Zwergentisch Platz nehmen durfte, weil mein Team ohne mich in geheimer Mission unterwegs war. Einerseits bedeutet es eine große Ehre, am Tisch der Zwerge sitzen zu dürfen. Andererseits ist es ein echtes Elend, als Hüne daran einen Platz zu finden. Meine Beine passten nicht unter den Tisch, so dass ich ihn beinahe angehoben hätte. Auch der winzige Stuhl drohte unter meinem Gewicht nachzugeben. Deshalb setzte ich mich auf den Boden. Die Überraschung zu Mittag stellte sich als Blut-Sorbet heraus. Genau das Richtige zu dieser warmen Jahreszeit. Trotzdem riss es mich nicht vom Hocker. Ich war ziemlich deprimiert. Nun ging Delia auch noch weg. Mir schien, als würden alle vor mir panisch das Weite suchen. Obendrein war es erst Mittag und ich definitiv schon austherapiert, oder eher der Therapie müde. Es erwarteten mich noch so ein beklopptes, kreatives Malen, meditatives Gärtnern und eine beknackte Reittherapie. Was später darauf hinauslief, dass ich der Erfinder des großen und kleinen Blutbilds wurde und einer tiefen Enttäuschung erlag, weil das Rasen sprengen gänzlich ohne C4 Sprengstoff stattfand. Aber es brachte mich immerhin auf eine geniale Idee, die ich dringend vor meinem trauten Heim umsetzen musste. Mit dem Reittier musste ich mich erst mal eine Runde prügeln, weil es beim Aufsitzen ständig vor mir die Flucht ergreifen wollte. Nun, an so etwas bin ich schon gewöhnt. Wir konnten uns auf Anhieb nicht leiden.
… Schon immer hatte ich eine ausgesprochene Abneigung gegen Pferde. Damals, als ich noch bei den Rittern des Michael war, besaß ich einen Gaul, der die gleiche Farbe wie mein Haar hatte. Wir wurden als Einzelindividuen schon gefürchtet, doch wenn ich auf Gunnar durch die Gegend ritt, wurde sozusagen jedes Mal der Ausnahmezustand ausgerufen. Es interessierte den blöden Klepper überhaupt nicht, ob sich etwas vor seiner Nase befand. Wer nicht schnell genug das Weite suchte, wurde entweder von ihm getreten, gebissen oder zu Hackfleisch verarbeitet. Ebenso ignorant verfuhr er damit, wohin ich wollte. Das Schlimmste war der Akt, diesem Gunnar das Zaumzeug an-, und den Sattel aufzulegen. Nie verging nicht mindestens eine halbe Stunde im direkten Clinch, bis ich ihn soweit hatte, denn sobald man ihm den Rücken zudrehte, zog er sich entweder den Sattel wieder vom Rücken, oder biss mir in den Hintern. Und bei meiner Antipathie gegen diesen struppigen Zossen, war das genau eine halbe Stunde zu viel in seiner Gegenwart. Und wir hassten uns voller Abscheu tief von ganzem Herzen. Eigentlich sollte aus Gunnar, den ich nur abwertend Plüschi nannte, eine ordentliche Portion Pferdewurst gemacht werden, doch mein Sohn Gungnir verguckte sich in dieses Rüpel-Pferd und überredete mich letztendlich, ihn seiner Obhut zu überlassen. Mit einem ordentlichen Schluck Hochprozentigem bekam er ihn sogar beim Satteln in den Griff. Dabei frage ich mich, wieso ich nicht auf diese glorreiche Idee gekommen war. Aber ich schweife schon wieder ab ...
Im Übrigen bräuchte ein Vampir rein theoretisch gar nicht zu reiten, denn er ist zu Fuß wesentlich schneller als dieses Huf-Getier. Doch da es die Reittherapie so verlangte, fläzte ich mich auf dem Rücken des Gaules, langweilte mich zu Tode, schlief ein und fiel wieder runter, um nach der Therapiestunde schrecklich nach Pferd zu riechen. Als der Abend anbrach, war ich ab und alle. Ich machte mir Gedanken, wie es mir gelänge, in kürzester Zeit am weitesten von dieser verfluchten Therapie weg zu kommen. Der einzige Lichtblick war, dass ich jetzt, dank GPS wusste, wo Amanda wohnte ...