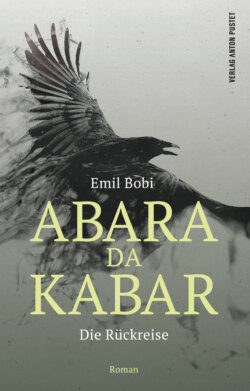Читать книгу Abara Da Kabar - Emil Bobi - Страница 12
6
ОглавлениеIm Palais Ferstel glitzerten die Luster und eine gedämpft murmelnde Geräuschwolke lag über den gut zweihundert Besuchern, die in kleinen Gruppen standen oder damit begannen, ihre Plätze einzunehmen. Manche hatten das Buch unter den Arm geklemmt, andere steckten gerade ihre Einladung weg und hoben grüßend die Hand, weil sie einen Bekannten entdeckt hatten. Das Podest mit einem Tisch und drei Sesseln stand noch menschenleer im Halbdunkel. Ich erkannte Michaela Halbmond von den Zeitungsfotos. Sie stand plaudernd in einer Gruppe aus vier, fünf Personen und nickte lebhaft. Als ich mich näherte und ihr Blick auf mich fiel, schien auch sie mich zu erkennen, vielleicht, weil ich so unlinguistisch aussah, oder eben wie ein Journalist, der überall auftauchte, aber nirgendwo dazugehörte und diesen typisch routinierten Fremdkörper abgab, der sich nun auf sie zubewegte.
Da stand sie nun. Und das Überraschende war, dass ihr Aussehen gar nicht so unpassend zu ihrer Telefonstimme war. Eine lange, silbrig glänzende Mähne fiel auf einen schwarzen Blazer, sie trug enge Jeans, einen safrangelben Schal aus Kaschmir-Seide und ihr Lächeln verriet eine Ausgeglichenheit, die nur von einem Wesen stammen konnte, das das Leben allgemein nicht als Niederlage zu empfinden gelernt hatte. Es war zeitlich schon knapp. Während wir uns die Hände reichten und begrüßten, ging vorne am Podium das Licht an, das Gemurmel im Saal erstarb und die Moderatorin begann mit der Begrüßung. Michaela Halbmond hatte zwei Plätze reserviert, gab mir ein Zeichen mit dem Zeigefinger und nickte einladend, während vorne die Präsentation begann und die Autoren unter rauschendem Applaus auf die Bühne gebeten wurden. Wir waren nicht einmal dazu gekommen, ein bisschen zu plaudern und nun saßen wir nebeneinander und neigten manchmal unsere Köpfe zueinander, um uns etwas zuzuflüstern und still zu nicken. Ich fragte sie, ob sie denke, dass Hans Reich anwesend sei, doch sie zuckte verneinend mit dem Kopf und bog ihre Mundwinkel nach unten, als würde sie sagen »kenn ich nicht«. Dann hielt sie mir die Einladung zur Präsentation hin, zeigte auf den Namen eines der Mitautoren und flüsterte nickend: »Bei dem habe ich studiert.« Dann blickte sie wieder nach vorn und streckte ihren Zeigefinger Richtung Bühne, um meiner Aufmerksamkeit ihren Platz zu weisen. Während die Moderatorin das Buch mit einer verschachtelten Huldigung vorstellte, an der sie viel zu lange herumredigiert hatte, richteten sich noch immer Blicke von da und dort aus dem Publikum auf Michaela Halbmond.
Sie war Spezialistin für Niger-Kongo-Sprachen, eine der größten Sprachfamilien überhaupt, und sie selbst beherrschte neben den Weltsprachen mindestens fünf zur Familie gehörende Sprachen gut, drei davon, Swahili, die Bantu-Sprache Lingala und Bambara, das in Mali gesprochen wurde, fließend. Sie war in einem Team aus französischen, amerikanischen und afrikanischen Sprachforschern gewesen, das im westafrikanischen Mali das bislang unbekannte Jowulu entdeckte. Die Meldung ging weltweit durch die Medien und beförderte die Teammitglieder auf den Olymp der Linguistik. Eine neue Sprache zu entdecken konnte man auch heutzutage nicht gänzlich ausschließen, etwa in Gegenden wie dem Kongobecken, dem südindischen Hochland, dem Amazonasgebiet oder irgendwo in der Inselwelt Papuas. Doch war es eine extreme Seltenheit geworden und daher in der Welt der Sprachwissenschaft eine echte Sensation. Mitten in dieser zu Ende explorierten Welt hatte man nun Jowulu entdeckt, das in der Region Sikasso an der Grenze zu Burkina Faso von kaum zehntausend Menschen gesprochen wurde. Michaela Halbmond und die anderen aus dem Team interviewten viele von ihnen, besonders jene wenigen, die auch Bamanankan oder Duungoma sprachen und als Dolmetscher dienen konnten. Manche Jowulu-Sprecher – wenige – konnten auch ein bisschen Französisch und die waren eine besondere Hilfe für die unentwegt sensibel und anerkennend lächelnden Linguisten, für die jede Lautäußerung der Einheimischen eine Attraktion war. Die Eingeborenen begegneten dieser unterwürfigen Achtung mit verständnisloser Höflichkeit. Die netten Fremden in den Khaki-Kleidern wollten jedes Wort drei Mal hören, sezierten es, schnitten es in Scheiben, hängten es zum Trocknen auf und betrachteten es Tag und Nacht ungläubig von allen Seiten.
Es bedurfte einiger Nächte der hitzigen Diskussion bei Gaslicht unter Zelt-Vordächern, um Auffassungsunterschiede in lexikostatistischen Fragen auszuräumen und mögliche Verwandtschaften zu anderen Lokalsprachen über das Ausmaß an phonetischen Ähnlichkeiten zu klären. Aber dann war alles entschieden: Jowulu war den Mande-Sprachen zuzuordnen, einem Zweig, der bis dahin 75 Einzelsprachen auf sich vereinigte. Jowulu wurde genauer gesagt zur vierzehnten und wohl letzten Sprache des Nord-West-Mande erklärt und damit der Niger-Kongo-Familie zugerechnet. Ganz so, wie alle anderen Mande-Sprachen derselben Familie zugeordnet worden waren, obwohl sie morphologisch kaum Ähnlichkeiten aufwiesen. Vor allem fehlten bestimmte für Niger-Kongo-Sprachen typische Substantiv-Kategorien. Macht nichts, sagten die Anhänger dieser Verwandtschaftsthese, die Mande-Sprachen hätten sich eben schon vor der Herausbildung dieser Substantiv-Kategorien von der Großfamilie abgespalten und wegentwickelt. Die Abspaltung habe vor siebentausend Jahren begonnen.
Mit derselben Sicherheit wurden diese behaupteten Zugehörigkeitsverhältnisse von anderen Meinungslagern belacht und ins Reich der Spinnereien glottogenesischer Egomanen verwiesen, die sich einbildeten zu wissen, wie vor siebentausend Jahren auf einem Kontinent gesprochen wurde, dessen Geschichte erst vor fünfhundert Jahren begonnen habe, schon deshalb, weil in Afrika dazu nicht viel auszugraben war und schon gar keine altertümlichen Bibliotheken, einfach, weil von Lehmhütten nach einigen Regenfällen nicht mehr übrig blieb als von verklungenen Wörtern.
Ich sah sie von der Seite an. Jeder aus dem Publikum schien sie zu kennen oder zu erkennen. Wenn sich ihre Blicke mit ihrem trafen, nickten sie anerkennend und lächelten. Sie war eine Berühmtheit, ein Star. Und sie war alles andere als eine glottogenesische Egomanin. Sie war ein erhobenes Wesen, das entspannt mit beiden Beinen am Boden stand, ein Wesen, das vom Leben nicht verwöhnt, sondern belohnt war und von etwas getragen, das es unabhängig machte, auch von seinem eigenen Erfolg und von all dem, was ihm diese große Anerkennung eingebracht hatte. Ihr offensichtliches Wohlbefinden, ihre natürliche Freundlichkeit, ihre innere Schönheit und diese ungespielte Bescheidenheit ließ die ihr entgegengebrachten Huldigungen wie charmante Irrtümer aussehen. Sie liebte ihren Beruf und ihre Kollegen, auch wenn sie Spinner waren. Das war alles.
Die Lesung war bald vorbei und während sich vor dem Autoren-Tisch eine kleine Warteschlange bildete, um Bücher signieren zu lassen, schlenderte Michela Halbmond mit mir im dünnen Geklirre von Sektflöten durch die Gegend und stellte mich einer Reihe von Kollegen vor, die für mich interessant sein konnten. Sie, Michaela Halbmond, war eine Hoheit. Von ihr mitgebracht und vorgestellt zu werden hatte protektionistische Sofortwirkung, obwohl die Leute nur sie sahen. Ich war etwas Besonderes, weil ich mit ihr sein durfte.
In einer Gruppe standen der Psycholinguist Herwig Prettner, ein deutscher Universitätslehrer, der nach einer Gastprofessur in Wien die Stadt nicht mehr verlassen wollte; der Sprachphilosoph Wendelin Pflug, ein zusammengesunkener Greis, der eben seine dicken Brenngläser von der Nase nahm und seine angestrengten Augen rieb. Unter seinem Sakko aus abgetragenem, feinem Tuch trug er einen viel zu dicken Pullover, über dessen Kragen der Knoten seiner Krawatte hervorlugte. Neben ihm beugte sich die Sprach-Historikerin (genauer gesagt Paleolinguistin) Elke Winter-Margulies vornüber und blinzelte über den Rand ihrer grellroten Brille. Und da war einer der Co- Autoren von »Die Balkan-Route«, Xaver Heidenreich, ein hochgewachsener jugendlicher Typ mit lachendem Gesicht und langen, schlanken Fingern. Auch er trug unter dem Sakko einen Pullover.
Ich gratulierte zur Wahl des Buchtitels und zum inhaltlichen Aufbau der Geschichte. So müsse man Wissenschaft in der Öffentlichkeit verkaufen, sagte ich. Bunt, spannend, möglichst un-lateinisch, aber dennoch exakt und seriös. So komme eine breitere Allgemeinheit in den Genuss dieser Inhalte. Bildung sei schließlich das universelle Zauberwort für praktisch alle globalen Probleme, im Besonderen natürlich für die Meinungsbildung von Wählern und damit für die politische Entwicklung.
Alle nickten. Heidenreich bedankte sich mit aufgehelltem Blick. Michaela Halbmond hob lächelnd den Zeigefinger und gab zu bedenken, wie hoch qualifiziert dieses ausführliche Lob sei, schließlich komme es von einem einschlägigen Profi des medialen Geschäfts.
Ich nickte, zwinkerte mit dem linken Auge und spielte den Ball zurück: Das mediale Geschäft sei ja immerhin die Wiege der politischen Hygiene.
Alle lächelten süffisant und Michaela übernahm den retournierten Ball erneut: »Ja, und nicht zu vergessen, dass man in der medialen Wiege auch die Kunst beherrscht, aus Hygiene Kosmetik zu machen und aus Sauberkeit Schönheit.«
Jetzt wurde das Gelächter so laut, dass andere Gäste ihre Köpfe drehten und vornehm schmunzelten. Der Ball lag wieder bei mir und ich wusste, dass ich jetzt vom Gas gehen musste, also sagte ich: »Sauber sein oder sauber aussehen – das ist die ewige Gretchen-Frage der Staatenlenker.«
Der Deutsche Prettner hob Einhalt gebietend die Hand und stimmte zu, dass die Wissenschaft heutzutage auch einen straffen Bildungsauftrag publizistischer Natur hätte, und also der Allgemeinheit gegenüber eine Pflicht zu erfüllen habe.
Elke Winter-Margulies hatte bisher nichts gesagt und kaum gelacht, sondern nur Michaela Halbmond und mich beobachtet. Ich sprach sie an: »Sie sind Paleolinguistin. Das ist ja ein schönes Wort.«
»Ja«, sagte sie gedehnt, »das habe ich am Anfang auch gedacht.«
»Aber es ist schon Wahnsinn«, sagte ich, »wieviel Wissen verloren geht, wenn Sprachen sterben und mit ihnen auch ihre Ideen verschwinden, ihre Erfahrungen, ihre Kulturen, alles einfach weg. Und sie stehen dann vor einem Totenschädel und müssen sich vorstellen, wie seine Aussprache geklungen haben könnte.«
Michaela Halbmond sagte nichts. Sie beobachtete die Reaktion ihrer Kollegin und wartete.
Elke Winter-Margulies hatte ihr studentisches Scheißdrauf-Gehabe beibehalten, das jetzt in ihren reiferen Jahren, wo sie zur etablierten Universitätslehrerin geworden war, etwas vulgär wirkte, aber immer noch suggerierte, dass man in das Establishment vordringen konnte, auch wenn man mit seiner ganzen Erscheinung dagegen demonstrierte. Dazu passte auch ihr gezogener Wiener Dialekt und sie redete mit weit geöffnetem Mund und einem Blubbern in der Kehle, als hätte sie den letzten Bissen noch nicht ganz verschluckt und bräuchte jetzt in dieser viel zu braven Nichtraucher-Gesellschaft endlich eine Zigarette. »Ja, ja, es gibt was Leichteres als Paleolinguistik«, sagte sie und ließ die Luft zwischen ihren geblähten Lippen entweichen, während sie mit dem Kopf wippte, »und nicht einmal die Totenschädel haben wir selbst ausgegraben, sondern die Archäologie.«
Sprachphilosoph Pflug stand leicht vornübergeneigt wie zu einer Verbeugung bereit, und nickte mitfühlend. »Herr Professor«, fragte ich ihn, »könnte man sagen, dass eine Sprache, wenn sie einmal verschwunden ist, gleichsam nie existiert hat? Oder ist das Gymnasiasten-Philosophie?«
Der Alte lächelte, als hätte ich versucht, ihm eine Falle zu stellen. Michaela Halbmond biss sich auf die Unterlippe. Sie hatte mich mitgebracht, jetzt war sie für mich verantwortlich und nahm die Verantwortung mit dem Charme einer souveränen Gastgeberin.
Professor Pflug nickte. Meine Frage sei kein bisschen naiv, versicherte er. Vielleicht sah er sie als dümmliches Journalisten-Wortspiel, möglich aber auch, dass er an dem Gedanken irgendetwas zulässig fand. »Wenn wir alles wüssten, was wir schon wussten, wären wir deutlich gescheiter«, sagte er väterlich. Wenn man gar nichts in der Hand habe, gebe es auch nichts, was man als vergangen betrachten könne.
Da tauchte die geschäftige Marketing-Dame des Verlages auf und holte Co-Autor Heidenreich weg, um ihn Bücher signieren zu lassen, und das so forsch, dass der Mann sich nicht einmal verabschieden konnte und nur kurz die Hand hob. Ein Tablett mit zu zwei Dritteln gefüllten Sektgläsern schwebte vorbei, gefolgt von einem Tablett mit bunten Häppchen.
Michaela Halbmond war offenbar die Einzige, die verstanden hatte, worauf ich hinauswollte. »Es gibt keine Spuren, die zurückführen, das ist richtig« sagte sie in privatem Ton. »Fragen der Sprachentstehung verlieren sich im Dunkeln. Sprache gibt es seit hunderttausend Jahren, Schrift aber erst seit achttausend. Und da waren die Sprachen schon lange zu Ende entwickelt.«
Ich wusste, dass sie wusste, dass ich spürte, wie ansatzlos sie mich verstanden hatte. Sie überging diese Direktverbindung: »Es gibt viele Theorien, aber höchstens eine ist nicht falsch. Also beschäftigen wir uns lieber mit dem, was wir angreifen können. Wir nehmen die Sprache, heben sie gegen das Licht, drehen und wenden sie, wir zerpflücken alles, was wir zwischen die Finger bekommen, und zwar so lange, bis alle fast verrückt werden. Wir studieren die Konstruktionspläne, die Organisationsstrukturen, wir machen typologische Gliederungen, wir vergleichen alles mit allem und jedem, greifen uns an den Kopf, pressen unsere Lippen aufeinander und dann vergleichen wir weiter.«
Ich hing an ihren Lippen. »Ja«, sagte ich, »ich verstehe.« Ich setzte an, ihr ein bisschen zu erzählen, was ich in den Tagen davor gelesen hatte, da tauchte das Team einer Studenten-TV-Station auf, das über die Buchpräsentation berichten wollte und Michaela Halbmond entdeckt hatte. Sie baten um ein Interview. Ich wich zur Seite, um nicht in das Bild zu geraten, doch sie hielt mich am Unterarm zurück. Ich solle doch einfach dableiben. Während sich das Team in Stellung brachte und das Kameralicht anging, spielte ich den Halbmond-Pressesprecher, der seinen Star vor der Paparazzi-Meute beschützen musste: »Ich hoffe, ihr seid keine Fake-Journalisten«, maulte ich, »dass ihr mir ja nichts aus der Luft Gegriffenes oder aus dem Zusammenhang Gerissenes berichtet.« Während die auf Journalismus machenden Uni-Kids verunsichert waren, ob sie sich nun rechtfertigen mussten, grinste Elke Winter-Margulies schadenfroh und Michaela lächelte ihnen ermutigend zu. Im Interview parierte sie das Interesse an ihrer Person und lenkte es gekonnt auf die Buchautoren und deren Werk.
Als das Team abgezogen war, kam sie von selbst auf das Gespräch von vorhin zurück. Bezüglich Spuren in die Vergangenheit wolle sie ein interessantes Phänomen erwähnen, das bei abgelegenen Naturvölkern zu beobachten sei. Es betreffe den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken und weise tatsächlich Reste früherer Entwicklungsstadien der Sprache auf.
Ich nickte aufmerksam. Davon könnten besonders Journalisten etwas lernen, schmunzelte sie, denn diese Naturvölker weigerten sich, über Menschen und Dinge zu sprechen, die sie nicht persönlich kannten. Sie lehnten es ab, sich über etwas zu äußern, das sich außerhalb ihres eigenen Wahrnehmungsbereiches befand, auch, wenn es sich logisch ergab. »Also ein Beispiel«, sagte sie, »man stellt, sagen wir, einem kaukasischen Nomaden folgende Denkaufgabe: ›In Afrika sind alle Menschen schwarz. Nairobi ist eine Stadt in Afrika. Welche Hautfarbe haben die Einwohner Nairobis?‹ Die Antwort des Kaukasiers ist eindeutig: ›Dazu können wir nichts sagen. Wir waren noch nie in Nairobi.‹« Ich prustete viel zu laut los.
Ihre Augen glitzerten und sie gab ein weiteres Beispiel. »Frage: ›In Österreich essen alle liebend gern Wiener Schnitzel. Herr Bauer ist Österreicher. Welche kulinarischen Vorlieben hat Herr Bauer?‹ Antwort des kaukasischen Nomaden: ›Wir wissen nicht, was Herr Bauer am liebsten isst. Wir haben ihn noch nie getroffen.‹« Ich bog mich. Und sie blickte mich an, als hätte sie an meinem Lachen etwas erkannt.
Sie kam in Fahrt und holte eine weitere Geschichte hervor. Lustig sei auch, wie sich Unterschiede in der persönlichen Wahrnehmung von Farb-Eindrücken in verschiedenen Sprachen äußerten, sagte sie. Doch plötzlich, noch bevor sie mit ihrer Ausführung beginnen konnte, legten sich von hinten zwei Hände mit rot lackierten Nägeln auf ihre Augen und sie hielt inne. Sie drehte sie sich um. Ihre Augen blitzten. Sie riss ihre Arme hoch und im nächsten Augenblick lagen sich zwei Freundinnen wie kreischende Schulmädchen in den Armen, die sich ewig nicht gesehen hatten. Sie fassten sich gegenseitig an die Wangen, rissen die Augen und die Münder auf und schüttelten ungläubig die Köpfe. Florence. Université de Paris. Jowulu. Gemeinsame Abenteuer, gemeinsam Geschichte geschrieben. Plötzlich wiedervereint.
»Warte«, sagte Michaela zu ihr, »ich muss nur meinen Satz zu Ende sagen.« Sie lenkte die Aufmerksamkeit ihrer Freundin auf mich und stellte mich als befreundeten Journalisten vor. Florence lächelte subversiv und ihre Augen vermaßen mich offen von oben bis unten. Michaela hielt sie an der Hand, während sie zum Thema zurückkam: »Ah ja. Das ist lustig. Sprachen aus verschiedenen Kulturen verwenden höchst unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dieselbe Farbe, beziehungsweise verwenden sie gleiche Bezeichnungen für höchst unterschiedliche Farben. Wenn ein mexikanischer Indio azul sagt, dann meint er eine Farbe, die ein Europäer als tiefblau bezeichnen würde. Doch der Indio sagt auch azul, wenn der Europäer mittelgrün sagen würde. Und dieser Indio sagt zu sämtlichen Tönen zwischen tiefblau und mittelgrün dasselbe azul. Oder putzputz. Das bedeutet alles zwischen gelbgrün und orange. Sp`up `oko heißt gleichzeitig braun, blau und grün.« Die Bedeutung, die der sprechende Mensch den Wörtern gebe, sei von seiner persönlichen Wahrnehmung und Umgebung abhängig. Wahrnehmungen seien individuell und relativ. »Okay?«
Ich grinste und sagte »Okay«. Ich hatte mich vorhin schon am Riemen gerissen, um ihr nicht zu nahe zu treten, aber jetzt musste ich doch wieder Witze machen: »Der transkulturelle multilinguale Beziehungsstreit ist eine programmierte Sache«, sagte ich, »Schatz, wieso sagst du ständig gelb, wenn ich blau sage? Aber ich bitte dich, ist das nicht dasselbe in Grün?« Sie übersetzte für Florence und jetzt hielten sich beide die flache Hand vor den Mund und kicherten.
Ich nickte einem Kellner zu, der ein Tablett mit Sektgläsern durch den Raum balancierte und Ausschau nach geneigten Gästen hielt. Ich fragte die beiden Damen, ob sie denn Lust hätten, anzustoßen. Natürlich hatten sie. »Nur her mit dem Alkohol«, rief Florence. Ich griff nach Gläsern, reichte sie weiter, bedankte mich beim Kellner und erhob mein eigenes.
Die Zeit war verflogen. Der Saal hatte sich halb geleert, ohne dass ich es bemerkt hatte. Der Termin war an sein Ende gekommen und Michaela Halbmond hatte Besuch. Ich reichte ihr die Hand. »Das war ja eine nette Party«, sagte ich.
»Ja.«
»Wir sind gar nicht zum Reden gekommen.«
»Ja. Ich weiß.«
»Das müssen wir aber. Ich hab einen Haufen vermutlich hochgescheiter Fragen.«
Sie lächelte und nickte.
Ich verließ die Buchpräsentation. Ich ging über die breiten, unter einem roten Teppich liegenden Stufen hinunter ins Parterre. Rechts vom Ausgang saß Professor Pflug auf einem barocken Polstersessel und fingerte unbeholfen an seinem Mobiltelefon herum. Ich wollte dem Sprachphilosophen noch die Hand zum Abschied reichen, da zeigte er auf die Sitzbank neben sich und bedeutete mir, mich zu ihm zu setzen.
»Sie haben völlig recht«, sagte der alte Professor, als würde er erst jetzt, unter vier Augen, offen reden können, »aber es ist noch viel drastischer.«
Er steckte das Telefon unverrichteter Dinge weg, nahm sich die Brille von der Nase, rieb sich die Augen und setzte sie wieder auf. Er sagte: »Wir verstehen nicht nur das System Sprache nicht. Wir verstehen auch nichts, was mit ihr zusammenhängt. Wir verstehen nicht, woher sie kommt, wie sie entstanden ist, was sie will und kann und wie sie funktioniert. Weder verstehen wir, warum sie so plötzlich aufgetaucht ist, noch, warum sie in einer dermaßen großen Vielfalt aufgetaucht ist. Wir verstehen nichts. Nicht einmal, was Sprache im Grunde eigentlich ist. Und wir verstehen nicht, warum wir hier so gar nichts verstehen, wo wir doch ansonsten so viel verstehen, weil wir ja gar nicht so untalentiert sind.«
Ich schwieg. Das gehörte zu meinem Thema. »Wissen sie«, fuhr er fort, »unlängst habe ich versucht, ein Porträt über einen langjährigen Kollegen und alten Freund zu verfassen, für eine Publikation, die zu seinen Ehren herausgegeben wird. Ich bin kein Schreiber, aber Menschen zu porträtieren habe ich immer wieder gern einmal versucht, weil es für mich eine große Herausforderung war, die Unbegreiflichkeit dieses Wesens zwischen den Wörtern und zwischen den Zeilen zum Vorschein kommen zu lassen.«
Seine unter einem milchigen Film liegenden Augen blickten unscharf zur hohen Decke. »Doch wenn es darum geht, einen Menschen so zu beschreiben, dass er am Ende mehr ist als eine interessante Mischung aus Rätselhaftigkeiten und Widersprüchen, stellt sich die Frage, warum wir gerade das Nichtbegriffene an einem Menschen als wesenstypisch anerkennen.«
Er blickte wieder mich an: »Wir sehen den Menschen wie ein Foto-Negativ. Wir umgarnen die weißen Flächen mit Behauptungen, Indizien und Spekulationen. Mit Interpretationen, Unterstellungen und aus der Luft Gegriffenem. Wir versuchen alles, ihn zu greifen, um letztlich doch in resignierter Faszination vor dem Mysterium Mensch zurückzuweichen. Einer Faszination, die mit der eigenen Unbekanntheit einhergeht und dem Scheitern etwas Versöhnliches gibt. Nun: Was ist daran so schwierig, einen Menschen zu verstehen? Was macht diese Unbegreiflichkeit aus?«
Ich schwieg. Der Mann sprach mir aus der Seele. Alles, was er sagte, klang wie ein Vermächtnis, das er noch schnell übergeben musste.
»Schaut man sich unaufgeregt an, was dieser Mensch alles kann«, holte er aus, »betrachtet man seine Talente und sein Potenzial, dann wird diese gegenseitige Unbegreiflichkeit selbst zu einem Rätsel. Dieses Wesen Mensch verfügt über Fähigkeiten, die es zu einem unheimlichen Fremdkörper in der Natur gemacht haben. Es operiert mit einem Denkorgan, dessen gigantische Aktivitäten von absoluter Beispiellosigkeit sind. Gespeist von einem Netz unterschiedlichster Wahrnehmungs- und Überwachungssysteme, die in millionenfacher Gleichzeitigkeit alles und jedes an dieses seltsame Organ übermitteln, welches alles und jedes aufsaugt, abbildet, einstuft, vergleicht, speichert und es in Bereitschaft für einen Wiedereinsatz bringt, dessen Voraussichtlichkeit es schon berechnet hat. Einem Organ, das sich selbst ununterbrochen auf den neuesten Stand bringt und sein eigenes Potenzial immer weiter steigert.«
Pflug nahm sich mit einem schnellen Griff die Brille wieder von der Nase und richtete seinen Oberkörper ruckartig auf. »Nun frage ich«, sagte er, »was hindert den Besitzer und Benützer einer solchen Intelligenz-Fabrik daran, einen artverwandten Besitzer einer gleichen Intelligenz-Fabrik richtig zu begreifen? Was macht diesen Intelligenz-Fabrikanten so begriffsstutzig, dass er beim Erfassen eines ihm selbst sehr ähnlichen Fabrikanten-Kollegen aufgeben und auf armselige Ersatz-Etiketten ausweichen muss? Er muss ihn als tiefsinnig oder hintergründig bezeichnen, obwohl das Begriffe sind, die zwar Großes suggerieren, aber nichts aussagen, außer, dass man nichts verstanden hat? Was zwingt uns, den Menschen hilflos über seine weißen Flecken zu identifizieren und ihn letztlich als Rätsel hinzunehmen?«
Ich wusste die Antwort, aber ich sagte nichts. Ich wollte auf keinen Fall seinen Redefluss unterbrechen. Ich musste hören, wie das weiterging. An uns vorbei strömten Gäste, die die Buchpräsentation verließen. Manche verabschiedeten sich beim Professor mit einem Nicken oder einer erhobenen Hand. Michaela und Florence waren nicht dabei. Ich warf einen Blick die Stiege hinauf, aber sie waren nicht zu sehen. Sie mussten noch in diesem Festsaal sein. Ich konnte sie doch nicht beim Vorbeigehen übersehen haben.
Der Professor fuhr fort: »Da ist also dieser aufgerichtete Zweibeiner, der sich einmal auf die Hinterläufe gestellt hat, um ein Männchen zu machen und seither nie wieder aufgehört hat, Männchen zu machen, und wir durchschauen seine Männchenmacherei einfach nicht, obwohl wir selber die gleichen Männchen machen.«
»Wenn sie erlauben, habe ich dazu eine Frage«, sagte ich. »Könnte es sein, dass es nicht an unserer Intelligenz liegt, sondern daran, dass wir keine passenden Begriffe finden, den Menschen richtig zu fassen, ihn treffend zu verbegrifflichen? Könnte es nicht daran liegen, dass wir uns also einfach nicht »denken können« wie er ist und es daher an der misslingenden Versprachlichung unserer Eindrücke scheitert?«
Noch bevor der Professor antworten konnte, riss meine höfliche Zurückgenommenheit: »Wäre es nicht möglich, dass alles umgekehrt ist? Mir scheint, wir halten den Menschen für ein Mysterium, dabei ist nicht der Mensch das Mysterium, sondern seine Sprache. Nicht das Sein bestimmt das Bewusstsein, sondern die Sprache und nichts als die Sprache.«
Er wartete darauf, dass ich weiterredete. Nachdem ich einige Atemzüge geschwiegen hatte, sagte ich: »Ich habe da oben heute so manchen interessanten Menschen getroffen und alle sind auf einer glaubhaften Suche. Aber, wenn ich Ihnen als Laie mit meinen profanen Wortspielereien nicht zu nahe trete, Herr Professor, was suchen diese Forscher denn, wenn nicht passende Worte? Sie suchen eine Sprache für die Sprache. Und wäre es denn so unmöglich, dass das Problem weniger vom Forschungsgegenstand ausgeht als vielmehr vom Untersuchungsinstrument?«
Der Linguisten-Greis blickte verschwommen auf und lächelte ermunternd auf meine Jugend hin, als wollte er sagen, mach nur, lauf los, ich bin zu alt dafür. Und ich wollte in diesem Lächeln etwas wie Gerührtheit entdeckt haben. Möglich, dass ich mir das eingebildet habe. Er war ein kultivierter Mensch, der alles leben ließ und mit Höflichkeit bediente.
Draußen auf der Straße, als der Nachtwind durch meinen Kopf blies und die Bilder dieser Veranstaltung wie Laub aufwirbelte, beschloss ich, zu Fuß nach Hause zu gehen, obwohl die Strecke gut vier, fünf Kilometer betrug. Ich mochte diese Linguisten-Gesellschaft. Auch, aber eigentlich gerade weil sie mit so viel Ehrlichkeit im Dunklen tappte und das innere Wesen ihres Forschungsgegenstandes sich ihrem Zugriff so entschieden entzog. Sie befasste sich mit der Karosserie der Sprache, hatte ihre Motorhaube geöffnet und hantierte staunend an einem fremdartigen Triebwerk herum. Ein weltweites Heer von Fachleuten diskutierte frei zusammengebaute Thesen, deren Substanz sich darauf beschränkte, nicht widerlegbar zu sein. Zig Fachzweige waren entstanden, Zigtausende Bücher geschrieben und Tausende Lehrstühle weltweit eingerichtet worden. Abertausende Forscher hatten ihre Antennen ausgefahren. Doch eine Gesetzmäßigkeit, nach der Sprachen entstanden, sich entwickelten und wieder untergingen, war nicht zu erkennen. Also setzte sich die Meinung durch, es gäbe keine Gesetzmäßigkeit und alles passiere zufällig, chaotisch. Das Rätsel »Sprache« war so rätselhaft, dass die Fachwissenschaft nicht einmal wusste, wie und wonach sie eigentlich genau fragen sollte. Jede klare Antwort machte sich da verdächtig. Ich meine, Antworten gab es endlos viele. Doch nur von Fremddisziplinen, die für nichts verantwortlich waren, aber den Mund offen hatten. Was sie hervorbrachten, war meisterhaft aus der Luft Gegriffenes, virtuose Fantastereien. Schöne, vernebelte Luftschlösser. Da gab es viele großartig formulierte Aussagen aus hochintellektuellem Unverständnis. Manche wollten die Sprache in eingeschüchterte Reimchen-Poesie zwängen (»Ich fürchte mich so sehr vor der Menschen Wort«, der arme kleine, große Rilke). Ich meine, es gab schon auch Pragmatiker, die wussten, dass Sprache etwas mit Krieg und Frieden zu tun haben musste und sie arbeiteten an der Realisierung einer Utopie: Sie versuchten, eine Einheitssprache für die Menschheit zu konstruieren, gedacht für den Frieden der Welt, wie sie sagten, denn dass Gott die Menschen in so vielen verschiedenen Sprachen aneinander vorbeireden ließ, war keine schöne Vielfalt, sondern die reine Geißel. Aber niemand wollte die seelenlose Sprache vom Reißbrett sprechen. Sie hätte auch kaum die allgemeine Sprachverwirrung behoben, denn die Sprachverwirrung trat nicht nur zwischen verschiedenen Kultursprachen auf, sondern auch innerhalb ein und derselben. Jeder einzelne Mensch sprach seine eigene unübersetzbare Weltsprache, die nicht nur von allen anderen Sprachen verschieden war, sondern auch von denen anderer Menschen innerhalb derselben Sprache. Es gab nicht siebentausend Sprachen, sondern acht Milliarden.
Ich überquerte die Wienzeile und kam meiner Wohnung näher. In meinem zunehmend durchlüfteten Kopf klangen Sektgläser nach und Bilder von angeregt plaudernden Menschen flackerten wie in einem alten Stummfilm.
Mir war bewusst, dass mein Verdacht von der funktionsuntauglichen Sprache einigermaßen radikal war, hoch veränderungsschwanger und zu unruhig für eine konfliktscheue Gesellschaft, die dermaßen an Ordnung hing, dass sie sich auch mit einer Illusion von Ordnung zufrieden gab. Aber wenn ich recht hatte, stand die Welt Kopf. Und ich hatte recht. Die Welt stand Kopf. Zwei Tage später kam die Bestätigung.