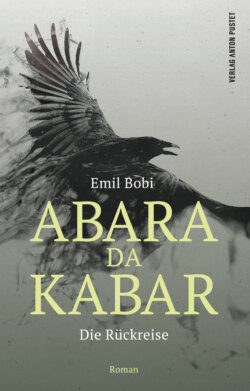Читать книгу Abara Da Kabar - Emil Bobi - Страница 9
3
ОглавлениеAls ich das Haus verließ, war die Konferenz noch nicht zu Ende, aber ich war schon in die Gegenrichtung unterwegs. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, aber im Rückblick kommt mir vor, dass ich da mein Ziel bereits gepeilt hatte. Ich griff nach einem Notizblock und zwei oder drei Bleistiften mittlerer Härte, hielt inne, ließ beides wieder fallen, wollte mich zum Gehen abwenden, nahm das Schreibzeug dann doch an mich und ging. Richtung Anfang.
Auf der Straße bemerkte ich, dass es auch etwas wie Wetter gab. Es hatte geregnet und mittlerweile schon wieder aufgehört. Die Luft war warm und nass wie in den Tropen und es wurde langsam dunkel. Im Westen war die Wolkendecke aufgerissen, aber die untergehende Sonne hatte es zum Glück nicht mehr geschafft, noch einmal in die wohlige Regendüsternis zu leuchten und sie kaputtzumachen mit ihren letzten, dünnen Strahlen, die ohnehin schon zu schwach waren, den Tag noch einmal zurückzubringen. Jetzt begann es von Osten her erneut zuzuziehen. Fettiges, hochschwangeres Gewölk kroch heran und hielt knapp über der Stadt. Über den Kanten der Häuserschluchten stand eine vulgäre Decken-Freske aus schwarzen Bäuchen wie regloser Rauch. Die Mariahilfer Straße war wie ein in schwarzen Fels getriebener Stollen hinunter zur Zweierlinie, in dem es donnerte und hupte und rot vor Bremslichtern flackerte, als würde eine angelaufene Evakuierung nicht funktionieren. In der U-Bahn roch es nach feuchten Menschen und dem nassen Moder von Altkleidern. Am Stephansplatz lagen die Pflastersteine im Widerglanz bunter Leuchtreklamen und ein obdachloser Zeitungsverkäufer lächelte ermutigend. Die Dame in Louis Vuitton schleppte alleingelassen ihre Einkaufstaschen und warf tapfer ihre Mähne in den Nacken. Im Stravinsky war alles voll.
Im Stravinsky war immer alles voll. Es war einfach zu klein, um nicht voll zu sein. Schon nachmittags kehrte hier die tägliche Feierlichkeit ein und heizte die Kneipe auf Betriebstemperatur. Wer das Stravinsky betrat, der erschien wie auf einer Bühne. Er lächelte bescheiden nickend, als bedanke er sich für den Applaus. Die Luft war erfüllt mit gelassenem Lachen, verziert mit dem dünnen Klirren von Sektflöten und zerhackt von schwer aneinander gerammten Krügeln. Glühende Augen wanderten. Grauberger von der Innenpolitik des Wiener Boten lehnte an der Theke und war in die druckfrische Abendausgabe seiner Zeitung vertieft. Er las seine eigene Geschichte, die er wenige Stunden zuvor abgegeben hatte. An einer Textstelle lachte er schallend auf, nickte anerkennend und legte das Blatt zur Seite. Er bestellte ein neues Bier, dazu einen Schnaps, rauchte sich eine Zigarette an und lächelte nickend in sich hinein.
Ich ging manchmal ins Stravinsky, weil ich den Gestank dort mochte. Alle pafften eine nach der anderen und durch den stehenden grauen Nebel wanden sich blaue Rauchschwaden. Es roch sauer nach altem Bier und schaumig nach neuem. Zwischen Duftfäden aus Moschus oder sowas stank das Holz modrig nach Alter. Die Wandverkleidungen, die Sitzbänke, die Theke, die hinterspiegelten Regale, alles vor mehr als 100 Jahren wie aus einem Stück Holz geschnitzt und geschwärzt von den tausend Nächten und den tausend Geschichten.
Da entdeckte ich Paul. Er stand da, sein Schnauzer hing ihm zerfranst über die Unterlippe und wie eh und je schmunzelte er wissend, als wäre er nie weggewesen. Paul, das war alte Schule. Um Leute wie ihn zu treffen, kam ich manchmal hier her.
»Und?«, sagte er, »was schreibst?«
»Was weiß ich«, sagte ich abwehrend, »etwas über Sprache.«
Paul zog die Brauen hoch und wartete.
»Na schau«, sagte ich, »die Story lautet: Die Sprache ist an allem schuld. Nicht der Mensch ist böse, sondern die Sprache. Sie ist sehr, sehr böse. Sie macht alles kaputt, weil sie selbst kaputt ist.«
Paul schmunzelte: »Sprachkrise. Eh gut. Wann kommt das?«
»Ich habe erst angefangen. Ich muss einmal jemanden finden, der mir so etwas zumindest entfernt bestätigt, oder wenigstens ansatzweise nicht dementiert. Bisher habe ich nur bemerkt, dass Sprache ein endlos riesiges Gebiet ist. Seit Jahrtausenden sagen alle gescheiten und weniger gescheiten Menschen etwas über sie. Und sie alle umschreiben mit schönen, intelligenten, oder anderswie interessanten Sätzen, dass sie keine Ahnung haben, was Sprache überhaupt sein soll.«
Er nickte. »Ich bin froh, dass ich in Pension bin.«
Grauberger hob den Kopf und grinste. Der lange Kellner mit der Glatze und der sicherheitshalber vornübergebeugten Körperhaltung fischte den vollen Aschenbecher von der Theke und ließ den Inhalt mit der Fingerfertigkeit eines Trick-Magiers im Abfallkübel verschwinden.
»Aber wen willst du wirklich damit zitieren?«, fragte Paul, »du kannst ja nicht daherkommen und sagen, ich, liebe Leute, sage euch hiermit, eure Sprache hat einen Totalschaden. Die werden sagen, lieber Herr Reporter, vielleicht sind doch sie selbst es, der einen Totalschaden hat.«
»Weiß nicht«, sagte ich, »ausgegangen bin ich von einer harmlosen Geschichte über Wahlkampf-Sprache, weißt eh, qua, qua, über tiefenpsychologisch und manipulativ sein wollendes Spitzenkandidaten-Gestammel und so weiter. Aber wenn man auch nur ein bisschen genauer hinschaut, wird die Sache gleich höchst gescheit und dann drängen sich Fragen auf, die die Sprache selbst betreffen und alles, was da dranhängt und dahintersteckt. Und weißt du, was da dahintersteckt? Alles. Einfach alles.«
Da hob sich Pauls Zeigefinger wie ein Stoppsignal: »Moment. Ich kenne da jemanden über zwei Ecken, der vielleicht was für dich ist. Ein emeritierter Linguistik-Professor. Hans Reich. War sehr umtriebig. Hat in den USA und in der Ukraine gelehrt. Ich weiß nichts Genaueres. Jedenfalls hatte er Jahre lang Streit mit Kollegen auf der ganzen Welt, weil er der Meinung war, dass diese Vielzahl an Sprachen, die es gibt, aus einer einzigen Ursprache hervorgegangen ist, und der Mensch daher nicht an mehreren Orten unabhängig voneinander zu sprechen begonnen hat.«
»Das denken viele«, sagte ich.
»Ja, aber Reich sagt, dass die Sprachpioniere die Schrift vom Himmel abgelesen haben. Dabei ist er überhaupt kein Spinner.«
Das interessierte mich. »Der Mann durfte an Universitäten lehren?«
»Genau«, sagte Paul, »das ist der Streitpunkt. Er ist übrigens einer aus der Familie des Wilhelm Reich.«
»Aha? Wilhelm Reich himself?«
»Großneffe oder sowas.«
Grauberger schaltete sich ein. Wilhelm Reich sei einer der Helden seiner jungen Jahre gewesen. Er, Grauberger, habe ihn auf eine Stufe mit Leuten wie Gandhi und Nietzsche gestellt. Ein echter Regenmacher sei das gewesen. »Die Deutschen«, sagte er und sein Gesicht zuckte vorwurfsvoll nach oben, »die Deutschen wären besser Reich gefolgt. Aber Hitler hat ihnen besser gefallen. Kein Wunder. Hitler hat ihnen eingeredet, dass sie toll sind und überhaupt die besten. Reich aber hat die Wahrheit gesagt. Ein Aufdecker, der niedergemacht wurde, weil niemand seine Enthüllungen ertragen konnte.«
Er nahm einen Schluck vom Bier und zog ärgerlich an der Zigarette. »Reich hat gesagt, dass das deutsche Volk flächendeckend an einer Zwangsneurose leidet. Jede einzelne typisch deutsche Charaktereigenschaft ist ein Symptom der Zwangsneurose. Dieses als große Tugend besungene Kompanie-Verhalten der Deutschen ist ein Krankheitsbild.«
Die Österreicher seien auch nicht ganz frei von diesen Symptomen, warf Paul ein.
Grauberger nickte, zog an der Zigarette und hob den Zeigefinger, während er den Rauch ausstieß, um einstweilen keine Wortmeldungen zuzulassen. »Und Freud!«, schnappte er, »dieser narzisstische, schwanzgesteuerte Traumtänzer hat Reich als kommunistischen Auftragsforscher verunglimpft und umbringen wollen, wissenschaftlich zumindest, aus purer, blinder, primitiver Eifersucht, weil Reich zu viel erkannt hatte und es wagte, Freuds Unsinn vom natürlichen Todestrieb des Menschen zu widersprechen.« Grauberger redete sich in eine Aufgebrachtheit, die er mit gierigen Zigarettenzügen stabilisierte.
Paul wendete sich mir zu: »Ich schicke dir seine Nummer, weiß aber nicht, wo er sich aufhält.«
Am winzigen Tisch in der hinteren Ecke saßen drei parlamentarische Mitarbeiter sozialdemokratischer Abgeordneter und der Sprecher des Sozialministers unter vergilbten Plakaten und in zu engen italienischen Anzügen. Der Pressesprecher, Mayer, hatte das roteste und am stärksten aufgequollene Gesicht der Runde. Offenbar war er den ganzen Tag nicht zum Essen gekommen, stürzte sich jetzt gierig auf den Teller mit Frischkäse, Tomaten und Basilikum, den ihm der lange Kellner mit einem kunstvollen Schwung vorgesetzt hatte. Mayer überschüttete das Gericht mit viel zu viel von dem dunkelroten Weinessig und viel zu wenig Olivenöl und keuchte beim ersten Bissen wie ein geschocktes Waldtier. Dann entdeckte er mich, hob abwehrend die Hand und kündigte an, die versprochenen Unterlagen zu irgendeiner Geschichte »umgehend« zu übermitteln: »Kann ich dich morgen anrufen?«
»Sicher, immer, hungriger Mensch«, sagte ich, »aber iss langsamer. Sonst sage ich es den SPÖ-Frauen.«
Mayer nickte schräg und deutete ein müdes Lächeln an. Er war stets bemüht, den Schreiberlingen alles rechtzumachen, auch wenn sie noch so viel Mist schrieben. Er signalisierte Unterwürfigkeit vor allen Medien, das war sein berufliches Versprechen und seine Grundstellung. Ich hatte mein Mineralwasser noch nicht angerührt, stürzte es jetzt in einem Zug hinunter, umarmte Paul, boxte Grauberger sanft in den Bauch, zeigte Mayer den erhobenen Daumen und verließ das Stravinsky.
Es hatte nicht mehr zu regnen begonnen. Die Stadt war still geworden und meine Schritte klopften auf den Pflastersteinen. Die Stimmung, die sich nach der Redaktionssitzung breitgemacht hatte, war vom Lärm im Stravinsky verdrängt worden und tauchte jetzt wieder auf. Ich spazierte über den Stephansplatz, bog hinunter in die Rotenturmstraße, vorbei am verlassenen Standplatz der Pferdefuhrwerke, von denen nur der scharfe Geruch nach Dung und Urin zurückgeblieben war. Ich mochte diesen Duft. Er hatte nichts Abstoßendes für mich. Man sollte ein Parfüm mit einer Note »Pferd« machen, dachte ich. Eines dieser intelligenten Parfüms, die nicht einfach nur nach etwas rochen, sondern subtile Duftbilder öffneten, die sich veränderten wie die Jahreszeiten, je länger sie auf der Haut waren und deren flüchtige Noten von keiner Nase begriffen werden konnten. Pferdedung, Whisky, Weihrauch vielleicht. Vielleicht auch Zimt und etwas Lemoniges. Nein, Zimt ist zu süß, vielleicht eher Sandel oder Elefantengras dachte ich, aber Elefantengras ist ja auch süß, also keine Ahnung, ich wusste ja nicht, welchen Gesetzen die Alchemie der Düfte folgte. Von allen Bestandteilen musste man jedenfalls so wenig verwenden, dass man sie nicht direkt erkannte und sie gemeinsam in einem völlig neuen Duft aufgingen, der diffus und ungreifbar an Verschiedenes erinnerte, man aber nichts davon nennen konnte.
Ich bog in die Bäckerstraße. Ein zitronengelber Lamborghini, der gegen die Fahrtrichtung unterwegs war, wurde heruntergebremst und fauchte aggressiv. Seine nass-roten Bremslichter stachen wie zwei Lichtschwerter schräg in die alte Gasse. Dann erloschen sie wieder und die Bäckerstraße sank zurück in ihre mittelalterliche Dunkelheit.
»Der Sprachfehler. Das Kommunikationssystem, das den Menschen zum Menschen macht, funktioniert nicht.«
Ok. Ist ja ok, sagte ich mir, ruhig Blut. Man kann ja jederzeit dazulernen. Man kann etwas Neues entdecken und dann ändern sich halt die Sachverhalte. Das ist Entwicklung. Jeden Tag werden neue Dinge entdeckt, die alte Denk-Gebäude zusammenfallen lassen. Ein Knochenfund, und schon muss die Geschichte umgeschrieben werden. Aber dann wird sie eben umgeschrieben und es geht weiter. Doch wenn die Sprache nicht das ist, was man dachte, dass sie ist, geht nichts mehr weiter. Dann ist nicht nur ein Knochen falsch, sondern alles. Absolut alles müsste umgeschrieben werden. Aber diesmal kann nichts umgeschrieben werden. Mit welcher Sprache denn?
Ich weiß nicht mehr, wie die Zeit an diesem Abend so schnell vergehen konnte. Es war schon lange nach Mitternacht, als ich in der Bäckerstraße stand und mich umdrehte. Der Lamborghini lauerte an der Ecke. Er röchelte unter dem Würgegriff seiner Bremsen und harrte der Entscheidung, in welche Richtung er nun hechten sollte. Die beiden Insassen schienen sich zu streiten. Er, der am Steuer saß, schüttelte heftig dementierend den Kopf. Sie, am Beifahrersitz, schnappte bekräftigend nach ihm und ihr Gesicht zuckte immer wieder in seine Richtung, als würde sie ihn anbellen. In den östlichen Himmel schlich das erste Violett und wie eine Wettererscheinung zog eine riesenhafte schwarze Wolke russischer Saatkrähen von Westen her lärmend über die Stadt auf dem Weg in den Prater, wo sie wie Früchte schwer in den Baumkronen hängen wollten.
Ich hatte Lust einzuschlafen und einige Tage vorher wieder aufzuwachen, damit sich alles als Traum herausstellen konnte. Ich musste lachen. Ich musste angreifen. Ich musste so tun, als sei alles nur eine Zeitungsgeschichte. Ich musste einfach nur einmal angreifen und dann weitersehen. Also griff ich an: Wo also lag der Fehler? Was genau funktionierte nicht? Was war das überhaupt: Sprache. Gab es Menschen der Sprache, die über ihr zentrales Informationsübermittlungssystem sagten, es funktioniere nicht? Linguisten? Denker? Dichter? Bauern? Räuber? Geisteskranke? Egal, ich würde sie finden.
Wo die Recherche langgehen musste, war klar, es gab ohnehin nur eine einzige Vorgangsweise: Hinfahren und nachschauen. Es gab keine Alternative zur Reporter-Absoluten des Hinfahrens und Nachschauens. Reportagen waren im Homeoffice nicht machbar. Nichts auf der Welt war so, wie es sich vom Schreibtisch aus gesehen darstellte. Alles änderte sich radikal, wenn man hinfuhr und nachschaute.
Ich wusste, was ich zu tun hatte. Es war mir nie unklar. Ich musste mich auf die klassische Suche nach dem verlorenen Schlüssel machen. Ich musste den Weg zurückgehen, den mein Untersuchungsgegenstand durch seine Geschichte genommen hatte, den Blick dabei immer konzentriert am Wegrand, und wenn da kein Schlüssel zu entdecken sein würde, würde mich mein Weg eben ganz zurück bis an seinen Anfang führen.
Ich ging davon aus, dass das Hirnprogramm »Sprache« nicht als Missgeburt auf die Welt gekommen war, denn das machte nun wirklich keinen Sinn. Das Menschengehirn war doch nicht eine Million Jahre lang gewachsen, um sich in die Lage zu bringen, die massenhaften Schaltungen der Sprachverarbeitung zu bewältigen, nur um dann nicht zu funktionieren. Ich glaubte an die Intelligenz der Natur und an die komplexe Sinnhaftigkeit ihrer Funktionsweisen. Nein, bei der Geburt der Sprache musste alles noch geklappt haben. Es musste unterwegs eine Panne aufgetreten sein. Vielleicht etwas wie ein Ur-Missverständnis, das sich fortgepflanzt und ausbreitet hatte wie ein Virus. Dann wäre das Problem kein technischer Defekt, sondern die Folge falscher Anwendung oder so. Wie konnte es überhaupt sein, dass die Sprache Lügen zuließ? Und wozu wurde sie denn erfunden? Weil den Hominiden langweilig war und sie ihre Nachbarn ausrichten wollten? Wohl kaum. Die Erfindung oder Entdeckung oder wie immer der Beginn der syntaktischen Laut-Kommunikation zu nennen war, musste doch im Kern dem Bedürfnis gefolgt sein, die Welt zu erklären. So dachte ich jedenfalls.
Ich sah mich bei einem Naturvolk, von dessen Sprache ich kein Wort verstand und es dennoch kennen und verstehen lernte, ohne eine Vorstellung zu haben, wie das funktionieren sollte. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ich zurück musste zum Ursprung. Ich benötigte einen Lokalaugenschein bei den Anfängen der Menschen-Sprache. Aber wie das gehen sollte, wusste ich noch weniger. Der Weg zurück war nicht nur versperrt. Es gab ihn nicht. Genauer gesagt war er nicht einmal denkbar. Sprachen kamen und gingen und die meisten von ihnen hinterließen schon deshalb keine Spuren, weil sie keine Schrift kannten. Und Wörter waren Muster aus Schallwellen, die im Wind verschwanden. Gesprochene Sprache war deformierte Luft. Davon blieb nichts als Luft. Da gab es nichts auszugraben, von dem man rückschließen konnte.
Na, viel Glück, dachte ich in der Morgendämmerung auf der Straße stehend. Ich schüttelte den Kopf. Entschuldige, fragte ich mich, bitte um Verzeihung, Herr Ober-Reporter, wo geht es hier zurück zum Ursprung der Sprache? Gehst du da vorne an der Ecke links oder rechts?
Es wäre untertrieben zu sagen, ich sei vor dem Nichts gestanden. Einmal verschwundene Sprachen waren so verschwunden, dass sie eigentlich nie existiert hatten. Nicht nur die Sprache als solche war Vergangenheit, auch ihre Geschichte hatte sich aufgelöst und selbst die Erinnerung an ihre Geschichte war verloren, weil auch Erinnerung nichts als gespeicherte Sprache war. Ich stand vor einer Sprach-Vergangenheit, die selbst nicht mehr existierte. Wie sollte ich rekonstruieren, was früher war, noch vor meiner eigenen Sprache? Abertausende von ihnen waren gekommen und gegangen. Sie verzweigten sich wie die Äste einer Baumkrone, hielten einige Jahrhunderte, veränderten sich und ihre Benutzer und verschwanden wieder. Sie starben ab und hinterließen keine Hinweise auf ihre Existenz. Sogar die meisten Sprachen der Gegenwart kannten übrigens keine Schrift und verschwanden eine nach der anderen mit ihren Sprechern noch spurloser als die Sprecher. Wo sollte ich also in der Vergangenheit einen Fehler finden, wenn es das Umfeld selbst nicht mehr gab, in dem er passierte?
Ich ging nach rechts. Hinunter zum Schwedenplatz und über die Brücke auf die andere Seite des Donaukanals, wo ich mein Fahrzeug geparkt hatte. Ich nahm den Strafzettel nicht von der Windschutzscheibe, er würde von selber verschwinden, sobald ich den Scheibenwischer einschaltete. Denn es begann wieder leicht zu regnen.