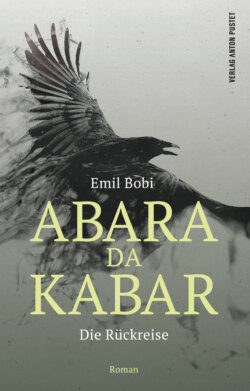Читать книгу Abara Da Kabar - Emil Bobi - Страница 13
7
ОглавлениеZwei Tage später: Ich saß hoch über dem Urban-Loritz-Platz, vor der Hauptbücherei, knapp unterhalb des Gipfels einer Pyramide aus weiten, steilen Steinstufen, die etwas Aztekisches hatte. Ich blickte hinunter auf den Platz, der in der Nachmittagssonne lag. Das weiche Glockengebimmel der eintreffenden Straßenbahn entstieg dem Donner des Straßenverkehrs wie akustische Seifenblasen.
Eine glückstrahlende Japanerin fragte, »sprichst du Deutsch?«, und ich nickte. Dann nickte auch sie. »Ist das die Stadtbücherei?«, fragte sie begeistert. »Ich glaube«, sagte ich, »ja. Hauptbücherei. Aber ob das dasselbe ist, weiß ich nicht.« Die Japanerin nickte hastig, ging aber nicht in die Bücherei, sondern trippelte die Stufen hinunter und ihr schwarzes, glattes Haar flatterte im Rhythmus ihrer Schritte. Wie auf der Flucht überquerte sie die Straße im Zickzack zwischen den sich zäh dahinwälzenden Autos und erreichte die bereits eingefahrene Straßenbahn im Augenblick, als sich ihre Türen öffneten. Da stieg Michaela Halbmond aus.
Sie wirkte frisch, fit, glücklich und attraktiv wie aus einem Werbespot, den man für einfach alles einsetzen konnte. Was immer man zu dieser Erscheinung einblendete, Mineralwasser, Traumurlaub oder Anti-Aging-Kosmetik sowieso, aber auch ein Akku-Bohrer-Set oder ein Mähdrescher würde in eine Verlockung verwandelt und schmackhaft gemacht. Sie trug Jeans, ein weißes, bis unter die Hüften fallendes Seidenhemd, dunkelrote Mokassins und eine Umhängetasche aus rotbraunem Leder. Ihr Gang federte vor Freude an der Bewegung, ihr Haar glänzte silbrig wie gefärbt, war es aber nicht. Es war weiß geworden, als sie siebzehn war und sie hatte nie einen Grund gesehen, das künstlich zu ändern.
Sie entdeckte mich und zeigte mir ihre erhobene rechte Handfläche. Dann machte ihr Arm eine bogenförmige Bewegung und ihr Zeigefinger stach nach rechts, während sich ihre Lippen überdeutlich bewegten. Sie wölbte ihre Handflächen, fügte sie zu einer Kugel, öffnete sie wieder und führte die Spitzen ihres Daumens und Zeigefingers knapp aneinander, um eine geringe Entfernung oder kleine Menge zu symbolisieren und nickte lebhaft fragend. Ich hob meine Hand und nickte als Eingangsbestätigung für ihre Nachricht. Sie lächelte zufrieden und zeigte wieder die Handfläche.
Das war weder Jowulu noch Nostratisch und auch nicht Esperanto. Das war Ursprache, die jeder Mensch verstand, denn jeder Mensch war und blieb ein Urmensch. Sie wollte da drüben noch schnell etwas Rundes beschaffen, es dauere nicht lange, ich bin gleich da, ok?
Als sie so dastand und mir ihre pantomimische Botschaft sendete, kam sie mir vor wie eine Erscheinung aus der Vorzeit und wie eine Verbindung in die Vergangenheit. In allem, was aus der Vergangenheit kam, begann ich eine mögliche Brücke zu sehen. Es gab ja anscheinend auch Sprachen, die Spuren altertümlicher Strukturen bewahrt hatten, wie das Hawaiianische, das, wie die Neandertaler-Sprachen, mit wenigen Vokalen und acht Konsonanten auskam. Aber damit konnte ich in Wahrheit nichts anfangen. Michaela Halbmond hatte diese lustige Geschichte mit den Farbeindrücken erzählt und ich hatte danach ein bisschen hineinrecherchiert. Es war einleuchtend, dass man Farbbezeichnungen zu den ganz alten Wörtern zählen wollte, einfach, weil der Umgang mit Farbeindrücken wohl zu den Grunderfahrungen des Menschen gehörte. Die Bezeichnung für Schwarz, also Dunkelheit, war möglicherweise eines der ältesten Wörter überhaupt. Und ich fand es mehr als erstaunlich, dass das Wort für »schwarz« in gar so vielen miteinander vollkommen unbekannten Kultursprachen ähnlich oder gleich lautete. Kar. Kr. Kär. Karä. Kuroi. Kirikiri. Kuru. Kora.
Jetzt kam sie. Mit jedem Schritt nahm sie zwei Stufen. »Hi«, strahlte sie.
Ich erhob mich von den Stufen, neigte mich zu ihr hin und deutete links und rechts eine Wangenberührung an. »Ich freue mich«, sagte ich und dann entstand eine Pause. Während der Buchpräsentation hatten wir beide gleichermaßen die persönliche Anrede vermieden und umständlich drum herum formuliert, denn wir wagten es nicht, uns zu duzen, obwohl heutzutage jeder jeden duzte, aber siezen wollten wir uns auch nicht. Jetzt sagte ich: »Schön, dich zu sehen. Geht’s dir gut?«
»Ja«, nickte sie, »wollen wir da sitzen bleiben, oder ein bisschen gehen. Ich hab Hunger.«
»Auf jeden Fall«, sagte ich, »was möchtest du? Ein Krokodil-Steak? Nein, warte«, ich hob die Hand und musterte sie gespielt, um sie auf ihre kulinarischen Neigungen zu durchleuchten. Dann zog ich meinen Vorschlag zurück: »Naja, vielleicht eher eine Kürbis-Kokos- Creme-Suppe aus belebtem Wasser, begrünt mit einem Blättchen süßer Minze? Oder wir teilen uns einen Kornspitz mit Leichtkäse, hauchdünnen Gurkenscheibchen und einer halben Olive?«
Sie presste die Lippen aufeinander und ihre Augen glitzerten. »Ich esse alles außer Schweinefett und Affenfleisch.«
»Das dachte ich mir in Wirklichkeit«, sagte ich und das stimmte auch.
Wir gingen um die Ecke und durch den Park vor der Stadthalle. Zum ersten Mal waren wir alleine. Sie fragte: »Bist du Wissenschaftsjournalist?«
»Nein. Ich mache alles, was irgendwie als relevant und aktuell hinzustellen ist. Politik, Chronik, Wirtschaft, alles. Es muss nur was los sein, über das man reden kann.«
»Aber das ist interessant«, sagte sie mit geweiteten Augen, »Menschen zum Reden bringen, ihnen die Unsicherheit nehmen, Vertrauen gewinnen, die richtigen Fragen im richtigen Augenblick stellen, sie nicht an der falschen Stelle unterbrechen, aber nachsetzen, wenn sie abweichen.«
»Du kennst dich aber aus.«
»Du magst das, oder?«
»Was. Dass du dich auskennst? Ja, sicher.«
»Nein, hör auf, ich meine das alles, diesen Beruf.«
»Ah so, ja, ich hab das am Anfang auch nicht gewusst. Ich bin da hinein, weil ich dachte, dass Journalismus etwas mit Schreiben zu tun hat und ich mir ja eingebildet hatte, schreiben zu können. Es war also ein doppelter Irrtum, der mich in diesen spannenden Beruf geführt hat.«
Sie blieb stehen und ich drehte mich zu ihr hin. »Journalismus hat nichts mit Schreiben zu tun?«, fragte sie.
»Fast nichts«, sagte ich. »Es geht nicht ums Schreiben, sondern viel mehr um das Herbeischaffen von Schreibbarem. Auftreiben und Aufbereiten von Stoff. Das Schreiben selbst passiert im letzten Augenblick schnell, schnell vor Redaktionsschluss.«
Wir gingen weiter. Weil in ihrer Frage echtes Interesse durchgeklungen war, erweiterte ich meine Antwort. Zeitungsmenschen seien meist keine Experten, sagte ich. Sie seien, auch wenn viele es selbst glaubten, keine Wissenden, sondern Wissen Einholende. »Und es geht nicht einmal darum, sich dieses Wissen selbst anzueignen, sondern nur die Leute zu finden, die es haben. Das ist Recherchieren im Journalismus. Die richtigen Leute finden und sie zu erweichen, ihr Wissen mit dir zu teilen. Kostenlos natürlich. Scheckbuch-Journalismus gibt es nur in den Köpfen verfolgungsneurotischer Medienhasser.«
»Das heißt es aber oft.«
»Eben. Das ist eines der hartnäckigen Gerüchte zum allseits beliebten Thema ›Scheißmedien‹. Viele glauben, dass man bei den Medien für jede üble Nachrede Geld bekommt und dabei anonym bleiben darf.«
Sie musste lachen.
»Aber du hast völlig recht«, sagte ich, »es geht immer um Menschen. Pure Psychologie. Solange du recherchierst, machst du pure Psychologie. Wenn du nur abschreibst, ist es einfacher, dafür brauchst du keine Menschenkenntnis. Aber die Auseinandersetzung mit Menschen und dem, was sie erreichen oder versäumen, was sie anrichten oder gutmachen, was ihnen zustößt, in die Wiege gelegt oder vorenthalten wird, diese Welt der Schicksale hat mich sehr direkt angesprochen.«
Sie nickte mit denkenden Augen. »Ja. Ich weiß.«
»So wie jetzt«, fuhr ich fort. »Ich gehe nicht jahrelang Sprachwissenschaften studieren, sondern finde dich, die du die Arbeit schon erledigt hast. Und hier ist auch mein Erfolgserlebnis. Ich mag das Tierhafte daran, reflexartig an die richtigen Personen zu gelangen. Dich habe ich in Archiv-Geschichten entdeckt und mir gedacht, wenn jemand etwas neu entdeckt, kommt er auch mit der unberührten Vergangenheit des Entdeckten in Kontakt. Weil das Unentdeckte ja irgendwie von der Gegenwart nicht erfasst war, konnte es vielleicht das Wesen seiner Vergangenheit noch in sich tragen. Ist natürlich irgendwie naiv.«
»Nein«, sagte sie.
»Nicht? Ich meine, eine falsche Annahme kann auch zum richtigen Ziel führen, wenn der Bauch es sagt.«
»Es ist nicht naiv.«
Wir näherten uns dem Ausgang des Parks. Ein ganz in schwarz gekleideter Teenager auf viel zu langen und viel zu dünnen Beinen und einem schräg zur Seite hängenden Haarschnitt überholte uns auf einem Skateboard und querte nach links, vorbei an einer alten Dame, die auf einer Bank saß und in einem Plastiksack nach Brotkrümeln für die Tauben fingerte. »Geh scheißen!«, rief er einem anderen Skater zu, der zur Antwort nur seinen Mittelfinger hochzucken ließ.
»Warum hast du mich eigentlich angerufen?«, fragte sie.
Himmel, das hatte ich ihr ja noch gar nicht erklärt. Wieder blieben wir stehen. Ich schilderte ihr geradeheraus meine Geschichte. Von einer Story-Idee über die neue Sprachkrise ausgehend sei mir aufgefallen, dass nicht der Mensch die Krise mache, sondern die Sprache, denn sie sei funktionsuntauglich.
Sie lächelte entzückt.
»Aber was ist mit der Literatur?«, fragte sie, »die funktioniert auch nicht?«
»Das ist eine sehr gute Frage«, sagte ich, »nur eine kaputte Sprache kann überhaupt das Bedürfnis nach Literatur erzeugen. Eine Sprache, die Literatur hervorbringt, kann nicht funktionieren.«
Ich gestikulierte und meine Hände schaufelten durch die Luft, als würden sie Aufräumungsarbeiten durchführen. »Literatur ist Symptom und Beweis, dass die Sprache nicht funktioniert.«
Sie schmunzelte abwartend.
»Ja sicher«, unterstrich ich. Literatur versuche sich am Unbeschreiblichen, schreibe gegen die Grenzen der Sprache an. Literatur sei die Not des Nichtausdrückbaren. Sei die versuchte Behebung dieser Not. Literatur sei Kunstfertigkeit im Umgang mit dem untauglichen Werkzeug, sie sei Folge der Kaputtheit von Sprache. Literatur sei ein Selbstheilungsversuch.
»Danke für diese Frage«, sagte ich, »ich mag es, so direkt verstanden zu werden. Literatur ist eine Erscheinungsform dessen, wovon ich die ganze Zeit rede. Sie ist eine Kunst des Umganges mit dem Nichtfunktionierenden. Ist doch sonnenklar: Wenn jeder problemlos ausdrücken könnte, was er sagen möchte, gäbe es keine Literatur. Wozu auch?«
Sie fand das wohl verrückt, aber ihr Lächeln war nicht ganz dasselbe, wie wenn ich Witze machte. Sie fand das irgendwie erstaunlich.
»Hätten wir eine funktionierende Sprache, würde sie das Bedürfnis nach Sprache löschen«, setzte ich nach. »Funktionierende Sprache würde Kommunikation beenden, sie würde Kommunikation erfolgreich abschließen und ihre Wiederholung überflüssig machen. Funktionierende Sprache würde sich selbst überflüssig machen. Sie würde etwas sagen, damit es gesagt ist und also nicht mehr gesagt werden muss.« Ich hielt inne, achtete auf ihre Reaktion, aber sie hörte nur zu. »Ursprünglich sollte Sprache ein Gegenmittel sein«, redete ich weiter, »ein Mittel gegen Unklarheiten. Und wenn die Unklarheiten beseitigt sind, wird sie überflüssig. Sie macht sich selbst obsolet wie eine Hilfsorganisation im Krisengebiet, die mit vollem Einsatz und größtmöglicher Kompetenz und Professionalität daran arbeitet, sich überflüssig zu machen. Die sich in höchste Gefahr begibt, nur, um sich obsolet zu machen. Die Sprache, ich meine, eine echte, funktionierende Sprache, wäre da, um das Sprachbedürfnis zu löschen. Aber weil unsere Sprache nicht funktioniert, muss sie immer neue Anläufe nehmen, das Sprachbedürfnis zu beseitigen, produziert aber immer mehr Sprachbedürfnis. Und das geht endlos weiter.«
Michaela Halbmond nahm einfach, was ich sagte und ließ es einmal, wohin ich es gestellt hatte.
»Ist das nicht die Wahrheit?«, fragte ich, »Sag du. Du bist die Expertin. Ich spüre nur etwas. Ich sehe nur etwas.«
»Da gleich?«, fragte sie und deutete auf einen kleinen Gastgarten, der kein Gastgarten war, sondern aus vier kleinen, auf den Gehsteig gedrängten Tischen bestand, die mit einem stilisierten Plastik-Gartenzaun der Marke »Knusperhäuschen« eingegrenzt und symbolisch von der Fahrbahn getrennt war. An einem der Tische saß ein älterer Mann vor seinem Glas und war intensiv mit sich selbst beschäftigt, suchte ruhelos in den Taschen seines Mantels, den er trotz der Hitze trug, rupfte an seinen schweißverklebten Haarresten, rutschte auf dem Sessel hin und her und verlagerte sein Gewicht, um sich Zugang zu weiteren Innentaschen zu verschaffen, in denen er ebenso wenig fand, wie in den anderen.
»Gibt’s da was?«, fragte ich, »ok, passt.«
Rechts neben dem Eingang hing eine blecherne, bunt emaillierte Werbetafel aus den Sechzigerjahren, aus der ein riesiges, überschäumendes Krügel Bier heraus kippte. Perspektivisch im Hintergrund lachte eine glückliche Hausfrau mit toupierten Haaren und roten Lippen. Drüber stand in geschwungenen Lettern: »Trinken Sie Bier!« Darunter hing eine schwarze Tafel, auf der mit Kreide das Angebot der Küche vermerkt war: Saures Rindfleisch mit steirischem Kernöl. Dann: Thunfisch-Carpaccio an Avocado-Sesam-Limetten-Teriyaki. Und ganz unten: Heidelbeer-Muffins auf Vanille-Schaum. Aber das Lokal schien verlassen, es war weit und breit kein Kellner zu sehen und es kam auch keiner.
Wir warteten. Ich fragte: »Tratschen deine Jowulu-Freunde gern? Ich meine, was reden sie und warum reden sie? Reden sie viel, oder nur dann, wenn es was zu sagen gibt?«
Sie entspannte sich im Sessel. Sie schien sich wohl zu fühlen und nahm sich eine Sekunde, um einzulenken. Bis dahin war sie im Small-Talk-Modus gewesen, hatte spielerisch über Hunger geklagt und beobachtend gelächelt. Jetzt senkte sich Konzentriertheit wie aufziehendes Gewölk auf ihren Blick. Sie biss sich auf die Unterlippe, die wie zerknittertes Seidenpapier Fältchen und Plättchen warf und sie fixierte mich mit dem unverwandten Interesse einer Ärztin, die ein Symptom entdeckt hatte. Wenn sie sprach, spürte ich das große Wissen, das nur leicht angezapft hinter ihren Worten bereit lag.
Eigentlich seien diese Jowulu-Leute sehr gesellig und gar nicht so asketisch und wortkarg, wie man das bei Völkern der Sahara gewöhnlich beobachte. Sie machten Witze, in der Nacht werde gefeiert und wenn Bier da sei, tranken sie es aus. Und wenn dann jemand stolpere, dann lachten sie. Sie seien uns Europäern viel ähnlicher, als ihr Äußeres nahelegen würde.
»Und was passiert, wenn es Streitereien gibt? Wie werden Missverständnisse ausgeräumt?«, fragte ich, »wie oft hörst du sie sagen: ›Du verstehst mich nicht‹? Ich meine, gibt es Diskussionen über sprachliche Unwegsamkeiten, die klären sollen, was jemand nun genau gesagt oder nicht gesagt hat, oder doch gesagt, aber nicht so gemeint hat?«
»Nur, wenn sie betrunken sind«, lachte sie, »und das ist gar nicht so selten.« Auch die Frauen, besonders die alten, langten ganz schön zu und zogen dazu gierig an Tabakpfeifen.
Michaela Halbmond blickte über die Schulter, um nach einer Bedienung Ausschau zu halten, aber da war nur der einsame Gast, der unverändert in seinen Taschen wühlte. Sie wandte sich wieder mir zu. Jetzt stach ihr Blick nicht mehr an mir vorbei in ein fernes Gedankenarchiv. Jetzt blickte sie mich offen und geduldig an, als wäre sie endlich bei mir angekommen. Sie hatte es nicht eilig, etwas zu sagen.
»Es geht mir um die Kluft«, sagte ich, »um diese Kluft, die überall ist, wo Menschen sprechen. Die mitten durch jeden Satz verläuft, den Menschen aussprechen und mitten durch jeden Satz verlaufen ist, den Menschen jemals ausgesprochen haben. Die Kluft, die alles aufspaltet in das, was sie sagen und das, was sie meinen.«
Sie hatte längst verstanden. Sie lächelte ernst und nickte langsam. Wenn sie »Ja« sagte, sank ihr Ton in einem Bogen nach unten und nahm etwas zärtlich Zusicherndes an, fast etwas Tröstendes. »Ja«, sagte sie, »ich mag diese Leidenschaft in deinen Gedanken. Sie sind bestechend und unbescheiden, wie es sich gehört, wenn du bereit bist für die Revolution. Käme jemand in meinem Fach mit sowas daher, würden alle den Kopf schütteln, obwohl wir, genau betrachtet, eigentlich dasselbe sagen.«
Sie nahm mich ernst. Ich war erleichtert.
»Gibt es einen Weg zurück?«, fragte ich. Sie wusste ansatzlos, was ich meinte, das hatte sie bei der Buchpräsentation schon verstanden. Sie zuckte mit den Schultern, dann schüttelte sie den Kopf. Einen Weg zurück zum Anfang? Das sei es doch, was die gesamte Forschung suche. Einen Weg zurück zum Anfang gebe es nicht, aber einen Anfang, das schon.
»Ja?«
»Ja. Der Zaun im Zoo. Dort ist der Anfang. Das ist die Grenze.«
»Gehst du mit mir in den Zoo?«
»Ja, wenn du möchtest«, schmunzelte sie, »gehe ich mit dir in den Zoo.«
Am Zaun im Zoo sei das Ende und der Anfang, da, wo das Tierreich ende und das Menschenreich beginne. »Ich bin nur eine Erbsenzählerin«, sagte sie, »eine I-Tüpfchen-Reiterin. Wir sagen, ›Okay, der eine sagt Muh, der andere Mäh, hochinteressant, das müssen wir analysieren‹. Aber wir verstehen wenig über die großen Hintergründe. Es gibt kein Sprachmuseum mit Fossilien, es gibt keine Verbindung in die ältere Geschichte, von der man etwas über die Gegenwart lernen könnte.«
»Aber das Menschsein beginnt mit der Sprache«, fragte ich dazwischen, »das sagst auch du, oder?«
»Natürlich. Das Menschsein beginnt mit dem bewussten Denken, das Denken beginnt mit dem Begreifen und Begreifen heißt nichts anderes als Begriff geben. Versprachlichen. Einen diffusen Bedeutungsinhalt in die Form von Worten bringen. Formulieren. Ohne Sprache gibt es kein Verstehen. Ohne Begriffe keine konkreten Gedanken, keine eigenen Vorstellungen. Nichts. Kein Menschsein. Nur fließende Reize und Eindrücke, die nichts bedeuten, weil sie nicht benannt sind. Tierhafte Wahrnehmung.«
Ihr Telefon läutete. Sie holte es hervor und stellte es ab. Sie kramte in ihrer Umhängetasche nach einem Pflegestift und zog ihn über ihre Lippen. Dann schob sie den Stift wieder in die Tasche und holte ein bunt ornamentiertes Terminbüchlein hervor, blätterte kurz darin, fand, was sie suchte, und legte es wieder zur Seite.
Ich sagte nichts, ich hatte Angst, dass sie schon wieder weg musste. Aber sie überlegte nur. Und dann nahm sie mich und führte mich zurück. Sie beschrieb, was am Zaun passierte. Sie machte mir klar, was ablief, wenn Sprache in ein Leben eingriff, das noch keine Sprache kannte. Sie zeichnete den Übergang von der außersprachlichen Wahrnehmungswelt der Tiere zur erkennenden, verstehenden Sicht der Menschen. Und so sagte sie: »Stell dir vor, du versuchst zu meditieren. Du sitzt da und tust nichts. Ok?«
»Ok.«
»Du bist still. Du sitzt da und bewegst dich nicht und versuchst nichts zu tun und nichts zu denken. Einfach nur zu sitzen, sonst nichts. Du entspannst dich und wartest darauf, dass du ruhiger wirst. Dein Atem wird zunächst heftiger, dann ruhiger. Dein Puls verlangsamt sich. Du fährst deine inneren Dialoge herunter und lässt, so gut du kannst, deine aktiven Gedanken ruhen.«
Sie machte eine Pause und sah mich nachdenklich und geduldig an. Dann sprach sie weiter: »Je entspannter und ruhiger dein Inneres wird, desto deutlicher siehst und spürst du es: Du wirst durchströmt von Reizen, die du nicht abstellen kannst. Ein endloser Strom von Eindrücken zieht durch dich hindurch. Einem Tier geht es gleich, es wird durchströmt von namenlosen Eindrücken, es sieht und spürt, aber es ist ihm nicht bewusst, was es sieht und spürt. Das Tier sieht einen Baum, doch es ist ihm nicht bewusst, dass es einen Baum sieht, weil es ihn nicht mit der Bezeichnung ›Baum‹ ausgestattet hat. Deshalb leuchtet in seinem Hirn das Signal ›Baum‹ auch nicht auf, weil es dort nicht gespeichert ist und daher nicht aufgerufen werden kann.«
»Ok. Das Tier hat kein Archiv im Kopf zum Nachschauen.«
»Ja. Also, hör zu«, überging sie mich, »ein pausenloser, endloser, unermesslicher Strom aus Eindrücken und Reizen und Bildern fließt durch dein Hirn und erzeugt ein körperliches Echo. Das heißt, du spürst deine Wahrnehmungen. Du siehst Formen und Farben und spürst das auch. Du registrierst Veränderungen. Du bemerkst, wenn Helligkeit zu- oder abnimmt, du nimmst Schwankungen von Lautstärke und Temperatur wahr, du registrierst Räumlichkeit. All das durchströmt dich und verschwindet wieder ohne Halt zu machen. Es wird von neuen, nachströmenden Eindrücken verdrängt. Dein Kopf ist wie eine Mühle oder ein Kraftwerk, durch die ein Bach fließt und wenn die Schaufeln des Mühlrades hineingreifen, flackern Lichter auf. Da fließt eine simultane Suppe aus Wahrnehmungen, die keinen Bestand haben und keinen Sinn machen, weil sie hereinströmen und wieder hinausströmen, ohne angehalten und identifiziert zu werden. Du nimmst das alles wahr, aber du begreifst nichts, weil du es nicht mit einem Kennwort identifizierst.«
Sie machte eine Pause, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Wenn du nun ein passendes Gefäß nimmst und etwas aus dem Strom schöpfst, hast du es angehalten. Du isolierst diesen herausgefischten Inhalt vom Rest des Stromes und gibst ihm Bestand. Der Strom fließt weiter, aber der Inhalt in deinem Gefäß bleibt da. Er wird vom Gefäß festgehalten. Du hast ihm eine stabile Form gegeben und damit Kontinuität. So ist der Inhalt wiederverwendbar.«
Ich nickte. Ich hing an ihren Lippen und dachte an keinen Kellner mehr.
»Und nun«, sagte sie, »ist es sehr einfach: ein Wort ist ein solches Gefäß. Diese Wortgefäße geben Form und Bedeutung. Mit diesen Wort-Formen benennst du etwas Vorbeiströmendes und gibst ihm Identität und Bestand. Du hältst es fest, wie man so schön sagt. Diese schöpfenden Wortgefäße machen etwas Unbestimmtes zu einem Gegenstand. Du begreifst eine fließende, namenlose Wahrnehmung, indem du sie mit einem passenden Gefäß anhältst und herausholst. Begreifen heißt nach Treibgut greifen – und es zu identifizieren durch Bezeichnung, durch Namensgebung. Es ist, wie wenn du ein verschwommenes Bild scharfstellst.«
Ich holte Luft, um anzusetzen, etwas zu sagen, doch sie hob abwehrend die Hand.
»Jetzt kommt noch das Entscheidende. Das Verstehen. Welche Prozesse laufen ab, wenn du etwas verstehst? Also, wie gesagt: du hast zum Beispiel eine große, hölzerne Pflanze mit dem Wortgefäß ›Baum‹ festgehalten und gespeichert. Der ist in deinem Hirn jetzt vorrätig. Jetzt bist du gerüstet. Wenn nun wieder einmal eine dieser hölzernen Pflanzen im Strom vorbeitreibt, klingelt es in deinem Kopf und ein Treffer wird gemeldet, weil das Gehirn alle hereinkommenden Eindrücke mit bereits vorhandenen abgleicht. Etwas verstehen bedeutet nichts anderes, als etwas im Hirn bereits Gespeichertes draußen in der Welt wiederzuerkennen. Denn etwas nicht Gespeichertes kannst du nicht erkennen.«
Sie beobachtete die Wirkung ihrer Worte und wiederholte in mein stummes, langsames Nicken hinein: »Du hast eine große, hölzerne Pflanze mit der Lautkreation ›Baum‹ im Hirn eingelagert. Wenn wieder einmal einer vorbeitreibt, legst du die gespeicherte Schablone aus deinem Kopf-Archiv drüber und wenn sie passt, leuchtet ein Lichtlein auf und du erkennst ihn als Baum. Verstehen heißt also, eine Wahrnehmung sprachlich zu wiederholen, empfangene Eindrücke mit vorhandenen Wörtern zu reproduzieren und wiederzugeben und sie so zu fixieren.«
Ich sagte: »Wow.« Und nach einer Atempause sagte ich noch einmal: »Wow. Begreifen heißt nichts anderes, als Eindrücke in Ausdrücke zu verwandeln?«
Sie klatsche in die Hände: »Exakt! Kluges Kerlchen! Genau das, was du jetzt gemacht hast, ist begreifen. Es ist Sprache geben.«
Sie glitzerte wieder. Während ihrer Ausführungen hatte sie fremd und abwesend gewirkt und ihr reizendes Wesen war in den Schatten ihrer Konzentration verschwunden. Aber da war sie wieder und freute sich, dass ich ihr tapfer folgte. Diese Frau war keine Lexikostatistik-Tussi. Das war keine Erbsenzählerin. Das war ein Lichtwesen. Aber in diesem seltsamen Gasthaus war einfach kein Kellner zugegen und diese Dame da hungerte, während sie mein Bewusstsein aufblies wie eine halluzinogene Droge. Sie war wie LSD mit Lippen aus zerknittertem Seidenpapier.
Ich überprüfte, ob mein neues Wissen funktionierte: »Ok, ich sehe einen Baum und denke, das ist ein Baum. Das kann ich aber nur, weil ich den Begriff ›Baum‹ gespeichert habe. Und das nennt man einen Gedanken?«
Sie freute sich wie eine Volksschullehrerin, schüttelte aber den Kopf und präzisierte: »Gedanken sind eher ganze Wortfolgen.«
Ich fuhr fort, mehr zu mir selbst: »Etwas fassen heißt, es in Worte fassen.« Ich starrte ins Leere. Dann sagte ich: »Der Unterschied zwischen unbewusster und bewusster Wahrnehmung heißt Sprache.«
Sie lächelte nickend. »Auffassungsgabe«, sagte sie, »ist die Fähigkeit, etwas lose Geistiges in Sprache zu verwandeln. Formlose Inhalte in Wort-Sprache zu formen, zu formulieren.«
Ich sah ihr in die Augen: »Auffassungsvermögen ist eine Sprachkompetenz.«
Sie nickte.
Ich war sprachlos. Wie erhellend das alles war. Meine professionelle Distanz zu ihr schwand. »Ich habe kein passendes Wort-Gefäß für dich«, sagte ich, »du strömst außersprachlich durch meinen Kopf. Keine Schablone passt auf dich und dennoch blinken die Lichter in meinem Hirn. Ich kann dich nicht aus dem Strom fischen, du musst bitte selber anhalten.«
Sie schmunzelte.
So einfach war das also. Sprache machte etwas Fließendes fest, etwas Unbestimmtes bestimmt, grenzte es ab, isolierte es vom Rest und nur daraus ergaben sich Eigenheit und Identität. Das Verpacken in Sprache verlieh dem Inhalt Gegenständlichkeit und dauerhaftes Gleichbleiben. Das Kleiden in Sprache rief etwas erst ins Leben. Formulierung schaffte Wirklichkeit. Sprechen hieß nichts weniger als Schaffen. Schöpfen. Mit Wort-Krügen aus der strömenden Ursuppe schöpfen.
Das war fast zu viel an Plausibilität und Einfachheit. Ich hob erneut die Hand: »Moment einmal: ich verstehe. Genau jetzt läuft sowas in meinem Kopf ab. Ich verstehe etwas und das schmeckt irgendwie nach Erinnerung. Ist ja klar: Man versteht dann etwas, wenn es mit einem bereits gespeicherten Inhalt übereinstimmt. Das fühlt sich nicht nur an wie Erinnerung, es ist Erinnerung. Du zapfst vorhandenes Wissen an.«
Sie war zufrieden.
Ich sagte: »Siehst du, wie tierhaft gescheit ich bin, genau dich gesucht und gefunden zu haben?«
»Ja, das hast du gut gemacht«, scherzte sie, »aber zum Abschluss der Unterrichtsstunde wiederholen wir: Verstehen ist ein Vorgang der Versprachlichung. Ok? Und Begreifen heißt Begriff geben, ja?«
»Ja.«
»Und mit diesen Begriffen systematisch operieren nennt man denken.«
»So einfach ist das, oder?«, sagte ich. »Genial. Gehen wir. Da gibt es nichts zu essen.«
Sie überquerte fast hüpfend die Straße, ihr Blick zuckte nach links und rechts nach dem Verkehr und sie streckte ihren rechten Arm nach hinten in meine Richtung und spreizte die Finger, um mich zu lotsen. Sie hielt auf der anderen Straßenseite vor dem Eingang zu einem kleinen, dreckigen Park, der Mitleid erregte mit dem imaginierten Kind, das hier spielen musste. Er bestand zur Hälfte aus einer asphaltierten Fläche, über die ein fünf Meter hoher Würfel aus Drahtzaun gestülpt war. Zur anderen Hälfte war er ein schwarzbraunes Halbrund aus säuerlich stinkenden Rindenstücken, in dessen Mitte eine traurige Sandkiste lag, daneben eine verrostete, ehemals bunt lackierte Rutsche. Der Park war menschenleer und lag tot unter einer grauen Kruste aus Verkehrsstaub.
Da stand sie nun, in ihrer Hüfte lehnend, mit verschränkten Armen, die Tasche hing ihr von der Schulter und ein Lächeln dehnte ihre Lippen. Lippen, über die bei Bedarf zahlreiche Sprachen geflossen kamen, von denen kein Mensch noch je etwas gehört hatte. Diese Linguistin hatte mir beigebracht, dass es die »Verwortung« war, die einer Wahrnehmung erst ihre Bedeutung gab. Durch Verwortung wurde aus einer Sache erst eine Tatsache.
»Gehst du jetzt mit mir in den Zoo, Frau Lehrerin?«, bettelte ich und sie glitzerte und sagte, »Ja, wir gehen in den Zoo die Grenze anschauen, aber ein anderes Mal.«
»Aber hast du noch was von diesem hochgescheiten Zeugs da, wie vorhin, weißt eh, von der Sprache und alles?«
»Ja, Herr Journalist, ich wollte eigentlich etwas zu deiner Kluft sagen, Herr Star-Reporter.«
Und dann kam es. Ich spürte, dass da jetzt etwas kommen würde und nahm Aufstellung. Diese Michaela Halbmond, die ich wie mit verbundenen Augen aus einem Berg von Unterlagen und einem Heer von Experten gefischt hatte, legte mir den Beweis auf den Tisch, dass meine Ahnungen, auch wenn sie noch so irrwitzig und jenseitig wirkten, nichts als zutreffend waren. Sie belegte, dass Sprache tatsächlich nichts transportierte und Sprachkommunikation de facto unmöglich war. Sie erhärtete nicht nur meinen Verdacht, sie machte aus ihm eine ganz klare Gewissheit. Und Frau Professor Michaela Halbmond war nicht irgendwer. Jowulu-Entdeckerin hin oder her, sie war eine kristallklare Wissenschaftlerin, ausgestattet mit einem messerscharfen Intellekt und nicht von ungefähr eine internationale Kapazität. Und sie neigte kein bisschen zu grenzrealen Absonderlichkeiten, nicht einen Millimeter. Aber was sie hier sagte, war völlig klar: die Wort-Sprache transportierte keinerlei Inhalte. Null. Sie versuchte es gar nicht.
Mit welch mythischer Schüchternheit ich mich meinem Verdacht genähert hatte! Und mit wie viel weniger ich schon zufrieden gewesen wäre. Es hätte mir schon gereicht, nicht glatt zurückgewiesen und ausgelacht zu werden. Doch diese Person legte mir das Vollbild restloser Bestätigung auf den Tisch.
»Sag Baum«, sagte sie mit der Liebenswürdigkeit einer Volksschullehrerin.
»Ok, Baum.«
»Siehst du?«
»Nein. Was?«
»Jetzt hör zu: Wenn du ›Baum‹ sagst, kommt kein Baum aus deinem Mund und fliegt durch die Luft und dringt in mein Ohr. Aber auch dein Bild von diesem Baum kann nicht fliegen. Der Inhalt von etwas Gesagtem wird nicht zugestellt. Nur die Verpackung. Was hier durch die Luft fliegt ist nur ein Wachrufer für deine eigene Vorstellung von einem Baum, die du im Hirn-Archiv gespeichert hast. Wenn ich ›Baum‹ sage, siehst du nicht meinen Baum, sondern deinen eigenen, und der wird immer anders aussehen als meiner, egal, wie genau ich ihn beschreibe. Meine Beschreibung ist nur ein Rezept für den Nachbau aus deinem eigenen Archivmaterial.«
Ich verstand. Alles, was sich beim Sprechen durch die Luft bewegen konnte, war die Luft selbst in deformiertem Zustand, als Klangbild. Luft war elastisch, man konnte sie ausatmen und dabei mit den Lippen Druck- und Dichteschwankungen bewirken und dabei wellenartige Muster erzeugen, die durch den Luftraum davontrieben. Wenn jemand sprach, bewegte sich wellenförmige Luft durch ruhende Luft. Alles, was sich bewegte, waren Wellen. So konnte man Lautbilder in die Luft stempeln wie Rauchringe. Man konnte der Luft etwas sagen und sie sagte es weiter. Ein Windstoß verbog und dehnte das Lautbild, es prallte gegen eine Wand und dann hallten Bruchstücke wider, oft mehrmals, bevor sie sich verloren. Trafen solche Wellenbilder auf einen Empfangstrichter wie das sogenannte Ohr, »hörte« man etwas.
Mir kam meine eigene Begeisterung irgendwie übertrieben vor und ich fragte: »Bin ich so ungebildet, oder ist das alles wirklich so faszinierend? Deine Worte sind so schwerwiegend. Ich glaube dir jedes einzelne, Frau Volksschullehrerin.«
»Du sollst nicht glauben, du sollst verstehen«, sagte die Volksschullehrerin.
»Du sagst doch selbst, das geht nicht.«
»Hör jetzt auf.«
»Also gut: Das ganze Spiel mit dem Baum heißt ›Ich sehe nur, was du nicht siehst‹, oder?«
»Wenn du es so schön sagen möchtest.«
»Genauer gesagt lautet das Spiel der scheinbaren Kommunikation, ›Was ich sehe, wirst du niemals sehen können‹, oder?«
Sie zuckte mit den Schultern: »Ja.«
Alles war noch viel radikaler, als ich angenommen hatte. Ich hatte gedacht, beim Sprechen, also bei der Übermittlung von Begriffen, würden vielleicht Fehler auftreten und es könne etwas verloren gehen. Ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, was mit dieser Luftpost während des Überfluges passierte. Und da war jetzt die Antwort: Gar nichts. Mit dieser Luftpost passierte gar nichts. Es gab keine Luftpost. Die Aussage eines anderen zu verstehen, war pure Illusion.
Michaela Halbmond hatte nur den seltsamen Einwand, dass das normal sei. Und dass man eben nicht so übertrieben genau hinschauen dürfe.
Was? Konnte man denn übertrieben genau hinschauen? Ich meine, alles, was diese Frau sagte, zog mich an und nahm mich ein. Doch ich sollte nicht genau hinschauen? Tut mir leid, große Expertin, ich schaue aber genau hin. Und zwar ganz genau. Und ich hatte nicht vor, weniger als ganz genau hinzuschauen. Wegen nichts anderem war ich da.
Ich sah ihre Seidenlippen, wie sie sich in Zeitlupe bewegten, diese scharf gezeichneten, großen Lippen mit den Fältchen und Plättchen, wie sie stumm nach vorne kamen, einen Trichter bildeten, sich weich aufeinanderlegten, wieder aufgingen, zurückwichen, sich schmal machten und in die Breite spannten.
»Aber das ist normal«, sagte sie.
»Es ist normal, dass nichts, was Menschen je gesagt haben, je bei einem anderen Menschen angekommen ist? Dass nichts jemals so verstanden wurde, wie es gemeint war, aber alle dachten, es richtig gesagt und richtig verstanden zu haben?
»Ja«, sagte sie, »wenn man es allzu genau nimmt.«
Das war ja das Beste. Allzu genau. Ich berührte ihre Hand wie um sie zu beknien, doch vernünftig zu sein: »Aber das heißt doch, dass Menschen nie miteinander reden, sondern immer nur nacheinander abwechselnd jeder mit sich selbst.«
Sie musste lachen. »Ja«, sagte sie, »das klingt so witzig, aber es stimmt.«
Der Übermittlungsvorgang war es einfach nicht. Es lag kein technisches Problem vor. Der wahre Grund war verletzend banal: Es war der allgegenwärtige Irrglaube, Sprache könne etwas, was sie einfach nicht konnte.
»Bist du sicher, dass das kein Grund zur Aufregung ist?«, fragte ich.
Michaela lächelte nur. Sie ließ mich leben. Sie nahm mich ernst, obwohl ich verrückt sein musste. Sie teilte ihr großes Wissen mit mir, aber sie ließ mich einfach. Ich hatte es in dieser Redaktionskonferenz einfach so dahinbehauptet, ich hatte gelogen und schön knallig zugespitzt. Aber jetzt war klar: Meine erfundene Geschichte entsprach den Tatsachen. Ich hatte die Wahrheit gelogen. Alles, was der Mensch von der Welt draußen hereinzubekommen und zu verstehen dachte, war in Wahrheit schon da, hausgemacht. Von draußen kam gar nichts.
Der Mensch bildete sich ein, mit anderen Menschen verbunden zu sein, aber er war vollkommen allein. Ein universeller Selbstversorger, ein Eremit der Sinne, ein absoluter Einzelgänger. Er lebte in einer selbstgebastelten virtuellen Realität. In einer bunten Blase aus körpereigenem Seifenwasser. Er braute sich alles selbst aus körpereigenen Säften, er malte sich alles aus körpereigenen Farben, er belegte alles mit seinen eigenen Erfahrungen. Sein Verständnis bezog er aus seinem eigenen Wissen. Er verstand nur, was er ohnehin wusste. Von draußen erfuhr er gar nichts, nur Codes. Die rote Farbe, die er wahrnahm, war sein eigenes Rot und nicht jenes, das ihm als Schallwellen-Konstrukt zugeflogen kam, denn da kam kein Rot geflogen, sondern ein akustisches Symbol lautend auf R-O-T, zur Abrufung des eigenen Rot. Sonst nichts.
Und diese Laut-Symbole galten nicht einmal den Dingen, die sie bezeichneten. Sie waren nur an die Bibliothek des Geistes gerichtet. Wörter vertraten nicht die realen Dinge, die sie benannten, sondern die Lagerplätze ihrer Abbilder im Hirn, damit der Geist sich auskannte, was er hervorholen musste. Wir Menschen redeten überhaupt nicht über die Welt draußen, sondern über unsere gespeicherten Archive. Wir transportierten gar nichts. Unsere Hirne spielten Kartentauschen, das war alles. Wir agierten in einer Stellvertreter-Welt aus Abbildern. Wir lebten nicht, wir spielten Leben.
Wozu hatte ich versucht, Gedichte zu schreiben? Wozu hatte ich mein Leben lang überlegt, was ich sagen sollte, bevor ich den Mund aufmachte? Warum hatte ich versucht, dem Wesen der Dinge näher zu kommen, indem ich Wortbedeutungen präzisierte? Ganz einfach: Weil ich nicht wusste, dass ich das Wesen der Dinge niemals mit Wörtern durchdringen würde, weil Wörter nichts mit dem Wesen der Dinge zu tun hatten, sondern draufgeklebte Archiv-Schilder waren. Vor mir stand die Lichtgestalt mit der silbrigen Mähne und den übertriebenen Sprachkenntnissen und mein Latein war am Ende.
Mein Latein war am Anfang. Ich sagte: »Wir fechten sogenannte Meinungsverschiedenheiten aus und glauben, über Meinungen zu streiten, dabei streiten wir über Wörter. Es ist sinnlos, wahre Bedeutungen von Wörtern herausarbeiten zu wollen mit immer mehr Wörtern, die allesamt nichts mit dem zu tun haben, was wir suchen.«
»Ja«, sagte sie mitfühlend und lächelte etwas ernster. Sie blickte mich wieder an wie bei der Buchpräsentation, als ich das Gefühl hatte, sie würde an meinem Lachen etwas erkennen.
Mir wurde ein bisschen übel. Jeder einzelne Mensch befand sich in seiner eigenen Sprachblase. Wir, die Menschen, waren autistische Eigenbrötler, die sich einbildeten zu kommunizieren und nicht verstanden, warum sie nichts verstanden. Sie redeten in einer Sprache, die nichts mitteilen konnte, in einer Sprache, die sie nicht verstanden und nicht beherrschten und dennoch missbrauchten. Sie logen mit dieser Sprache, obwohl mit ihr ohnehin keine Wahrheit zustande zu bringen war. Damit meinte ich nicht nur die anderen. Ich meinte hauptsächlich mich selbst. Was denn sonst.
»Ich muss gehen«, sagte sie plötzlich, erschrocken von der Uhr aufschauend, »ich komm schon zu spät.«
Ich erwachte wie aus einer Hypnose. »Bitte verzeih mir«, fuhr ich hoch, »dass ich dich so vereinnahme.« Ich griff mir auf die Stirn: »Wie erhellend und einnehmend das alles ist. Tut mir leid.«
»Ist ja spannend«, sagte sie und ich wusste nicht, ob in ihrem Schmunzeln Müdigkeit oder Traurigkeit oder Besorgtheit lag. Sie berührte mich mit der Handfläche seitlich am Kopf wie ihren braven Volksschüler und nickte aufmunternd: »Bleib dran, ok?«
Und dann blieb ich zurück. Allein mit meiner neuen Wirklichkeit. Allein mit meiner bestätigten alten Wirklichkeit, welche die Unsicherheit verloren und Kontur gewonnen hatte und erst jetzt so richtig neu und echt und wirklich war. Da stand ich am Eingang des unter grauem Industriestaub erstickten Parks und Michaela Halbmond entschwand.
Ich hatte ihre Verabschiedung reaktionslos über mich ergehen lassen. Nun stand ich am Gehsteig, zurückgelassen wie ein aufgerissenes Gepäckstück und sah sie noch, wie sie sich beeilte, ein bisschen Zeit gutzumachen. Sie überholte Passanten, wich betonierten Blumentöpfen und Ampelmasten aus und verschwand in der Flut aus Menschen und Fahrzeugen.