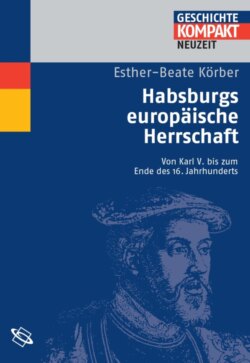Читать книгу Habsburgs europäische Herrschaft - Esther-Beate Körber - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) „Herrschaftsverdichtung“
ОглавлениеAuch im politischen Leben des 16. Jahrhunderts lässt sich das Bemühen um distanzierende Zentrierung beobachten. Aber es stieß sehr rasch an Grenzen, denn die materiellen Bedingungen der Politik erwiesen sich als zählebig und schwer überwindbar. Auch mächtige Herrscher wie die spanischen Könige konnten außerhalb ihrer engsten Umgebung kaum wirken, unter anderem weil Nachrichten oder Befehle durch Boten weitergegeben werden mussten. Sie kamen über meist schlechte Wege nur mühsam voran, und oft war ein Befehl schon überholt, wenn er den Empfänger erreichte. Weit entfernte Herrschaftsgebiete ließen sich daher nur schwer im Auge behalten, geschweige denn kontrollieren. Anders gesagt: Die Herrscher waren darauf angewiesen, innerhalb ihres Herrschaftsgebietes ständig zu reisen. Politik konnte nur am Ort des Geschehens gemacht werden, andernfalls versandete sie buchstäblich: Boten konnten unterwegs festgesetzt, Briefe abgefangen werden, Befehle aufgrund widriger Verkehrsverhältnisse zu spät ankommen, oder der Empfänger des Befehls weigerte sich einfach, ihn auszuführen, und kam oft ungestraft davon, weil die Zentrale zu weit entfernt war, um die Ereignisse überhaupt in einer Zeit zu erfahren, in der sie noch reagieren konnte. Deshalb beruhte die Technik des Regierens hauptsächlich auf unmittelbarem persönlichem Umgang. Wenn der Herrscher sich nicht persönlich zeigte oder sich durch einen Regenten sichtbar vertreten ließ, gab es in den Augen der Beherrschten keine respektierte Autorität mehr, und sie verhielten sich entsprechend. Für die Menschen des 16.Jahrhunderts existierte Herrschaft nicht als Abstraktum, unabhängig von den regierenden Personen. Das aber heißt: Es gab keinen Staat im modernen Sinne als von der Person des Herrschenden unabhängige, abstrakte Autorität.
Was sich seit dem Spätmittelalter auf politischem Gebiet in Europa vollzog, könnte man daher auch „Staatsbildung“ nennen. Dann muss man sich aber vor Augen halten, dass auch dieser Prozess wie die „Konfessionsbildung“ Jahrhunderte in Anspruch nahm. Wann der „moderne Staat“ sich endgültig etabliert hatte und der Prozess der „Staatsbildung“ abgeschlossen war, darüber kann man streiten; im 16. Jahrhundert jedenfalls steckte er erst in den Anfängen. Der Ausdruck „Herrschaftsverdichtung“ beschreibt dieses Anfangshafte treffend. Mühsam und bisweilen mit zweifelhaftem Erfolg versuchten die Herrscher, Machtbefugnisse bei sich (als Verkörperung des Amtes und als Person) zu konzentrieren und dadurch niedere Gewalten zugleich auf Distanz zu halten und dem eigenen Machtgefüge einzuordnen. In Analogie zu der Beschreibung der Zentralperspektive könnte man sagen: Die Herrscher versuchten, als „Landesherrschaft“ (Amt und Person) einen distanzierten „Standpunkt“ gegenüber den Untergebenen zu gewinnen und die Machtbeziehungen von diesem Standpunkt aus zentral zu ordnen. Wenn und sofern das gelang, wurde der „Staat“ als ein einheitlicher, abstrakter „Raum“ politischen Lebens wahrnehmbar.
Die Distanzierungs- und Einordnungsbestrebungen drückten sich zum Teil in Formen aus, die wir heute als belanglos ansehen, weil wir nicht mehr spüren können, wie ungewohnt sie damals waren und wie sehr sie einen neuartigen Anspruch auf Respekt, oft sogar auf Unterwerfung begründeten. Einige Herrscher, wie die burgundischen Herzöge, formten ein kompliziertes Hofzeremoniell aus, das den Alltag und die Festlichkeiten am Hof prägte und den Abstand zwischen Herzog und Höflingen deutlich machte – etwa, indem ihm bei Tisch zuerst serviert wurde oder indem die Höflinge bei den Audienzen des Herzogs schweigend dabeisitzen mussten. Kaiser Karl V. übernahm das burgundische Zeremoniell 1548 für den spanischen Hof, und es machte als „spanisches Hofzeremoniell“ in Europa Schule.
Sichtbare Inszenierungen, z. B. bei Festen oder kirchlichen Feiern, konnten dazu dienen, die überlegene Hoheit eines Herrschers darzustellen und den minder Mächtigen im Rahmen der Zeremonie ihren Platz zuzuweisen. Aber auch durch Rückzug ließ sich Distanz betonen; „unnahbar“ heißt noch heute jemand, der seine Überlegenheit durch Abstand deutlich macht. König Philipp II. von Spanien (1556–1598) verkehrte sogar mit seinen nächsten Mitarbeitern fast nur schriftlich und ließ sich auch im Lande selten sehen, ganz zu schweigen von den entfernteren Teilen seines riesigen Reichs. Zur Inszenierung der Distanz gehört auch – analog der Zentralperspektive – die Fixierung des Herrschaftsstandortes. Die Höfe des Mittelalters waren meistens reisende Höfe und oft unterwegs gewesen, um, wie es die personale Herrschaftsauffassung erforderte, Politik am Ort des Geschehens zu betreiben. Das änderte sich im Spätmittelalter allmählich, und nach 1550 setzte sich das Prinzip durch, eine einzige Stadt zur Hauptstadt und ständigen Residenz zu machen. Bei dieser Residenz ließen sich die Herrscher dann ihre Schlösser bauen – oft weit außerhalb, wie um die Städter schon räumlich auf Abstand zu halten, wie das Schloss El Escorial bei Madrid demonstriert. Wenn der Herrscher nicht oder nicht mehr so viel reiste, musste er seine Wünsche und Befehle in stärkerem Maße schriftlich niederlegen und das Botenwesen besser organisieren. Mit der festen Hauptstadt wurde also der Regierungsstil „bürokratischer“, stärker verschriftlicht, der persönliche Umgang etwas weniger wichtig. Auch das gehört zu den Kennzeichen von „Staat“ im modernen Sinne.
Sehr deutlich kann man am 16. Jahrhundert beobachten, dass und auf welche Weise die Herrscher versuchten, sich selbst als übergeordnetes, „distanziertes“ Zentrum der Herrschaft zu etablieren und mehr Herrschaftsbefugnisse bei sich zu konzentrieren. In den meisten Staaten Europas herrschten in jener Zeit die Monarchen mithilfe und unter Mitwirkung der so genannten Stände.
Der Herrscher konnte die Stände seines Herrschaftsgebietes zu einer Ständeversammlung zusammenrufen, wenn er ihre militärische oder finanzielle Unterstützung brauchte. Das geschah unregelmäßig, denn es gab weder ständige Steuern noch ein stehendes Heer. Für einen Krieg aber brauchte der Herrscher mehr als das militärische Aufgebot seiner persönlichen Gefolgsleute. Seit dem 15. Jahrhundert wurden Kriege immer häufiger mithilfe bezahlter Söldner geführt, und die Kosten dafür explodierten. Auch andere politische Initiativen kosteten Geld, etwa die Mitgift für eine Prinzessin („Fräuleinsteuer“), der Festungsbau oder die Gründung einer höheren Schule. Wenn die Stände zu einer Ständeversammlung zusammentraten, mussten sie sich in der Regel bereit erklären, zu solchen herrscherlichen Initiativen beizutragen. Dadurch hatten die Stände aber auch das Recht, an der Herrschaft mitzuwirken und über die politischen Belange des Landes mitzuentscheiden. Für die Eintreibung der Steuern waren die Stände selbst zuständig, da es dafür noch keine Beamten gab. Auch Anordnungen, die weiter als im unmittelbaren Umkreis des Herrschers wirken sollten, mussten von den Ständen verkündet und durchgesetzt werden; und das gelang nur, wenn die Stände der Anordnung auch persönlich zugestimmt hatten.
Stände
Der Begriff „Stand“ hat zwei Bedeutungen. „Stand“ im rechtlichen Sinne bedeutet eine Personengruppe gleichen Rechtsstatus (z.B. Studenten, Handwerker, Soldaten). „Stand“ im politischen Sinn hieß eine Gruppe, deren Mitglieder das Recht hatten, an der Herrschaft teilzunehmen. Zu den politischen „Ständen“ einer Herrschaft gehörten in der Regel Geistlichkeit, Adel und (große) Städte.
Der Herrscher brauchte also Stände und Ständeversammlungen, um seine Herrschaft durchzusetzen, sowohl im Lande selbst als auch im Verhältnis zu anderen Herrschern. Die Ständeversammlungen waren damit an sich schon ein Instrument der Durchsetzung von Herrschaft, der „Herrschaftsverdichtung“ des Spätmittelalters. Seit dem 16.Jahrhundert aber versuchten die Herrscher, darüber hinauszugehen, die eigene Position der ständischen klar überzuordnen und die Mitwirkung der Stände zu beschneiden oder zu umgehen. Karl V. z. B. berief seit 1538 den Adel und die Geistlichkeit Kastiliens nicht mehr zu den Ständeversammlungen. Diese bestanden seitdem nur noch aus Städtevertretern, und ihnen gegenüber konnte der König seinen Willen leichter durchsetzen. Überhaupt beriefen die Herrscher möglichst selten eine Ständeversammlung ein und finanzierten Kriege und andere kostspielige Unternehmungen lieber mit Bankkrediten, wobei sie oft nicht mit Geld, sondern mit wirtschaftlichen Vorrechten oder Titeln bezahlten: So trug z. B. Kaiser Karl V. einen Teil seiner Schulden bei der Augsburger Kaufmannsfamilie Fugger dadurch ab, dass er ihnen das Recht verlieh, zwei Jahre lang (1525–1527) spanische Quecksilbervorkommen abzubauen; 1526 wurden drei Fugger in den Reichsgrafenstand erhoben. Eine weitere Einnahmequelle, durch die die Herrscher von der Geldbewilligung durch ihre Stände unabhängiger wurden, stellte der Verkauf von Ämtern, Titeln und Sonderrechten (Privilegien) dar. Heute gelten solche Verfahren als Korruption, nämlich als unzulässige Vermischung politischer mit privaten Belangen. Die Menschen der Frühen Neuzeit aber unterschieden kaum zwischen persönlichen und politischen Ansprüchen und sahen daher den Kauf eines Rechts oder Titels als normal an.
Auf den Ständeversammlungen selbst wurde hart und zäh verhandelt, nicht nur um die Höhe und Aufbringung von Steuern, sondern auch direkt um die Rechte der Stände und des Herrschers. Denn die Stände betrachteten sich nicht einfach als „Untertanen“, sondern als Politiker aus eigenem Recht, das sie entweder durch Geburt erworben (z.B. als Adlige) oder durch ihr Amt innehatten (z.B. als Bürgermeister einer wichtigen Stadt). Wenn sie sich in diesem Recht verletzt fühlten, wehrten sie sich mit Worten oder verweigerten die verlangte Geldbewilligung. Denn sie betonten zwar prinzipiell ihre Gehorsamspflicht gegenüber dem Herrscher, sahen sich aber zur Gegenwehr berechtigt, wenn er seine Befugnisse überzog oder nach ihrer Ansicht zu viel von ihnen verlangte. In schweren Konfliktfällen konnten die Stände sogar Krieg gegen den Monarchen führen – in Polen wurde ein solcher Krieg rokosz genannt und war ein hergebrachtes Recht der Adligen; die Niederlande sahen nach 1560 schwere kriegerische Auseinandersetzungen zwischen monarchischer „Zentral“-Gewalt und bewaffneter Ständemacht.
Im Allgemeinen verteidigten die Stände ihre hergebrachten Rechte auch in friedlichen Zeiten hartnäckig, sodass die Herrscher auf dem Weg zur distanzierenden Überordnung ihrer eigenen Position nur schrittweise vorankamen. In der Frühen Neuzeit endete prinzipiell jede herrscherliche Gewalt an den Grenzen einer niederen – ein Herrscher durfte, anders als heute, in das Recht einer niedereren Gewalt nicht ungestraft eingreifen. Tat er das dennoch, so artete seine Herrschaft in den Augen der Untergebenen in Tyrannei aus, und es war jede Art von Ungehorsam oder Widerstand erlaubt, bis hin zum Krieg. Zwar konnte die Staatstheorie des 16.Jahrhunderts behaupten, dem Herrscher komme die höchste Gewalt in einem Staat zu. So schrieb Jean Bodin (1529/30–1596) in seinem staatstheoretischen Werk „Sechs Bücher vom Staat“ (Six livres de la republique, 1576), der Herrscher übe eine besondere, herausragende Art von Gewalt aus, die Souveränität, und diese sei summa in subditos legibusque soluta potestas (die höchste und von den Gesetzen losgelöste Gewalt kraft Amtes gegenüber den Untergebenen). Für das 16.Jahrhundert war es noch ungewöhnlich, die Beherrschten als subditos (Untergebene, Unterworfene) aufzufassen, der Satz betonte – als theoretische Behauptung oder Idealvorstellung – die große Distanz zwischen „souveränen“ Herrschern und ihren „Untertanen“. In der Praxis der Politik erwies sich der Satz als bloßer Anspruch; die Gewalt eines Herrschers fand an den Rechten der niederen Gewalten bisweilen recht enge Grenzen. Gerade im 16. und 17. Jahrhundert stießen die Herrscher sehr häufig auf Widerstand bei ihrem Bemühen, niedere Gewalten wie Stände oder Städte in das eigene Machtgefüge einzubeziehen und ihre Rechte zu beschneiden. Da viele dieser niederen Gewalten über eigene Waffen verfügten und sie auch einsetzten, geriet das 16. Jahrhundert zu einer besonders konfliktreichen und kriegerischen Zeit.
Wenn man diese Kämpfe aus dem Abstand fast eines halben Jahrtausends betrachtet, muss man bedenken, dass die damaligen Herrscher sich eine „absolute“ Gewalt im Sinne einer Diktatur des 20. Jahrhunderts nicht vorstellen konnten. Die „höchste Gewalt“, von der Bodin spricht, stand zwar über dem positiven Recht, den „Gesetzen“. Aber sie war nicht unbeschränkt, und nicht nur Macht und Waffengewalt fremder Mächte wirkten ihr entgegen, sondern Kräfte, die nach Ansicht des Zeitalters höher standen als jede Macht, nämlich Religion und Recht. Die Macht jedes Herrschers fand ihre Grenzen vor Gott: Ein Fürst, der die Autorität Gottes missachtete, gefährdete damit seine eigene Stellung. Denn wenn er gegen Gottes Gebot handelte, wurde er in den Augen seiner Untergebenen zum Tyrannen, und mit dieser Argumentation ließ sich Aufbegehren jeder Art rechtfertigen, bis zum politischen Mord. Es entsprach also sozusagen der Machtrationalität, die Autorität Gottes zu achten, und bis zum 18. Jahrhundert anerkannten auch die meisten Herrscher diese Autorität über sich. Wer sie nicht achtete, musste Frömmigkeit zumindest heucheln, wie es Machiavelli beschreibt (siehe Quelle).
Schließlich begrenzte, wie gesagt, das Recht der niederen Gewalten jede Herrschaft, und ein Herrscher respektierte dieses Recht normalerweise auch. Grundsätzlich gestand er den Untertanen ihr eigenes Recht zu, im Gegensatz zu einem Diktator des 20. Jahrhunderts. Bei allen Versuchen der Herrschaftskonzentration gestand der frühneuzeitliche Herrscher seinen Untergebenen auch zu, dass sie ein vom Recht anderer Gruppen unterschiedenes Recht hatten und behalten wollten. Er hielt den Adel symbolisch und politisch auf Distanz, tastete aber seine hohe gesellschaftliche Position nicht an oder stärkte sie sogar noch. Er konnte Revolten von Bauern unbarmherzig niederschlagen, aber unter Umständen bekamen die Bauern Recht, wenn sie vor seinem Gericht prozessierten. Er erzwang Verfassungsänderungen in großen Städten, hütete sich aber wohl, die Städte als bloße Untertanenverbände zu behandeln.
Machiavelli: Der Fürst (1513), XVIII. Kapitel
Zitiert nach: Gottfried Guggenbühl/Hans C. Huber (Hrsg.): Quellen zur Geschichte der Neueren Zeit, neu bearbeitet von Hans C. Huber, Zürich 31965, S. 19.
Es ist also nicht nötig, dass ein Fürst alle die Tugenden, welche ich oben angab, gerade in Wirklichkeit besitze, sondern es genügt schon, wenn er sie nur zur Schau trägt. Ja, ich getraue mir zu behaupten, dass es sogar gefährlich für ihn wäre, wenn er sie wirklich alle hätte und immer ausübte, da es ihm im Gegenteil nützlich ist, wenn er sie nur zu haben scheint. Ein Fürst muss gnädig, rechtschaffen, herablassend, aufrichtig und gottesfürchtig scheinen, und gleichwohl sich so in der Hand haben, dass er im Falle der Not gerade das Gegenteil von all dem sein kann. […] Ein Fürst hat sich daher anzugewöhnen, sich nie anders zu äußern als auf eine jenen fünf Tugenden entsprechende Weise, sodass jeder, der ihn sieht, die Überzeugung habe, er sei die Güte, die Redlichkeit, die Treue, die Höflichkeit, die Frömmigkeit selbst. Er darf besonders nie unterlassen, letztere Eigenschaft äußerlich zu zeigen. Die Menschen pflegen ja gemeiniglich mehr nach den Augen als nach den Händen zu urteilen; denn jeder ist in der Lage zu sehen, wenige aber zu fühlen. Jeder sieht, was der Fürst scheint, aber fast niemand weiß, wie er in Wirklichkeit ist, und diese Minderheit wagt nicht, der Meinung der vielen entgegenzutreten, welche der Schild der Majestät deckt.
Die Kämpfe um Macht in der Frühen Neuzeit erreichten daher selten prinzipielle Schärfe: Es ging nie darum, den Herrscher zur alleinigen Quelle aller Macht zu erheben oder die Untertanen zu völlig rechtlosen Unterworfenen zu machen. Das sollte erst den Diktaturen des 20.Jahrhunderts gelingen. Machtkämpfe waren immer nur Auseinandersetzungen um etwas mehr Macht auf der einen oder etwas größere Befugnisse auf der anderen Seite. Der frühneuzeitliche Herrscher strebte zwar danach, seine eigene Position zur höchsten politischen Gewalt im Lande zu machen und andere Gewalten in sein politisches System einzuordnen, ob auf friedlichem Wege oder gewaltsam. Aber alleiniger Träger aller politischen Gewalt war er nicht und wollte es auch nicht sein; er respektierte das durch Herkommen oder schriftliche Festlegung legitimierte Recht der niedereren Gewalten. Aufgrund dieses Prinzips behielten z. B. eroberte Gebiete ihre eigenen Ständeversammlungen, eigene Rechtsbücher, wenn es sie gab, eigene Methoden der Steuereinziehung und ihre eigene Amtssprache. Sie wurden in den Herrschaftsverband eines Herrschers eingegliedert, aber nicht alle gleich behandelt. Daher waren frühneuzeitliche Herrschaften nie einheitliche Gebilde, sondern immer aus Einzelherrschaften unterschiedlicher Rechtsstellung und Tradition zusammengesetzt. Der Herrscher regierte in den einzelnen Teilen aufgrund unterschiedlicher Rechtstitel und je nach Herrschaftsgebiet auch nach verschiedenem Recht. In die Herrschertitel konnten außerdem Herrschaftsansprüche und bloße politische Fiktionen eingehen, sodass die Titulatur eine lange Reihe ergab wie beim Titel Karls V. (siehe Quelle).
Die einzelnen Teile der Herrschaft konnten wiederum zusammengesetzt sein, sodass sich ein gegenüber heutiger Staatlichkeit sehr kompliziertes Geflecht von Herrschafts- und Rechtsbeziehungen ergab.
Titulatur Karls V.
Zitiert nach: Schulin, Kaiser Karl V., S. 6.
Wir Carl V. von Gottes Gnaden Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, zu Castilien, Aragon, Leon, beider Sicilien, Jerusalem, Ungarn, Dalmatien, Croatien, Navarra, Granada, Toledo, Valencia etc., Mallorca, Sardinien, der Canarischen und Indianischen Inseln und der Terrae firmae des Oceanischen Meeres etc., Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund, Lothringen, Brabant, Steyer, Kärnten, Krain, zu Luxemburg, zu Athen etc., Graf zu Habsburg, zu Flandern, Tirol, zu Burgund, Pfalzgraf zu Hennegau, zu Holland, zu Seeland, Landgraf im Elsaß, des Heiligen Römischen Reiches Fürst zu Schwaben, Herr in Friesland, zu Tripolis, zu Mecheln etc.
Um in diesen Rechtsbeziehungen seinen Willen durchzusetzen, also Macht zu erringen und zu behalten, musste ein Herrscher die Rechte von Einzelnen und Gruppen sehr gut kennen und respektieren – oder sie gezielt missachten, wenn er seine Herrschaft intensivieren und mehr Macht erkämpfen wollte. Weil die Untergebenen selbst nicht ohnmächtig waren, riskierte er in einem solchen Fall Konflikte bis hin zum Krieg. Oft wurden die Konflikte noch zusätzlich verschärft und aufgeheizt durch die aufbrechenden konfessionellen Gegensätze zwischen den christlichen Bekenntniskirchen oder durch religiöse Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen oder Juden. Die aufbrechenden Kräfte der Neuzeit, vor allem die Herrschaftskonzentration und die Konfessionsbildung, rieben sich an der traditionellen Ordnung von Herrschaft und Religion. Diese Ordnung war zwar auch bisher nicht konfliktlos gewesen, aber sie konnte die neuen Kräfte weder aufnehmen noch sich gegen sie abschotten. So stießen Neues und Altes im 16. Jahrhundert oft spannungsgeladen und gewaltsam zusammen. Manche Institutionen wurden buchstäblich gesprengt und fielen auseinander wie die Kirche des Mittelalters. Andere wandelten sich um wie die politischen Herrschaftsgebiete, die man mangels einer genaueren Bezeichnung „Staaten“ nennt, obgleich sie eigentlich erst werdende Staaten waren, personale Herrschaftsverbände mit Ansätzen zu einer vom Herrscher losgelösten „Staats“tätigkeit. Manche blieben scheinbar unverändert wie die großen Städte Nürnberg, Augsburg oder Danzig, deren Machtverlust sich erst allmählich im Laufe des Jahrhunderts herausstellte. In all dem erscheint das 16. Jahrhundert als ein Zeitalter beschleunigten und deutlich sichtbaren Wandels oder, wie die Historiker sagen, als Übergangszeit.