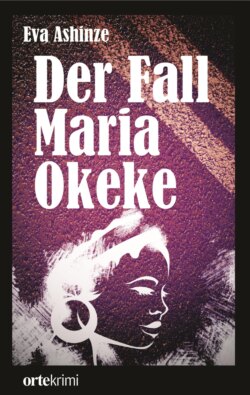Читать книгу Der Fall Maria Okeke - Eva Ashinze - Страница 14
Оглавление10
Eine Stunde später sass ich in einem Wartezimmer an der Wartstrasse, nicht weit vom Hotel Wartmann, und wartete wahnsinnig lange auf Herrn Wagner. Kein Witz. Aber was für eine Alliteration. James Wagner ist mein Therapeut. Mein Psychotherapeut. Spätestens seit «In Treatment» ist es ja durchaus angesagt, sich in Behandlung zu begeben. Der Gang zum Psychologen gehört zum Lifestyle. Eigentlich wurde dieser Trend bereits früher eingeleitet, als Tony sich in «The Sopranos» von der scharfen Jennifer Melfi therapieren liess. Legendär ist Tonys Schlussanalyse: «Ich hab irgendwann erkannt, dass unsere Mütter – dass sie Busfahrer sind. Sie sind – nein, sie sind der Bus. Sie sind das Fahrzeug, das uns hierherbringt. Sie lassen uns raus und fahren weiter. Sie setzen ihre eigene Reise fort. Und das Problem ist, dass wir dauernd versuchen, wieder in den Bus zu kommen, anstatt ihn einfach fahren zu lassen.» Immer sind die Mütter schuld. Ich bin zum Glück keine Mutter. Ich hab auch nicht vor, jemals Mutter zu werden. Wenn meine Mutter mir eines beigebracht hatte, dann das.
Und nur damit es gesagt ist: Ich hatte die Psychotherapie bereits für mich entdeckt, als ihre in Anspruchnahme noch mit Schamgefühl verbunden war. Als Psychotherapie noch gleichgesetzt wurde mit versagt haben. Eine Schraube locker haben. Nicht ganz durchgebacken sein. Zwei Jahre nach Marias Verschwinden suchte ich zum ersten Mal einen Psychologen auf. Meine sämtlichen Sitzungen würden locker eine komplette Staffel «In Treatment» ergeben, die allerdings wohl niemand sehen möchte. Seit einiger Zeit vereinbare ich nur noch sporadisch Therapiesitzungen. Ich denke, ich bin so sehr therapiert, wie ich nur therapiert werden kann. Zu mehr bin ich nicht fähig. James Wagner, mein Therapeut, sieht dies natürlich anders. Uns verbindet mittlerweile mehr ein freundschaftliches Verhältnis als eine Therapeut-Patient-Beziehung. Das hindert James aber nicht daran, mir saftige Rechnungen zu schicken.
An manchen Tagen verspüre ich das spontane Bedürfnis nach einer Unterhaltung mit James. Das Bedürfnis, ihm das Neuste aus meinem Leben zu erzählen und eine Reaktion darauf zu erhalten, eine Rückmeldung, ob ich gut unterwegs bin oder nicht. Irgendwie fehlt mir ein sechster Sinn, um das selber beurteilen zu können. Ich bin wie eine Fledermaus ohne Radar und laufe stets Gefahr, gegen ein Hindernis zu fliegen. Heute war so ein Tag. James hatte mir auf meinen Anruf hin einen Termin nach Feierabend angeboten, was mir recht war.
Und nun sass ich also hier und wartete darauf, meine Seele durchchecken zu lassen. Das Wartezimmer meines Therapeuten sieht aus, wie viele Wartezimmer von Therapeuten aussehen. Alles ist teuer, aber unauffällig: von den durchaus bequemen, aber nicht zu bequemen Designerstühlen über den geschliffenen Holzboden, den in dezenten Farben gehaltenen Kelim und die farblich stimmigen, dezenten Gemälde an der Wand. Alles vermittelt ein unaufdringliches «Fühl dich wohl hier». Die Strategie geht auf. Ich fühle mich wohl hier.
Ich hatte auch schon versucht, meine Wohnung ähnlich zu gestalten, auch sie zu einer Wohlfühloase zu machen mit Teppichen, warmen Farbtönen und dem einen oder anderen dekorativen Gegenstand. Doch es war mir nicht gelungen. Die Sachen passten nicht zu meiner Wohnung, nicht zu mir. Ich hatte mich gefühlt wie früher, als Jugendliche, wenn ich den Stil eines gerade angesagten Promis imitierte. Ich kleidete mich wie sie, schminkte mich gleich, machte die Sprache und die Mimik nach, immer im Bewusstsein, eine Nachahmerin zu sein. Immer im Bewusstsein, dass ich nicht ich selbst war, sondern eine Rolle spielte. So war es mir nach der Neuausstattung meiner Wohnung ergangen: Ich fühlte mich in meiner stimmigen dezenten Wohnung nicht wohl. Also brachte ich den ganzen Krempel kurzerhand zur Heilsarmee. Ich wurde behandelt wie die Reinkarnation der Jungfrau Maria. Meine Wohnung erhielt ihr altes, etwas schäbiges, karges Selbst zurück, und seither ist es dabei geblieben. Ich schlafe auf einem Futon, habe nur das Notwendigste an Möbeln, und die Wände sind grösstenteils kahl und weiss. Es gefällt mir so. Ich bin so. Kahl und karg. Innerlich.
Endlich kam James in Begleitung eines Patienten aus seinem Sprechzimmer. «Hi», sagte er zu mir, nachdem er den Patienten verabschiedet hatte. James ist vor drei Jahrzenten der Liebe wegen aus den USA hierhergezogen. Die Liebe ist schon lange weitergezogen, aber er ist geblieben. Er geht jetzt auf Mitte fünfzig zu. James gehört zu den Männern, die Frauen lieben und die sich immer neu verlieben wollen. So ist es nicht weiter erstaunlich – wenn für einen Therapeuten vielleicht auch nicht gerade üblich –, dass er bereits zweimal geschieden ist.
«Hallo», sagte ich und erhob mich. James begleitete mich in sein Sprechzimmer. Ich setzte mich in den Therapiestuhl.
«Wie geht’s?», fragte ich. «Immer noch am Alimente Zahlen?» Das war eine Art Dauerscherz zwischen uns. In einer schwachen Minute des Selbstmitleids hatte James sich über die horrenden Summen beklagt, die er seinen Kindern aus erster Ehe bezahlen musste. Er war der festen Überzeugung, weniger Chancen bei Frauen zu haben, da er deswegen ein armer Schlucker war. Ich hatte nicht versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
«Ja, aber nicht mehr lange.» James lachte. «In zwölf Monaten ist es vollbracht.»
«Dann bist du also bald wieder eine gute Partie», sagte ich und zwinkerte ihm zu. Ich flirtete manchmal mit James, auf eine durch und durch harmlose Art. Es war bloss Spass. Mehr war da nicht. James ist mein Therapeut. Wir kennen uns zu gut. Nein, James kennt mich zu gut, meine dunkle Seele, meine Abgründe, meine Störungen. Zwischen uns könnte nie etwas laufen nach all dem, was ich ihm erzählt habe. Das wäre echt abartig.
«Also Moira.» James lehnte sich zurück und betrachtete mich. Das Vorgeplänkel war vorüber. Nun ging es zur Sache. «Was ist los?»
Ich schlug die Augen nieder. Ich habe von meinem Vater geträumt, wollte ich sagen. Ich denke wieder immerzu an Maria, wollte ich sagen. Ich bin durcheinander, wollte ich sagen. Ich sagte nichts von allem. «Ich habe einen neuen Fall», sagte ich stattdessen.
James warf mir einen Blick zu. «Weshalb bist du hier, wenn du nicht reden möchtest?»
«Ich rede ja», sagte ich. «Ich habe einen neuen Fall.»
James zog die Augenbrauen hoch. Nach und nach gelang es ihm, mir die Details zu entlocken. Wir sprachen über die tote Maria, die sich von der Brücke gestürzt hatte. Über die Fotos, die mir so nahe gingen. Wir sprachen über meinen Vater. Und über Maria, meine Maria, meine verschwundene Maria, von der ich nicht wusste, ob sie lebte oder tot war.
«Meinst du, es ist klug, dass du diesen Fall angenommen hast?», fragte James schliesslich.
Ich zuckte die Achseln. «Ich hatte keine Wahl», sagte ich.
«Man hat immer eine Wahl.»
Wir sassen eine Weile schweigend da.
Vielleicht hat man immer eine Wahl. Aber man hat auch ein Schicksal, dem man nicht entfliehen kann. Es holt einen ein, welche Wahl man auch trifft.
«Ich will nur herausfinden, was genau mit Maria passiert ist», sagte ich.
«Mit Maria Okeke? Oder mit deiner Schwester Maria?», fragte James.
Diese Frage stellte ich mir auch die ganze Zeit, seit ich den Fall übernommen hatte.
«Und wird sie davon wieder lebendig, Maria, wenn du das herausgefunden hast?», hakte James nach.
«Vielleicht», sagte ich. «Vielleicht wird ein Teil von ihr irgendwo wieder lebendig.»
James musterte mich. «Trinkst du?», fragte er.
Die Frage war durchaus berechtigt. Es hatte Phasen in meinem Leben gegeben, da hatte ich den Tag mit einer Flasche Sekt begrüsst und mit einer Flasche Wodka verabschiedet. Es hat durchaus seine Gründe, weswegen ich erst mit Anfang dreissig mein Anwaltsexamen abgelegt hatte. Auch das war Thema meiner Therapie gewesen.
Ich schüttelte den Kopf. «Nicht mehr als sonst», sagte ich. Das stimmte. Ich trank meine drei, vier abendlichen Gläser Wein. Ohne die konnte ich nicht einschlafen. Ansonsten widerstand ich allen Versuchungen.
«Tabletten? Sonstige Substanzen?»
Wieder schüttelte ich den Kopf. Ich nahm es ihm nicht übel. James kannte alle meine Laster.
«Du siehst nicht gut aus», sagte er.
«Ich weiss», sagte ich.
«Irgendwann musst du mit der Vergangenheit abschliessen», sagte James. «Dieser Auftrag hilft dir nicht dabei. Im Gegenteil.»
«Ich habe nichts abzuschliessen.»
«Du lügst», sagte James.
«Nein.»
«Du weisst, dass du lügst», sagte James.
Das stimmte. Ich vereinbarte einen weiteren Termin mit James. Ich hatte das Gefühl, ihn im Moment bitter nötig zu haben.