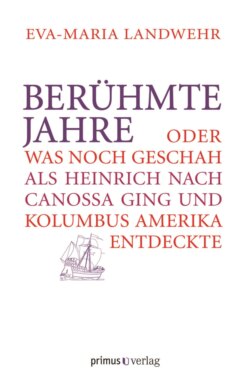Читать книгу Berühmte Jahre - Eva-Maria Landwehr - Страница 10
1122 Die Krone ordnet sich unter: Das Wormser Konkordat
ОглавлениеSeine Heiligkeit gefiel sich. Würde und Autorität seines Amtes schienen ihm außerordentlich gut getroffen. Nehmen wir an, es war ein sonniger Tag im römischen Frühling des Jahres 1124. Wenn Calixt II. die frisch bemalten Wände der neu erbauten Camera pro secretis consiliis (Kammer des Geheimen Rats) im Lateranpalast1 betrachtete, dann sah er mit Wohlgefallen einen thronenden Papst, also sich selbst, und einen stehenden Kaiser, nämlich Heinrich V. Für alle Zeiten und für alle nachfolgenden Generationen unübersehbar an der Wand verewigt, erhielt Papst Calixt II. in der abgebildeten Szene aus der Hand seines kaiserlichen Kontrahenten dasjenige Dokument, das allein der Kirche die Investitur geistlicher Ämter garantierte. Ein äußerst angenehmer und befriedigender Anblick, an dem sich der Papst, wenn er es denn wollte, nun nach Belieben erfreuen konnte. Den Text des sogenannten Henricianums, also der Urkunde, mit der der Verzicht des deutschen Königtums auf die Einsetzung von Bischöfen verbindlich wurde, hatte man als sichtbaren Beleg gut lesbar auf die Wand gemalt. Das existierende Gegenstück jedoch, das Calixtinum, das durchaus Zugeständnisse an die weltliche Autorität des Königtums beinhaltete, glaubte man in der ‚römischen‘ Interpretation des Geschehens nicht berücksichtigen zu müssen. Interessanterweise war ein dergestalt illustrierter päpstlicher Triumph reine Fiktion, denn dieser denkwürdige Moment der Übergabe hatte niemals stattgefunden! Mehr noch: Papst und Kaiser waren sich zu Lebzeiten nie begegnet – weder vor noch an noch nach dem 23. September 1122, als vor den Toren der Stadt Worms das Ende des Investiturstreits besiegelt worden war. Das Wandgemälde war also reine Propaganda, man sah in römischen Kreisen geflissentlich darüber hinweg, dass in diesem Fall Wunschdenken vor Wahrheit rangierte. Der sogenannte „Wormser Frieden“ – erst der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz sollte im Jahr 1693 den Begriff vom „Wormser Konkordat“ prägen – hatte aber durchaus akzeptable Väter. Immerhin zwei künftige Päpste gehörten zu der Delegation, die Calixt II. im Sommer 1122 nach Deutschland entsandte: Kardinalbischof Lambert von Ostia, der spätere Honorius II., sowie Kardinaldiakon Gregor von Sant’Angelo in Pescheria, der sich dereinst Innozenz II. nennen sollte.
Das Wormser Konkordat markierte das vorläufige Ende eines lange schwelenden Konflikts um das Recht zur Wahl und Einsetzung von Bischöfen, dessen Ursprung im 11. Jahrhundert lag. Der eigentliche Auslöser für die in letzter Konsequenz mit äußerster Härte geführte Auseinandersetzung war die Investitur des Bischofs von Mailand gewesen, den der deutsche König Heinrich IV. gegen den Willen des dortigen Klerus im Jahr 1071 durchgesetzt hatte. Mit seinem kontroversen Kurs musste Heinrich fast zwangsläufig scheitern, und auch sein Bußgang nach Canossa vertagte den Konflikt mit der Kirche nur in die Zukunft. Für das Papsttum konnte es aber langfristig nur ein Ziel geben: Unter allen Umständen mussten Laien wie der König aus dem Vorgang der Investitur verdrängt und damit die Verflechtungen zwischen hoher Geistlichkeit und Königtum gelöst werden.
Während Heinrich IV. nach seinem barfüßigen Intermezzo im oberitalienischen Winter gänzlich unbeeindruckt sein königliches Tagesgeschäft wieder aufnahm, musste sich Gregor VII. ganz unerwartet und wider Willen als Verlierer fühlen. Durch seine Nachgiebigkeit gegenüber dem Kaiser war er für die deutschen Fürsten entbehrlich geworden, die im März 1076 Rudolf von Rheinfelden eigenmächtig zum deutschen Gegenkönig wählten. Als Heinrich im Jahr darauf nach Deutschland zurückkehrte, fand er deswegen ein Reich in Aufruhr vor: Loyalität für Heinrich oder Rudolf, diese Frage spaltete ganze Adelsfamilien in unversöhnlich verfeindete Lager. Gregor wiederum zauderte, unfähig, sich für einen der beiden Kandidaten zu entscheiden, und versank für drei Jahre in unschlüssiges Schweigen. Als er endlich aus seiner Lethargie erwachte, verhängte er erneut den Bann über Heinrich IV. – was als päpstliche Disziplinierungsmaßnahme mittlerweile zum Tagesgeschäft gehörte und kaum noch Aufsehen erregte! Der deutsche Gegenkönig schließlich, Rudolf von Rheinfelden, tat Heinrich den Gefallen und starb im selben Jahr an den Folgen des Verlustes seiner rechten Hand, also seiner Schwurhand, mit dem er seinem König einst die Treue gelobt hatte.
Was Heinrich jetzt noch fehlte, war die Kaiserkrone: Deswegen zog der deutsche König 1083 vor die Tore Roms, der Ewigen Stadt, die nach längerer Belagerung kapitulierte. Gregor VII. ergriff die Flucht, und der pragmatische Heinrich ließ kurzerhand einen ihm wohlgesonnenen Papst wählen, Clemens III., der ihn an Ostern dann auch zum Kaiser krönte. Gregor starb bereits zwei Jahre später im Exil, aber die beiden Gegenpäpste zu Clemens, die man innerhalb eines kurzen Zeitraums wählte, konnten sich gegen den neuen Kaiser nicht durchsetzen. Überhaupt schien diese schismatische Zeit alles in mehrfacher Ausführung hervorzubringen, was der damalige Geschichtsschreiber von Augsburg, zwischen Verzweiflung und Sarkasmus schwankend, folgendermaßen kommentierte: Wir sind alle verdoppelt: die Päpste, die Bischöfe, die Könige, die Herzöge!2 Kaiser Heinrich IV. war also, ungeachtet seiner Exkommunikation, scheinbar gestärkt aus diesem Italienzug hervorgegangen. Doch das Blatt wendete sich und es waren vor allem zwei Frauen, die sein Schicksal besiegelten: Seine Gemahlin Bertha sagte sich von ihm los, und seine in Oberitalien strategisch unverzichtbare Verbündete Mathilde von Canossa paktierte durch Heirat mit den feindlichen Bayern. Als Heinrich nach vier langen Jahren nach Deutschland zurückkehren konnte, hatte er Italien faktisch verloren.
Der Gordische Knoten des Investiturstreits musste aber noch weitere dreißig Jahre auf seine Zerschlagung warten. Währenddessen orientierte sich das Papsttum nach Nordwesten, wo es in Frankreich einen starken Verbündeten fand, der Schutz vor den Nachstellungen der salischen Könige garantierte, und wo sich das mächtige Kloster Cluny als adäquate Residenz außerhalb Italiens anbot. Die Angelegenheiten der Investitur ließen sich hierzulande erfreulich schmerz- und widerstandslos regeln, denn König Philipp I. selbst sollte dem Papst das Druckmittel dazu an die Hand geben. Für eine neue Ehe hatte er seine rechtmäßige Gemahlin verstoßen und wurde für dieses Vergehen folgerichtig exkommuniziert. In letzter Konsequenz führte dies zu Philipps demütiger Unterwerfung und zur Anerkennung des alleinigen Investiturrechts der Kirche in Frankreich. Auch die noch junge normannische Monarchie in England akzeptierte zu Beginn des 12. Jahrhunderts im sogenannten „Londoner Konkordat“ den Primat der Kirche hinsichtlich der Wahl und der Einsetzung von Bischöfen. Blieb das ‚deutsche Problem‘, das sich auch durch den probaten, aber mittlerweile inflationären Einsatz der Exkommunikation nicht lösen ließ. Als Heinrich IV. 1106 starb, keimte in Papst Paschalis II. die Hoffnung auf eine einvernehmliche Lösung mit dessen Sohn und Nachfolger, dem er als Entgegenkommen eine rasche Kaiserkrönung in Aussicht stellte. Doch auch dieser Heinrich, der fünfte seines Namens, hielt unverdrossen an der Investitur fest.
Ironischerweise war es aber der Papst selbst, der im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts für ein gerüttelt Maß an Konfusion und Empörung in kirchlichen Reihen sorgte. Bereits seit der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts hatte man sich gemüht, Simonie und Konkubinat, also den Ämterkauf und die Priesterehe, zu bekämpfen, und um eine sittenstrenge und angemessene Lebensführung des Klerus gerungen. Paschalis II. galt als überzeugter und rechtschaffener Reformator, aber sein in diesen Dingen naiv anmutender Idealismus führte zu einer veritablen innerkirchlichen Krise. Denn mit der Annahme, dass die hohen geistlichen Würdenträger seinen Reformeifer bis zur letzten Konsequenz mittragen würden, erlag Paschalis einem grotesken Irrtum. Sein ambitionierter Plan zielte auf die irreversible Zerstörung des engen Loyalitätsgeflechts ab, das König und Klerus in Deutschland seit dem 10. Jahrhundert verband. Unter den Ottonen, den Vorgängern der Salier, war der Klerus damals unverzichtbar für die Administration und Regierbarkeit des riesigen Reiches geworden. Der unschätzbare Vorteil eines geistlichen gegenüber einem adeligen Beamten war vor allem, dass dieser keine Familie zu versorgen und nichts zu vererben hatte: ‚Personal‘ wie dieses war bei auftretenden Konflikten also problemloser abzusetzen. Paschalis II. nun stellte Heinrich V. im Jahr 1111 bei einem Verzicht auf die Investitur die Rückerstattung aller Besitzungen und weltlichen Rechte in Aussicht, das heißt unter anderem Städte, Herzogtümer, Zoll- und Marktrechte von den Bischöfen. Heinrich, der um die Anspruchshaltung und den hohen Lebensstandard des Klerus wusste, akzeptierte dieses Angebot. Der Sturm der Entrüstung aber, der nun aus den eigenen Reihen über den Papst hereinbrach, war beispiellos: Askese und drohende Verarmung plastisch vor Augen, probten die Kleriker den Aufstand. Priesterliche Ideale schön und gut, aber so weit wollte man doch nicht gehen! Eingeschüchtert und verunsichert zog der Papst sein Angebot zurück, die Krönung fiel aus – und Heinrich V. setzte ihn dafür gefangen. Er presste ihm das Recht ab, die Bischöfe weiterhin investieren zu dürfen – ein Privileg, das als Schandbrief in die Kirchengeschichte eingehen sollte –, und zwang ihn zwei Tage später dazu, ihn zum Kaiser zu krönen. Was für eine verheerende Niederlage: das Papsttum am Boden, die Reformanstrengungen gescheitert.
Die deutschen Fürsten hatten Heinrichs großen Triumph aus der Ferne mit gemischten Gefühlen verfolgt und beschlossen zu handeln, bevor es zu spät war. Mit der Rückerstattung aller geistlichen Besitzungen war schemenhaft, aber erschreckend realistisch das Gespenst einer monströsen Machtakkumulation am Horizont erschienen. Man hatte außerdem in höheren Kreisen verschnupft registriert, dass die Salier zusehends auf die sozialen Aufsteiger des Rittertums – ehemals unfreie Dienstmannen – als willige und ehrgeizige Regierungshelfer vertrauten. Es galt nun, um jeden Preis zu verhindern, dass die autokratisch regierenden Salier in Zukunft gänzlich unbeherrschbar wurden. Am Tag seiner Hochzeit im Januar 1114 war für Heinrich V. die kaiserliche Welt noch in Ordnung, doch dann brach sein Machtkonstrukt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Der stets so ergebene Klerus verweigerte ihm die Gefolgschaft, und an Ostern 1115 wurde in Köln erneut seine Exkommunikation ausgesprochen. In einer Art Staatsstreich wechselten die Fürsten des Reichs ins päpstliche Lager und es kam zu Aufständen mit bürgerkriegsähnlichen Zügen. Calixt II., der Nachfolger von Paschalis II., reichte Heinrich V. zum wiederholten Mal die Hand zu Verhandlungen. Es wird kaum verwundern, dass deren Scheitern zu einer weiteren – richtig! – Exkommunikation des Kaisers führte. Die deutschen Fürsten waren nun in der Position, ihren König zu Verhandlungen mit der Kirche zu zwingen.
Weil unter allen Umständen eine Einigung im Investiturkonflikt herbeigeführt werden musste, wurden die Vorbereitungen für ein Zusammentreffen beider Seiten im September 1122 mit großer Sorgfalt und einem enormen diplomatischen Aufwand betrieben. Um jede Missstimmung im Vorfeld zu vermeiden, wählte der Papst ausschließlich seine fähigsten Rechtsgelehrten aus, die demonstrativ als mediatores, also als Mittler und nicht als Fordernde, definiert wurden. Man verzichtete auch auf die Entsendung eines Legaten, der an einer der vielen Exkommunikationen Heinrichs V. maßgeblich beteiligt gewesen war und dessen Anwesenheit als Affront hätte interpretiert werden können. Die päpstliche Abordnung traf im Hochsommer 1122 in Deutschland ein und lud Kaiser, Kleriker und Fürsten zur Synode nach Mainz. Ein letztes Mal zeigte sich Heinrich V. kompromisslos, als er diesen Verhandlungsort ablehnte und sich damit auch durchsetzte. Für ihn war Erzbischof Adalbert von Mainz, der Anführer der geistlichen Opposition in seinem Reich, als Gastgeber nicht akzeptabel. Worms am Rhein sollte der Ort sein, an dem Papsttum und Königtum ihren alten Streit beilegten.
Es ist eine wechselvolle Geschichte, die die Königsfamilie mit dieser Stadt verband, denn kaum fünfzig Jahre zuvor wäre dort kein Salier mehr wirklich willkommen gewesen. Im 10. Jahrhundert aber, als Grafen im Worms- und Speyergau, waren die Salier Herren über die alte Bischofsstadt. Der Aufstieg der ursprünglich fränkischen Adelsfamilie hatte mit Konrad dem Roten begonnen, der als Schwiegersohn Kaiser Ottos I. zum Herzog von Lothringen avancierte. Herrschaftssitz der Grafen in Worms war eine Burg im Osten der Stadt, die als ein ungewöhnlich weitläufiges Ensemble mit einer beeindruckenden Anzahl gemauerter Gebäude und Türme über die Gaugrenzen hinaus bekannt war. Spätestens aber als die Salier den städtischen Dom zu ihrer Grablege bestimmten, konnte niemand mehr in Zweifel ziehen, dass diese ehrgeizige Familie nach Höherem strebte – womöglich nach dem Königsthron. Opfer dieses Prioritätenwechsels wurde Worms, das von seinen Herren vernachlässigt wurde und zusehends an Bedeutung verlor. Das allein würde erklären, weshalb um die Jahrtausendwende für die einst blühende Stadt höchst problematische Verhältnisse überliefert sind. Mangelnde gräfliche Präsenz und damit das Fehlen einer handlungsfähigen Instanz hatten zur Erosion der öffentlichen Ordnung und zum Verfall der Stadtmauer geführt. Es hieß, dass viele Wormser damals die Stadt verlassen hätten, weil die durchlässig gewordenen Mauern keinen Schutz mehr vor Kriminellen und wilden Tieren boten. Trotz der familiären Verbundenheit mit den Saliern übertrugen die Ottonen schließlich wichtige Rechte und Einkünfte dieser Stadt, deren Einwohnerzahl auf die eines größeren Dorfes geschrumpft war, dem Bistum. Die starke Persönlichkeit, die Worms aus seiner prekären Situation befreien sollte, war Bischof Burchard. Aus hessischem Adel stammend, war Burchard in Mainz ausgebildet worden und unterhielt exzellente Verbindungen zum ottonischen Königshaus. Doch auch wenn die Salier Worms als Verlust verbuchen mussten – die Zeit dieses Geschlechtes war unwiderruflich gekommen. Ab dem Jahr 1025 wurde Speyer unter dem ersten Salierkönig Konrad II. durch den Bau des Doms, der in erster Linie als Familiengrablege fungieren sollte, systematisch zum Machtzentrum aufgebaut. Selbstverständlich wurde die Memoria der in Worms begrabenen Ahnen auch weiterhin gepflegt, aber die vorerst endgültige Verdrängung der Salier aus ihrer ehemaligen Residenz war besiegelt. Das stärkte die Position von Bischof Burchard, der sich nun mit ganzer Kraft der groß angelegten Neuordnung und Umgestaltung ‚seiner‘ Stadt widmen konnte. Er begann mit dem imposanten Neubau des Domes und ließ zugleich die eindrucksvollste Erinnerung an die einstigen Herren tilgen: die imposante Salierburg wurde geschleift und aus ihren Mauersteinen ein dem Apostel Paulus geweihtes Stift errichtet. Eine Inschrift feierte den städtischen Freiheitsgedanken und interpretierte damit den Machtwechsel als Akt der Emanzipation von der Herrschaft des Adels. Worms war also die Stadt, die die Salier groß gemacht hatte, die Stadt, in der sich die Grablege des Urvaters der Dynastie befand. Worms war aber auch die Stadt, aus der die ehemaligen Gaugrafen eine Generation zuvor verdrängt worden waren. Heinrichs Wahl wäre im September 1122 mit Sicherheit nicht auf diesen Ort gefallen, wenn sich das Blatt in der Zwischenzeit nicht erneut zugunsten der Salier gewendet hätte: 1073 erhob sich das Volk gegen den Bischof, vertrieb ihn aus der Stadt und bekam zum Dank für diese Genugtuung von Heinrich IV. die Zollfreiheit gewährt – in Form der ersten Urkunde überhaupt, die für die Bewohner einer deutschen Stadt ausgestellt wurde!
Am 23. September 1122 endlich kam man, laut Ekkehard von Aura wegen der unendlich großen Zahl der Teilnehmer auf der Ebene Lobwisen, also auf freiem Feld am Rhein vor den Toren der Stadt zu Verhandlungen zusammen, die etwa eine Woche andauerten.3 Neben der Anwesenheit von fürstlichen und bischöflichen Zeugen hatte diese bewusst erweiterte Öffentlichkeit zum Zweck, den wechselseitigen Zusagen eine besondere Verbindlichkeit zu geben. Entscheidend war der feierliche Moment, als Kaiser Heinrich V. offiziell auf die kirchlichen Investituren verzichtete, sich um Christi willen vor einer beträchtlichen Menschenmenge demütigte,4 und dafür von den zahllos über ihn verhängten Exkommunikationen befreit wurde. Im Detail stellte sich das Konkordat, mit dem die bis dato unklaren Zuständigkeiten in eine verbindliche Form gebracht wurden, natürlich sehr viel ausführlicher dar: Es wurde festgelegt, dass die Wahl des Bischofs ausschließlich nach Kirchenrecht erfolgen durfte, wobei es dem König gestattet war, anwesend zu sein. Bedingung war allerdings die absolute Passivität dieser Präsenz, das heißt, jegliche Einflussnahme – sei es durch Bestechung oder Gewaltandrohung – war strikt verboten. Bei der Einsetzung sollte der König dann wieder Teil der Zeremonie sein: Von geistlicher Seite würde der neue Bischof den Hirtenstab und den Ring erhalten, als Zeichen seiner Verheiratung mit ecclesia, also mit der Kirche. Der König würde ihm daraufhin die weltlichen Lehen und Rechte, die regalia, verleihen und ihn damit zu seinem Vasallen machen. Unübersehbar machte das Konkordat vor allem, dass ohne die Fürsten des Reichs kein königlicher Alleingang mehr möglich war. Erst als die Fürsten, die in Worms nicht anwesend sein konnten, wenige Wochen später, im November 1122 auf dem Hoftag in Bamberg, um ihre Zustimmung gebeten worden waren, übersandte man das Henricianum nach Rom, wo das Abkommen auf dem Lateranskonzil im März 1123 ratifiziert wurde. Heinrich V. hätte die Übereinkunft zu gerne mit dem Papst persönlich auf den Weg gebracht und kündigte eine baldige Reise nach Rom an. Calixt II. verspürte aber wenig Neigung, dem Kaiser die Gelegenheit zu geben, womöglich erneut an den getroffenen Vereinbarungen zu rütteln, und wiegelte mit dem Hinweis auf seine angegriffene Gesundheit freundlich, aber bestimmt ab.
Erstaunlicherweise zeigte sich die kaiserliche Seite in letzter Konsequenz seltsam unbeeindruckt vom „Wormser Frieden“: Mit dem Original der Papsturkunde schien man recht nachlässig umgegangen zu sein – sie ging nämlich verloren –, und auch sonst war das Interesse an einer Verbreitung der Vertragstexte eher gering. Ganz anders die päpstliche Seite, die sich erkennbar bemühte, das Verhandlungsergebnis als ein Ereignis von epochaler Tragweite zu dokumentieren. In der eingangs erwähnten Camera pro secretis consiliis gönnte sich Papst Calixt II. aber nicht nur den gemalten Triumph über Kaiser Heinrich V. Es gab schließlich noch genug Wandfläche für die Darstellung einer erklecklichen Anzahl weiterer Widersacher, die er allesamt aus dem Feld geschlagen hatte: Wibert, Albert, Maginulf, Theoderich und Mauritius – seine fünf Gegenpäpste.