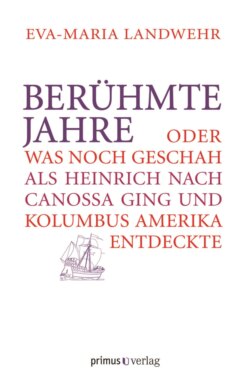Читать книгу Berühmte Jahre - Eva-Maria Landwehr - Страница 8
Ein Herzog muss bauen: Die Weihe der Abteikirche St. Étienne in Caen
ОглавлениеWas könnten der berüchtigte Londoner Tower, die ehrwürdige Westminster Abbey, die geschichtsträchtige Kathedrale von Canterbury und die Klosterkirche St. Étienne in Caen gemeinsam haben? Den Bauherrn, den Baumeister oder möglicherweise das Erbauungsjahr? Nein, alle diese Bauwerke wurden aus demselben Werkstoff errichtet, dem Pierre de Caen, einem hellockerfarbenen und leicht zu bearbeitenden Kalkstein aus der Region Caen in der Normandie. Für eine Klosterkirche an der französischen Kanalküste mag die Wahl eines solchen Materials ja einleuchten – warum aber Tonnen über Tonnen handbehauener Bausteine mühsam nach Südengland verschiffen, und das im 11. und 12. Jahrhundert? Die Antwort ist recht einfach: Weil es das Jahr 1066 gab. Das Jahr, in dem Herzog Wilhelm der Normandie den Thron von England eroberte und damit die Insel der Angelsachsen und den europäischen Kontinent mit einer unsichtbaren Brücke verband.
Die Normannen prägten das 11. Jahrhundert wie keine andere Völkergemeinschaft Europas – nicht nur in Frankreich und England, sondern ebenso in Unteritalien, Sizilien und im östlichen Mittelmeer. Gerade einmal einhundert Jahre lag es zurück, dass der norwegische Wikinger Rollo plündernd und brandschatzend durch Europa gezogen war, um schließlich im heutigen Frankreich mehr oder weniger friedlich und sesshaft zu werden. Ursächlich für den Beginn seiner ‚Sozialisierung‘ war paradoxerweise eine Niederlage: Im Zuge einer seiner zahlreichen Raubfahrten unterlag Rollo bei einer Schlacht in der Nähe von Chartres dem französischen König. Dieser war der ewigen Überfälle überdrüssig geworden und versuchte es nun mit der Taktik, die Wikinger durch die Schenkung von Land zu umwerben, anzusiedeln und damit als Widersacher auszuschalten. Rollo gefiel sich anfangs in seiner seriösen neuen Rolle als Lehnsmann und akzeptierte sogar die Taufe – doch die nordische Götterwelt und schlechte Gewohnheiten überhaupt ließen sich schwer ablegen. Wenige Jahrzehnte später zeigte die dünne Schicht von Zivilisation und Christentum bereits deutliche Risse und die verschiedenen Wikingerhorden fanden in Ermangelung ernst zu nehmender Gegner kein anderes Ventil, als sich mit großem Eifer gegenseitig umzubringen. Als Wikinger blieb man seiner ehemaligen Heimat weiterhin treu verbunden und pflegte alte Loyalitäten: Nach Raubzügen in England konnten sich die skandinavischen Verwandten stets darauf verlassen, jenseits des Kanals – in Frankreich also – mit offenen Armen aufgenommen zu werden. Dies war eindeutig ein diplomatischer Affront, gegen den die Engländer vehement, aber erfolglos protestierten.
In frühen Quellen werden die vom französischen König belehnten Nordmänner noch als Grafen, im 11. Jahrhundert dann schon als Herzöge bezeichnet. ‚Alten‘ Adel gab es ja keinen, die bestehenden Geschlechter und Häuser waren samt und sonders neu geschaffen worden, und nicht zuletzt waren eigentlich alle mit allen verwandt. Die neuen Herren machten ihre Sache gut, sodass sich die Normandie zu Beginn der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ökonomisch und politisch in hervorragender Verfassung präsentierte. Doch der Tatendurst des normannischen Adels, der ständig nach Eroberungen und noch mehr Landbesitz gierte, musste von einer starken Hand verwaltet werden. Dafür hatte der Herzog zu sorgen, und weil das benachbarte Eigentum der französischen Krone besser nicht angetastet wurde, richtete sich der begehrliche Blick auf die Insel jenseits des Kanals.
Zuerst jedoch war es dafür nötig, dass ein wahrer Eroberer das Licht der Welt erblickte. Wilhelms Zukunft schien zu Beginn wenig verheißungsvoll, denn seine Geburt im Jahr 1028 war mit einem entscheidenden Makel behaftet: Das Kind war ein Bastard. Sein Vater, Robert I., sechster Herzog der Normandie, bekannte sich zwar zu dem Sohn, den er mit Herlève, der Tochter eines Gerbers gezeugt hatte, doch ein aussichtsreicher Rang in der Thronfolge schien in höchstem Maße unwahrscheinlich. Noch im besten Mannesalter zog Robert dann aber eine Pilgerfahrt nach Jerusalem einer standesgemäßen Ehe und damit einem legitimen Erben vor. Er ließ nicht nur ein wenig stabiles Herzogtum, sondern auch seinen siebenjährigen Sohn schutzlos zurück – allerdings nicht ohne ihn vorher als seinen designierten Nachfolger präsentiert zu haben. Es kam, wie es kommen musste: Robert starb 1035 in Nicaea, als Pilger immerhin erfolgreich, da er sich bereits auf der Rückreise befand. Es grenzt an ein Wunder, dass das Kind Wilhelm angesichts der nun einsetzenden Machtkämpfe und der vielfach auf ihn verübten Attentate überhaupt das Erwachsenenalter erreichte. Die Vormundschaft des französischen Königs Heinrich I. bot einen gewissen Schutz für Leib und Leben, aber es musste schon bedenklich stimmen, dass die beiden nachfolgenden Beschützer des unmündigen Herzogs jeweils eines gewaltsamen Todes starben. Aus dem Kind wurde ein junger Mann, für den Aufruhr, kriegsähnliche Zustände und blutige Adelsfehden wie selbstverständlich zum täglichen Leben gehörten. Als sein Großcousin Guy de Brionne Anspruch auf den Herzogsthron erhob, kam es 1047 zur Schlacht von Val-ès-Dunes, die der gerade einmal neunzehnjährige Wilhelm nur denkbar knapp für sich entscheiden konnte. Frieden für das Land bedeutete dieser Sieg aber noch lange nicht, dafür sorgte das wilde und ruhelose Wikingererbe, quasi das Alter Ego des normannischen Adels. Zu Beginn der 1060er-Jahre hatte Wilhelm seine Herrschaft aber dennoch so weit gefestigt, dass er der Unternehmungslust der jungen und ihm loyal ergebenen Fürsten seiner Gefolgschaft ein neues militärisches Betätigungsfeld bieten konnte: England. Denn Adelige auf Beutezug waren sinnvoll beschäftigt und dadurch innenpolitisch weniger gefährlich.
Wilhelms Stunde kam, als Englands Thron im Januar 1066 vakant wurde. König Eduard der Bekenner, der als Cousin von Wilhelms Vater traditionell enge Verbindungen zur Normandie pflegte, starb ohne Erben. Der junge Herzog erhob Anspruch auf die Nachfolge, auch Norwegen meldete lebhaftes Interesse an, der aussichtsreichste Konkurrent aber war der Angelsachse Harold von Wessex. Diplomatisch optimal abgesichert – der französische König war unmündig, mit dem deutschen König Heinrich IV. wurde eine Art ‚Nichtangriffspakt‘ ausgehandelt, und der Papst liebäugelte mit einer Kirchenreform in England – begann Wilhelm mit den Vorbereitungen für die Invasion. Innerhalb weniger Monate vollbrachte er mit der Rekrutierung von siebentausend Soldaten und Söldnern und dem Bau von zahlreichen Schiffen für Mann und Pferd eine logistische Meisterleistung. Aber er war auch ein kühl agierender Taktiker, der auf den richtigen Moment zum Angriff warten konnte. Sofort nachdem gemeldet worden war, dass der norwegische Versuch der Machtübernahme gescheitert war, setzte Wilhelm die Segel und landete Ende September in England. Harold musste überstürzt nach Süden marschieren, um dort mit seinen erschöpften Truppen auf bestens vorbereitete Normannen zu treffen, die sich in schnell errichteten Befestigungsanlagen verschanzt hatten. Am 14. Oktober 1066 trafen die beiden Heere bei Hastings aufeinander, und obwohl sich Harolds Männer tapfer geschlagen haben sollen, mussten sie sich am Ende des Tages der normannischen Überlegenheit beugen. Der englische Adel und die Stadt London unterwarfen sich wenig später, sodass Wilhelm bereits an Weihnachten 1066 in der alten Westminster Abbey zum König gekrönt werden konnte.
Elf Jahre später, am 13. September 1077, wurde, begleitet von feierlichen Gesängen und verfolgt von den Augen zahlreicher illustrer Gäste, ein Behältnis durch das von vielen Kerzen erleuchtete und von Weihrauchschwaden vernebelte Langhaus der Klosterkirche St. Étienne in Caen zum Altar getragen. Herzog Wilhelm hatte für die Weihe der neu erbauten, von ihm gestifteten Klosterkirche den größtmöglichen Prunk angeordnet: Der Erzbischof von Rouen, Jean d’Avranches, der die Zeremonie leitete, war mit seinem ganzen Kapitel angereist, dazu gesellten sich eine große Zahl von Äbten aus allen Regionen des Landes und natürlich die wichtigsten Vertreter des normannischen Hochadels. Vor dem Einzug in den über hundert Meter langen Bau hatte die Festgemeinde bereits ehrfürchtig vor der hoch aufragenden Fassade gestanden und die mächtigen Doppeltürme bewundert, für die man unerhört tiefe Fundamentgruben hatte ausheben müssen. Die breite, fast quadratische Fassade ist noch heute von einer wehrhaften, ornamentlosen Schlichtheit, die diese neue Kirche im Jahr 1077 zu einer wahren Burg Gottes machte. Die Menge hatte sich nur langsam durch das Hauptportal in den dämmrigen Innenraum geschoben. Man hatte die von einem Rundbogen überwölbte Pforte bewusst klein gehalten, weil Laien die Klosterkirche ohnehin nur an besonderen Festtagen betreten durften. Die einschüchternde Strenge des Äußeren war bloß ein Vorgeschmack auf die sachliche Eleganz des Kirchenschiffs, in dem kühn gewölbte Rundbogenarkaden zwei Stockwerke hoch übereinander aufragten, zusammengefasst von schmalen Halbsäulen, deren Abschlüsse sich im Dunkel der flachen Holzdecke fast verloren. Die nüchterne, aber intensiv empfundene normannische Religiosität kam mit wenig Bauschmuck aus, am prächtigsten waren noch die Kapitelle mit ihren einfachen Blattmotiven.
Das geheimnisvolle Behältnis, von dem die Rede war, barg das wohl Wertvollste, das man einer Kirche, die den Namen eines Erzmärtyrers trug, zum Geschenk machen konnte: dessen Reliquien. Reliquienkult und Reliquienhandel im Mittelalter, das bedeutete nicht mehr und nicht weniger als die geschäftsmäßige Ausbeutung von angeblichen Heiligenkörpern. Galt vor der Jahrtausendwende die Bewahrung des unversehrten Leichnams als höchstes Ziel, wurden später jeder Blutstropfen und jeder Knochen, jedes Haar und jeder Fingernagel, ja selbst Gegenstände aus dem Dunstkreis des Heiligen, einer neuen Bestimmung zugeführt: der religiösen Verehrung. Problematisch war aber auch damals schon die Frage nach der Echtheit der verehrten Objekte. Zwar gab es Ganzkörperreliquien, die in ihrer Einmaligkeit über jeden Zweifel erhaben waren, doch würde man heute versuchen, die verstreuten Relikte eines einzelnen Heiligen zusammenzusetzen, so sähe man sich am Ende wohl mehr als einem Doppelgänger gegenüber. Bereits im 12. Jahrhundert sollte man einen Widerspruch darin erkennen, dass gleich zwei Kirchen überzeugt davon waren, das echte Haupt Johannes des Täufers zu beherbergen. Was also tun, wenn man vielleicht einer Fälschung aufgesessen war? Ausschlaggebend, so die Kirche, war die ehrliche und reine Absicht, die hinter der Verehrung stand – um den Rest würde sich Gott kümmern. Bei aller Ehrfurcht wusste man durchaus eine nüchterne Unterscheidung zwischen Reliquien erster, zweiter und dritter Klasse zu treffen. Während Objekte der ersten Kategorie dem biologischen Körper des Heiligen entstammten, waren die Reliquien zweiter Klasse zumindest von diesem berührt worden. Die drittbesten Stücke schließlich waren wenigstens mit Reliquien der zweiten Wahl in Kontakt gekommen. So staffelten sich auch die Preise, die für den Erwerb dieser Kostbarkeiten angesetzt wurden. Je nach Geldbeutel konnte also jedes Gotteshaus, von der Kathedrale bis zur Dorfkirche, mit Reliquien ausgestattet werden, die Heilung oder Wundertaten verhießen.
Der heilige Stephanus, französisch Étienne, dessen Fest am 26. Dezember gefeiert wird, gilt als der erste Märtyrer überhaupt. Er wurde noch von den Aposteln durch Handauflegen zum Diakon geweiht und erwies sich in der Folgezeit als begnadeter Redner und Prediger. Der Zulauf, der aus dieser Eloquenz resultierte, wurde ihm wohl zum Verhängnis, denn man klagte ihn letztendlich der Gotteslästerung an und steinigte ihn zu Tode. Aber sein Leichnam sollte nicht so bald zur Ruhe kommen: Verscharrt auf einem Acker in Palästina, wurden seine sterblichen Überreste dort auf wundersame Weise aufgespürt und in die Jerusalemer Zionskirche verbracht. Aufgrund einer Verwechslung trat der heilige Stephanus in seinem Sarkophag eine wahre Odyssee über Konstantinopel nach Rom an. Doch der Sarg gab keine Ruhe, wie es hieß, bis der energische Heilige in San Paolo fuori le mura neben dem heiligen Laurentius zu liegen kam, der – ganz der höfliche Spanier – in seinem Sarkophag ein Stückchen zur Seite gerückt sein soll. 3
Ein Herzog und König ließ sich, was die Güte von Reliquien betraf, selbstverständlich nicht lumpen: Wilhelm der Bastard, dessen unrühmlicher Beiname spätestens im Jahr 1066 durch den weit klangvolleren Zusatz „der Eroberer“ verdrängt worden war, konnte nicht nur mit einem Teil des Oberarmknochens, Haaren und Blut des ersten Märtyrers aufwarten. Er hatte von der Stadt Besançon darüber hinaus auch noch einen der Steine erwerben können, die den bedauernswerten Stephanus seinerzeit in den Märtyrerhimmel befördert hatten.
In der Nacht vor der Weihe hatte man in einem eigens vor der Kirche errichteten Zelt bei den Reliquien gewacht und gebetet. Vor dem Einzug in die Kirche am folgenden Tag hatte der Bischof die Kirche mit Weihwasser gesegnet, den Bau dreimal umrundet und dabei am Portal um Einlass gebeten – eine rituelle Bitte, die ihm beim letzten Versuch programmgemäß auch gewährt wurde. Die nun folgende komplizierte Zeremonie spielte sich der Überlieferung nach folgendermaßen ab: Bischof Jean d’Avranches legte sich vor dem Altar zum demütigen Gebet auf den Boden, um dann mit dem Bischofsstab das lateinische und griechische Alphabet quer, das heißt X-förmig, durch die Kirche zu schreiben. Mit einem Gemisch aus Salz, Asche und Wein besprengte er den Altar und die Innenwände der Kirche. Der Altar, auf dem Weihrauch verbrannt wurde, und die Kirchenwände wurden von ihm mit verschiedenen heiligen Ölen gesalbt. Erst dann holte man die Reliquien aus dem Zelt, um sie in die Kirche zu überführen. In die Reliquienmulde, die man in den Altartisch eingelassen hatte, wurden drei geweihte Hostien und drei Weihrauchkörner gelegt. Nach der Absenkung der Reliquien wurde das Weihegebet gesprochen und das Reliquiengrab für immer verschlossen.
Doch nicht nur die Kirche wurde beschenkt, auch das Kloster selbst wurde mit üppigen Stiftungen bedacht und dadurch in kürzester Zeit an die Spitze der wohlhabendsten Kirchengüter der Normandie, wenn nicht ganz Frankreichs katapultiert. Diese Wohltaten, für deren Anhäufung andere Klöster Jahrhunderte brauchten, stammten zu einem Gutteil aus den Händen derjenigen normannischen Barone, die nach der Eroberung Englands dort mit großen Ländereien belehnt worden waren. St. Étienne wurde mit Wäldern, Mühlen und Ackerland überhäuft, es wurde aber auch von Wegezöllen und Steuern befreit und konnte darüber hinaus einen Teil der Londoner Innenstadt sein Eigen nennen.
Für die Stadt Caen hatte in diesen Jahren ein ganz neues Zeitalter begonnen. Im 10. Jahrhundert noch inmitten einer Art kulturellem Niemandsland gelegen, sind dort für die Dreißigerjahre des 11. Jahrhunderts bereits Kirchen, Weinberge, Mühlen, Markt- und Mautrecht sowie ein Hafen bezeugt. Zwanzig Jahre später weckte Wilhelm der Eroberer dann die Ansiedlung am Ufer des Flusses Orne aus ihrem Dornröschenschlaf und baute sie nach und nach zur zweiten, durch eine Festung geschützten Hauptstadt neben Rouen aus. 1063 begann man dann auch an der Straße, die nach Bayeux führte, mit dem Bau von St. Étienne – vier Jahre nachdem man den Grundstein für ein Nonnenkloster gelegt hatte, das der Sainte-Trinité, der Heiligen Dreifaltigkeit, geweiht und das ebenfalls mit Geldern aus der herzoglichen Schatulle erbaut worden war! Zwei Klöster also in einer kleinen Stadt mit kaum mehr als zwei- bis fünftausend Einwohnern? Warum diese fast schon übertriebene Großzügigkeit? Nun, bereits im 10. Jahrhundert hatten sich die Herzöge der Normandie für die Wiederbelebung der nach den Wikingereinfällen zerstörten Klosterlandschaft eingesetzt. Es war zu zahlreichen Restaurierungen und Neugründungen gekommen und die normannischen Bistümer konnten zur Jahrtausendwende als vollständig funktionstüchtig gelten. Die ehemaligen Wikinger waren von Zerstörern zu Bauherren geworden – dies war die Situation, die Wilhelm bei seinem Amtsantritt vorfand. Und auch er blieb nicht untätig: Unter seiner Herrschaft wurden nicht nur zahlreiche Klöster gegründet, sondern auch die Kathedralen von Bayeux und Coutances erneuert. Wilhelm setzte sich vor allem für das Kloster Le Bec ein, in das sich der brillante lombardische Theologe Lanfranc nach einer Glaubenskrise zurückgezogen hatte und das sich unter dessen Leitung zu einem bildungspolitischen Zentrum entwickelte. Doch warum entfaltete der Herzog nun mit einem Mal diese beeindruckende Bautätigkeit an einem spirituell unbedeutenden Ort wie Caen, das weder Pilgerstätte noch Bischofssitz war, sondern wenig mehr als ein überschaubarer regionaler Handelsplatz?
Die Antwort ist in der Heirat Wilhelms mit Mathilde, der Tochter Graf Balduins V. von Flandern, zu suchen. Geplant war diese Verbindung zwischen der Normandie und dem konkurrierenden Anrainer an der Nordsee bereits im Jahr 1049, doch Papst Leo IX. verweigerte im selben Jahr auf dem Konzil in Reims seine Zustimmung. Ob es am zu nahen Verwandtschaftsgrad lag – was sehr unwahrscheinlich klingt, da die Brautleute gerade mal Cousin und Cousine fünften Grades waren – oder sich das politische Gleichgewicht in Westeuropa ungünstig zu verschieben drohte, darüber lässt sich nur spekulieren. Denn ungeachtet des päpstlichen Verbots fand die Hochzeit um das Jahr 1052 statt – worauf das junge herzogliche Paar umgehend mit dem Kirchenbann belegt wurde. Von dieser belastenden Hypothek scheinbar wenig beeindruckt, sollen Wilhelm und Mathilde eine, wie man es heute bezeichnen würde, durchaus glückliche Ehe ‚ohne Skandale‘ geführt haben, aus der immerhin neun Kinder hervorgingen. Die Überlieferung, dass Mathildes anfängliche Sprödigkeit durch eine furchtlos-autoritäre Geste Wilhelms gebrochen worden wäre, kann getrost ins Reich der Legende von ‚Der Widerspenstigen Zähmung‘ verbannt werden. In jedem Fall waren beide bereit, das Stigma der nicht sanktionierten Ehe auf sich zu nehmen, bis nach etwa sechs oder sieben Jahren, im Jahr 1059, die Heirat durch Papst Nikolaus II. anerkannt wurde. Für diesen Dispens verlangte der Papst vom herzoglichen Paar aber eine finanziell durchaus schmerzhafte Gegenleistung, nämlich die Errichtung von gleich zwei Klosterkirchen für den Benediktinerorden: Wilhelm hatte für die Mönche zu bauen, Mathilde für die Nonnen.
Wenn hochgestellte Persönlichkeiten vor tausend Jahren etwas zu büßen hatten, taten sie das nicht selten durch großzügige Stiftungen oder Bauten zur Ehre Gottes. Man investierte damit nicht nur in die eigene künftige himmlische Bequemlichkeit, sondern bemühte sich oft auch um die Erlösung von ausgesprochen irdischen Nöten – so zum Beispiel Exkommunizierungen –, deren Aufhebung eine hohe Dringlichkeit im Diesseits hatte. Die Planung und Errichtung einer Kirche wurde im Mittelalter mit der Erschaffung der Welt und des Kosmos gleichgesetzt und galt deshalb als Bußleistung erster Güte. Dieser ‚Genesis‘-Idee lag auch die Vorstellung zugrunde, dass die Kirche als Institution bis zum Jüngsten Tag eine permanente Baustelle sein würde. Nichtsdestoweniger wurden viele große Kirchen erstaunlich zügig errichtet – St. Étienne in Caen gehört mit einer Bauzeit von etwa siebzehn Jahren dazu. Knapp zwanzig Jahre zuvor war zum Beispiel auch die Klosterkirche Saint-Rémi in Reims nach einer Bauzeit von achtzehn Jahren geweiht worden, wie ein Mönch namens Anselm als Augenzeuge berichtete.4 Für St. Étienne fehlen leider aussagefähige Quellen zum Baubetrieb, als magister operis oder auch architectus, also als oberste Bauaufsicht, ist aber unzweifelhaft jener Lanfranc zu identifizieren, der sich in seiner Verantwortung für das Kloster Le Bec das Vertrauen und die Freundschaft Wilhelms des Eroberers erworben hatte. Lanfranc hatte wohl schon im Vorfeld einige Mühe mit den Verträgen für die Grundstücke, die für den Bau der Kirche, der Klostergebäude und der weitläufigen Gärten gebraucht wurden. Er musste sich aber auch um die Anstellung der zahlreichen Handwerker und die Anschaffung von Materialien einschließlich ihres Transports kümmern.
Grundlage aller nachfolgenden Bauarbeiten war ein korrekter Grundriss, dem man sich mit dem Lot und dem Zirkel näherte. ‚Nur‘ genau war nicht genau genug: Bischof Oswald von York zum Beispiel hatte um das Jahr 1000 Fachleute anwerben wollen, die mit gerader Geradlinigkeit die Lage der Fundamente des Klosters in Ramsay festlegen sollten.5 Eine solche Exaktheit hätte man sich wohl auch fünfundzwanzig Jahre später beim Baubeginn des Speyrer Doms gewünscht, wo ein früher Messfehler dazu führte, dass auch nach zahlreichen Korrekturen an keiner Stelle ein wirklich rechter Winkel entstehen wollte. Nach der Fundamentierung wurde meist mit dem Bau des Chors oder der Krypta, der Unterkirche, manchmal auch des Querschiffs und der Vierung begonnen, damit in diesen Abschnitten bereits Gottesdienste gefeiert werden konnten. Die Arbeiten am Langhaus, am Westwerk und an den Türmen wurden parallel dazu noch über viele Jahre fortgesetzt.
Caen hatte den unschätzbaren Vorteil, einen geeigneten Steinbruch, in dem der bereits erwähnte Pierre de Caen abgebaut wurde, in unmittelbarer Nähe zu haben. Die Steinbrecher dort waren die Nachtschattengewächse des mittelalterlichen Baubetriebs, die niemals in Erscheinung traten und selten überhaupt erwähnt wurden. Und das, obwohl ihre Tätigkeit zu den wichtigsten überhaupt zählte. Für die Arbeit im Berg, wo Schichten und Lagen erspürt werden mussten, war Intuition und Achtsamkeit notwendig – was man dafür bekam, waren ein schlechter Lohn und eine Staublunge. Unvorstellbar groß war die Anzahl der Steine, die in einem solchen Bauwerk wie St. Étienne vermauert wurden. Zweihundert Jahre später wurden – unter etwa gleichen Bedingungen – für den Bau einer englischen Zisterzienserabtei innerhalb von drei Jahren 35.000 Ochsenkarren mit Steinen über eine Distanz von acht Kilometern zur Baustelle transportiert, was eine Vorstellung davon geben mag, welche Herkulesarbeit hinter Bauwerken wie diesen steht. Der Baubetrieb in Caen wird angesichts der internationalen Besetzung der jeweiligen Handwerke einem babylonischen Sprachgewirr nicht unähnlich gewesen sein: Man weiß von anderen Baustellen, auf denen gleichzeitig Maurer, Steinmetze, Zimmerleute, Schmiede, Dachdecker, Seiler, Glaser und Mörtelmacher aus Sachsen, Ungarn, Polen, Österreich, Frankreich und den Niederlanden beschäftigt waren. Viele waren es in jedem Fall, die, meist für einige Jahre, auch untergebracht und verpflegt werden wollten. Rechnungsbücher der Westminster Abbey für das Jahr 1253 zeigen, dass – mit starken Schwankungen innerhalb des einen oder anderen Gewerks – vor allem im Sommer teilweise über vierhundert Fach- und Hilfsarbeiter gleichzeitig am Bau eingesetzt wurden.
Wilhelm der Eroberer bestimmte die Klosterkirche St. Étienne zu seiner Grablege. Er starb, fast genau zehn Jahre nach der Weihe seines Stiftungsbaus, am 9. September 1087 während eines wenig bedeutsamen Feldzugs. Er war vom Pferd gefallen und hatte sich dabei wohl die inneren Verletzungen zugezogen, die Tage später zu seinem qualvollen Tod führen sollten. Sein schon stark verwester Leib war der Überlieferung nach bei der Bestattung aufgebrochen und hatte einen so betäubenden Gestank verbreitet, dass auch die hartgesottensten unter den Trauergästen die Flucht ergriffen haben sollen. Der Nachwelt wird Wilhelm trotzdem als der hochgewachsene Ritter und Eroberer auf seinem schwarzen Schlachtross in Erinnerung bleiben, als der er auf dem berühmten Teppich von Bayeux verewigt wurde.