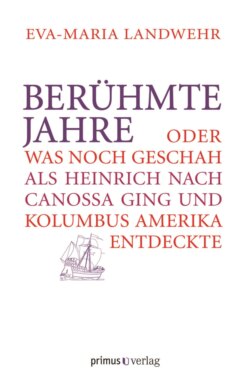Читать книгу Berühmte Jahre - Eva-Maria Landwehr - Страница 11
Die Frau an ‚seiner‘ Seite: Königin Mathilde stellt in Utrecht eine Urkunde aus
ОглавлениеEs war einmal ein kleines Mädchen, das im zarten Alter von acht Jahren seine Eltern und sein Land verließ, mit zwölf Jahren einen König zum Mann nahm und mit dreiundzwanzig Jahren die Witwe eines Kaisers war. Die kindliche Prinzessin, in deren Adern normannisches und schottisches Blut floss, hieß Mathilde. Mathilde war die Tochter König Heinrichs I. von England und damit die Enkelin von Wilhelm dem Eroberer. Sie lebte elf Jahre an der Seite des deutschen Königs Heinrich V. – als Gemahlin, Königin und Mitregentin.
Der Schauplatz der folgenden Geschichte wiederum war die Stadt Utrecht, die im 12. Jahrhundert zum Herzogtum Niederlothringen gehörte und am äußersten Saum des deutschen Reichs in den nördlichen Rheinlanden lag. Das Herzogtum, ein königliches Lehen, war in der Zeit der Karolinger begründet worden und erstreckte sich auf den größten Teil der heutigen Niederlande und Belgiens. Die geistliche Herrschaft teilten sich in diesem Territorium die Bischöfe von Utrecht und Lüttich, aber auch der lange Arm des mächtigen Erzbistums Köln reichte bis zur Peripherie des Reiches. Die deutschen Könige hatten in diesen, von den traditionellen Schaltzentralen des mittelalterlichen Deutschlands viele Tagesreisen entfernten Gefilden jedoch wenig spürbaren Einfluss – kaum weiter jedenfalls, als über die Staatsgrenzen des heutigen Deutschlands hinaus. Physische Präsenz vor Ort, das mussten die Salier bald erkennen, war also das einzig wirksame Mittel, in den abgelegenen Reichsteilen ihre Interessen zu vertreten und auch zu behaupten. Zielstrebig und kontinuierlich arbeitete sich deshalb das Königtum nach Nordwesten vor, der Ort der Königskrönung wurde von Mainz nach Aachen verlegt, man errichtete neue Pfalzen oder baute bestehende Residenzen aus. So war zum Beispiel allgemein bekannt, dass Konrad II. die Pfalz Nimwegen bevorzugte und dort im Jahr 1036 sogar die Hochzeit seines Sohnes Heinrich mit der dänischen Königstochter Gunhild feiern ließ. Dieser folgte dem Beispiel seines Vaters und verbrachte als Heinrich III. in seinen ersten Amtsjahren viel Zeit in Aachen, Maastricht, Lüttich, Nimwegen und Köln. Streitigkeiten mit dem Herzogtum Lothringen führten dazu, dass er sich vorübergehend nach Südosten zurückzog und in den Fünfzigerjähren des 11. Jahrhunderts der Pfalz Kaiserswerth bei Düsseldorf den Vorzug gab. Unter Heinrich IV. war der Nordwesten politisch so weit befriedet und geordnet, dass sich der Kaiser dorthin zurückziehen konnte, nachdem er von seinem Sohn, dem späteren Heinrich V., abgesetzt worden war. Die Loyalität der nördlichen Rheinlande gegenüber dem alten Herrscher machte es seinem Nachfolger unmöglich, selbst am Niederrhein Fuß zu fassen und eigene Akzente zu setzen. Der Investiturstreit war in vollem Gange, und mit seinem dominanten und anmaßenden Auftreten anlässlich seiner Kaiserkrönung in Rom machte sich Heinrich V. im Klerus viele Feinde. Nachdem es ihm ‚gelungen‘ war, innerhalb von drei Jahren gleich zweimal exkommuniziert zu werden, wurden während der Amtszeit des neuen Papstes Calixt II. versöhnliche Töne angeschlagen. Heinrich V. nutzte die entspannte Atmosphäre, um im Jahr 1119 einen erneuten Vorstoß in den westlichsten Teil seines Reiches vorzunehmen, musste aber von dem Plan ablassen, das vakant gewordene Bistum Lüttich mit seinem Wunschkandidaten zu besetzen.
Während eines drei- bis viermonatigen Aufenthalts des Kaisers und seiner Frau Mathilde von März bis Juni 1122 in Lothringen profitierte vor allem Utrecht davon, dass die aufblühenden Städte des hohen Mittelalters sowohl für die geistlichen als auch für die weltlichen Fürsten zu herrschaftsrelevanten Größen geworden waren. Das Bürgertum stellte eine neue, stetig an Einfluss gewinnende Partei im politischen Gefüge des 12. Jahrhunderts dar und wurde, weil es in Krisenzeiten das gern zitierte Zünglein an der Waage sein konnte, von beiden Kräften umworben. Dieser Entwicklung vorausgegangen waren die Folgen der drei wohl bekanntesten Tage im Januar des Jahres 1076: ‚Canossa‘ hatte dem Papsttum einen enormen Autoritätszuwachs beschert und auch die Bischöfe profitierten von der Demütigung Heinrichs IV., weil sie im Wettkampf um die Gunst des Stadtvolkes einen nicht unerheblichen Handlungsvorsprung hatten: Bereits im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts war die Neuorganisation der Bistümer eingeleitet worden. Durch die Einführung bischöflicher Thronsiegel und die Prägung eigener Münzen war ein neues, selbstbewussteres Machtverständnis gewachsen. Vor allem aber residierten Bischöfe permanent in ‚ihrer‘ Stadt, hatten ein offenes Ohr für aufkeimende Misstöne und konnten murrendes Volk im Ernstfall durch Privilegien und Zugeständnisse besänftigen. Der umherziehende König war damit konfrontiert, einem Ort immer nur für kurze Zeit seinen Stempel aufdrücken und bleibenden Eindruck hinterlassen zu können – der Bischof musste nur geduldig die unvermeidliche Abreise des Herrschers abwarten, um wieder weitgehend unbehelligt schalten und walten zu können. Nach diesem machtpolitischen Aderlass sah sich das Königtum in der Folgezeit gezwungen, auf die gefährlichen, neu entstehenden Koalitionen zwischen Klerus und Stadt zu reagieren. Ein probates Mittel der Revanche war für salische Herrscher eine Art ‚Ernennungs-Stopp‘ für Bischöfe, das heißt, sie verweigerten in strategisch wichtigen Städten wie Mainz oder Worms über mehrere Jahre hinweg ihre Zustimmung für die Besetzung der vakant gewordenen Bischofsämter. Eine solche Blockadepolitik konnte aber unmöglich über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden. Deshalb orientierten sich die Salier an der Strategie der Geistlichkeit und betrieben mit den ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten die Förderung des Städtewesens – ein utilitaristisches Vorgehen unter rein herrschaftsrelevanten Aspekten. Man verlieh also nach Kräften Privilegien, investierte in Befestigungsanlagen, adelte Ansiedlungen durch die Errichtung von Pfalzen und belebte absichtsvoll die Konkurrenz bei Hofe durch die Indienstnahme von Kaufleuten und Ministerialen – was die bis dato monopolisierte Vertrauensstellung des Klerus ins Wanken brachte. Eine Sonderstellung unter den Städten hatte Speyer, wo das salische Kaiserhaus mit dem Domneubau und der Einrichtung einer dynastischen Grablege intensiv an seiner familiären Memorialkultur arbeitete.
Ob Utrecht im 12. Jahrhundert ein lebenswerter Ort war, kann man aus heutiger Sicht schwerlich beurteilen. Als deutscher König aus dem Geschlecht der Salier jedoch war man gut beraten, dieser Stadt im Frühjahr keinen Besuch abzustatten: Nicht genug, dass Heinrich IV. dort an Ostern des Jahres 1076 von seiner ersten Exkommunikation durch Papst Gregor VII. erfuhr. Nein, Utrecht im Frühling schien vor allem dem leiblichen Wohl salischer Herrscher wenig zuträglich, wobei sich das Pfingstfest als besonders ungesund erwies: Konrad II. war dort am Pfingstmontag des Jahres 1039 gestorben – und Heinrich V. sollte es am 23. Mai 1125 nicht viel besser ergehen. Er erlag im Alter von neununddreißig Jahren einem Krebsleiden und hinterließ eine blutjunge Witwe und ein Reich ohne Erben.
Ohne Zweifel aber war Utrecht eine große Zukunft beschieden, galt es doch neben Lüttich und Verdun als Aspirantin für den illustren Kreis der bedeutendsten hochmittelalterlichen Städte im Reich, zu denen außer Köln auch Mainz, Trier, Metz und Regensburg zählten. Bereits Mitte des 12. Jahrhunderts verfügte die ‚Aufsteigerin‘ über eine 131 Hektar umfassende Stadtmauer! Dass sich Utrecht mit der nach Köln zweitgrößten Befestigungsanlage im Reich brüsten konnte, verdankte die Stadt einerseits ihrer Lage an der Westgrenze des Reichs, andererseits der Machtpolitik im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts: Diese bot ein anschauliches Beispiel dafür, wie weltliche und geistliche Herren in dieser Zeit um die Gunst einflussreicher städtischer Schichten gebuhlt haben: Unstimmigkeiten zwischen Bischof Godebold und Utrechter Kaufleuten gaben dem Kaiser die Gelegenheit, sich die Stadt zur Verbündeten zu machen. Der Bischof hatte nämlich selbstherrlich beschlossen, den sogenannten „Krummen Rhein“ südöstlich der Stadt durch einen Damm abzuriegeln, um das moorige Land trockenlegen und landwirtschaftlich nutzen zu können. Indem er einen schiffbaren, für den florierenden Handel mit Weinen von Rhein und Mosel eminent wichtigen Flussarm trockenlegte, grub er den Utrechter Kaufleuten im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser ab. In dieser Situation konnte sich Heinrich V. als Fürsprecher der Bürgerschaft profilieren und gleichzeitig den Bischof demonstrativ auf seinen nachgeordneten Platz verweisen: Am 2. Juni 1122 stellte der Kaiser eine Urkunde aus, in der er den Utrechtern ihre von Bischof Godebald verliehenen Rechte bestätigte und im Gegenzug beständige Treue zu Krone und Reich forderte. Darüber hinaus lockte Heinrich V. mit der Befreiung von Handelszöllen für alle diejenigen Utrechter Kaufleute, die sich am Bau der Stadtbefestigung beteiligten. Die aufgebrachten Händler erhielten zudem das Recht, an anderer Stelle einen neuen Kanal zu graben, über den sie ihre Handelsroute sichern konnten. Interessanterweise unterzeichneten diese Urkunde auch sieben sogenannte Jerosolimitani, also „Jerusalemer“, die möglicherweise dem erst einige Jahrzehnte zuvor in Jerusalem zur Versorgung von erkrankten Pilgern gegründeten Johanniterorden angehörten. Ihre Anwesenheit und ihr Zeugnis waren nötig, weil die im Bau befindliche Stadtmauer ihr Konventsgelände durchqueren würde.
Neben Heinrich V. trat aber auch seine Gemahlin Mathilde als regierende Akteurin in Erscheinung, indem sie als Machteldis dei gracia Romanorum regina in Utrecht am 14. Mai 1122 in einer Urkunde verfügte, dass das Sumpfgebiet namens Oestbroeck sowie das angrenzende Gelände, das sogenannte „Venn“, mit der Steuer, dem Zehnten und der Gerichtsbarkeit in den Besitz des von ritterlichen Konversen (Laienbrüdern) in Oestbroeck neu gegründeten Klosters übergehen solle.5 Hier begegnet uns also eine Königin des Mittelalters, die unabhängig von ihrem Gemahl und trotz dessen Präsenz vor Ort das Recht hatte, in ihrem eigenen Namen juristische Verfügungen zu erlassen – und die dafür das erste nachweisbare, mit ihrem Namen personalisierte Siegel einer römisch-deutschen Königin einsetzte!
Was weiß man eigentlich über diese Prinzessin von der nebligen Insel? Ihr Geburtsdatum ist nicht bekannt, die Annalen von Winchester erzählen aber mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail, dass sie am 22. Februar 1110 im Alter von acht Jahren und fünfzehn Tagen die Reise über den Kanal zu ihrem Bräutigam angetreten habe. Zwei Jahre hatten da die Deutschen bereits wegen der Heirat verhandelt, auch wenn der dreiundzwanzigjährige Bräutigam in spe keine ausdrückliche Leidenschaft fürs Heiraten erkennen ließ. Ihre üppige Mitgift machte die kindliche Braut jedoch unwiderstehlich, vor allem, da Heinrich V. unmittelbar nach der Krönung seiner künftigen Frau am 25. Juli 1110 in Mainz über die vereinbarte Summe verfügen konnte. Dieses Zeremoniell war als Heiratsgarantie unverzichtbar, denn an die Schließung und den Vollzug der Ehe war angesichts des Alters der Prinzessin noch lange nicht zu denken. Die Mitgift, dem englischen Volk durch Sonderabgaben abgepresst, wurde im gleichen Jahr in Heinrichs Italienzug investiert, der ihm die Kaiserkrönung bringen sollte. Der englische König wiederum, dem durch Wilhelm den Eroberer noch immer das Stigma der Illegitimität anhaftete, tauschte sein Geld gegen die statusverbessernde Einheirat in ein altes Herrschergeschlecht. In den folgenden zwei Jahren wurde Mathilde am Hof Bischof Brunos von Trier auf ihr künftiges Dasein als Königin vorbereitet und am 7. Januar 1114 fand endlich in Mainz die Eheschließung der Zwölfjährigen mit dem sechzehn Jahre älteren Kaiser statt. Die mit großem Luxus und zahlreichen illustren Gästen – ein unbekannter Chronist berichtet von allein fünf Erzbischöfen, dreißig Bischöfen und fünf Herzögen – begangenen Feierlichkeiten legte Heinrich V. bewusst auf den Tag nach Heilige Drei Könige, um sich auf diese Weise in die Tradition der ersten, von Christus selbst eingesetzten christlichen Könige zu stellen.
Bereits anlässlich des zweiten Italienzugs Heinrichs V., den dieser ab 1116 unternahm, um das Erbe der Markgräfin Mathilde von Tuszien anzutreten, konnte die fünfzehnjährige ‚Teenager-Königin‘ ihre ungewöhnliche Reife, ihre Intelligenz und ihre vielversprechenden Führungsqualitäten unter Beweis stellen. Heinrich V. war es nicht gelungen, in Rom eine Lösung des Investiturstreits herbeizuführen, und so drohten ihm die deutschen Fürsten mit seiner Absetzung. Als er im Herbst 1118 deswegen überstürzt nach Deutschland aufbrach, legte er die italienischen Amtsgeschäfte allein in Mathildes Hände. Das junge Mädchen war nun ein Jahr lang Stellvertreterin des Kaisers, führte souverän den Vorsitz bei Gericht, stellte Urkunden aus und übernahm mit einer bewundernswerten Selbstverständlichkeit auch die Oberaufsicht über das kaiserliche Heer, das in Italien zurückgeblieben war. Diese Eigenverantwortlichkeit war zeitlich begrenzt und der aktuellen Notlage geschuldet, dafür aber in vollem Umfang und uneingeschränkt gültig. Nach dieser Trennungsphase unternahmen Heinrich und Mathilde in den Jahren von 1120 bis 1122 vor allem gemeinsame Reisen in den Westen und Nordwesten des Reichs. Aber nur noch drei Jahre sollte Mathilde deutsche Königin sein, Jahre, die sie bis zum Tod Heinrichs V. im Mai 1125 in Utrecht fast ausschließlich an dessen Seite verbrachte.
Schmückendes Beiwerk und Gebärerin legitimer männlicher Erben: Reduzierte man die Existenz einer Königin im 11. und 12. Jahrhundert auf diese Aufgaben, dann hätte man die Vielschichtigkeit ihrer Bedeutung kaum erfasst. Eine notwendige Gefährtin sollte sie sein, so hatte der Chronist Wipo6 im Jahr 1024 die Rolle einer deutschen Königin definiert – und ihr damit eine gewisse Unverzichtbarkeit bescheinigt. Die Auswahl einer königlichen Gemahlin erfolgte selbstverständlich nicht nach Neigung, sondern ausschließlich nach sorgfältiger Abwägung dynastischer, imperialer und auch finanzieller Aspekte. Der ‚Wert‘ einer künftigen Königin erschloss sich sowohl über ihre Herkunft als auch über die Größe ihrer sogenannten Dotierung, das heißt den Umfang der Güter, die sie im Zuge der Eheschließung von ihrem Mann als Brautgabe und zugleich als Altersversorgung bekam. Regierende Könige erwiesen sich in diesem Zusammenhang meist freigiebiger als Thronanwärter, die Ottonen waren spendabler als die Salier: Während zum Beispiel Adelheid, die Frau Ottos I., mit großen Besitzungen bedacht wurden, erhielt Gisela, Gemahlin Konrads II., eine vergleichsweise bescheidene Ausstattung. Mathilde, die in erster Linie ihrer stattlichen Mitgift wegen geheiratet worden war, musste bei der Rückkehr in ihre Heimat England im Jahr 1126 allen Landbesitz zurücklassen. Mit völlig leeren Händen ging sie dennoch nicht, denn im Gepäck hatte sie zwei Kronen – von denen später eine bei der Krönung Heinrichs II. von England gute Dienste leisten sollte – sowie das als „Hand des Apostels Jakobus“ bezeichnete Reliquiar aus dem deutschen Reichsschatz. Dieses machte Mathilde dem englischen Kloster Reading zum Geschenk, wo sich die Grablege ihres Vaters Heinrichs I. befand. Friedrich Barbarossa bezweifelte dreißig Jahre später die Rechtmäßigkeit dieser ‚Ausfuhr‘, hatte mit der Rückforderung der Reliquie aber letztlich keinen Erfolg.
Weitgehend unbekannt ist, wie der Hofstaat einer Königin organisiert und strukturiert war, beziehungsweise wie stark sie selbst auf die Zusammensetzung ihres Gefolges Einfluss nehmen und Personen ihres Vertrauens auswählen konnte. Die Leitung der königlichen Hofhaltung oblag wahrscheinlich dem Kämmerer, der wiederum die Tätigkeiten von Vögten, Verwaltern, Kapellänen und Notaren koordinierte. Da es keine festen Residenzen gab, war der – temporäre – Hof dort, wo sich der König aufhielt. Will man also feststellen, wie intim sich das Zusammenleben von König und Königin gestaltete und wie intensiv eine königliche Gemahlin die Regierungsgeschäfte beobachtend und beratend begleitete, dann muss man einen Blick auf die Übereinstimmung ihrer Itinerare, also ihrer Reiseverzeichnisse werfen: Abgesehen von einem ausgeprägten politischen Gestaltungswillen war auch körperliche Robustheit von großem Vorteil, wenn es darum ging, längere räumliche Trennungen zu vermeiden. Die bereits erwähnte Adelheid zum Beispiel begleitete Kaiser Otto I. auf seinen Italienzügen, verzichtete jedoch verständlicherweise im Fall von Schwangerschaften oder kriegerischen Auseinandersetzungen auf eine Teilnahme. In der ‚kleinen‘ Politik, dem regionalen Tagesgeschäft, agierte die Königin häufig als Wohltäterin für oder auch Gründerin von Kirchen und Klöstern und verantwortete damit die den Frauen vorbehaltenen frommen Taten, die der Memoria, also dem Nachleben der Herrscherdynastie zugutekamen. In der ‚großen‘ Politik oder bei der Vergabe von Lehen hatte sie ein gewisses, von ihrer Vertrauensstellung beim König abhängiges Mitspracherecht – es gibt aber keinerlei Anhaltspunkte, dass eine Königin jemals mit der Vergabe eines kirchlichen Amtes betraut worden wäre. Nicht zu unterschätzen ist auch die Königswitwe als Regentin für den unmündigen Thronfolger, eine Rolle, die zum Beispiel Agnes von Poitou, die Mutter Heinrichs IV., bis zu seiner Mündigkeit viele Jahre lang ausfüllte.
Die Mit-Krönung zur Kaiserin in Rom, die erstmals im Jahr 962 an Adelheid, der Frau Ottos I. vollzogen worden war, bedeutete die höchste Ehrung für eine deutsche Königin. Adelheid wurde damit nicht nur zur consors regni, also zur „Gefährtin des Königreichs“, sondern darüber hinaus zur imperatrix augusta, zur „erhabenen Kaiserin“ an der Seite ihres Gemahls. Dass immerhin vierzehn von achtzehn römisch-deutschen Königen ihre Frauen in Rom krönen ließen, beweist, dass man die Rolle einer Königin als ergänzend und komplettierend für die Herrschaftsausübung verstand. Diese hohe Ehre war Mathilde nicht zuteilgeworden – was sie aber nicht daran hinderte, nach dem Tod Heinrichs V. den offiziellen Titel imperatrix anzunehmen. Grundsätzlich galt also die schlichte Formel: Je enger die Beziehung und das Vertrauensverhältnis zum König, desto größer der Einfluss – aber niemals konnte die Königin aus eigenem Recht regieren! Nur die Ehe mit dem Herrscher, die Krönung und Salbung zur Königin oder auch Kaiserin verlieh ihr die dafür nötige sakrale Autorität.
Utrecht, Pfingsten 1125: Heinrich V. war tot. Seine Witwe Mathilde brachte den Leichnam nach Speyer, übergab die Reichsinsignien – und bereitete alles Notwendige für ihre Rückkehr nach England vor. Von einer ‚normalen‘ Königswitwe hätte man erwarten können, dass sie sich entweder günstig wiederverheiraten oder aber geräuschlos in ein Kloster ihrer Wahl eintreten würde. Mathilde jedoch war aus anderem Holz geschnitzt und weit davon entfernt, sich mit dreiundzwanzig Jahren aus dem aktiven Leben zurückzuziehen. Bereits im Jahr 1120 war ihr Bruder, der englische Thronfolger, bei einem Schiffsunglück auf dem Ärmelkanal ums Leben gekommen. In Ermangelung eines männlichen Erben setzte ihr Vater, König Heinrich I., alle Hoffnungen auf seine energische Tochter, die er nach ihrer Rückkehr im September 1126 als Thronerbin anerkennen ließ und mit Gottfried von Anjou verheiratet. ‚Nur‘ ein Graf und dann noch zehn Jahre jünger als sie selbst – Mathilde war von dieser arrangierten Verbindung wenig angetan. Doch nach einer längeren Gewöhnungsphase stellte die in ihrer ersten Ehe kinderlos gebliebene Frau ihre beachtliche Fruchtbarkeit unter Beweis: Innerhalb von nur drei Jahren brachte sie drei gesunde Söhne zur Welt und sicherte damit zweifelsfrei die Nachfolge auf dem englischen Thron. Nach dem Tod ihres Vaters 1135 folgten viele Jahre mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, in denen sie mit ihrem Cousin und Konkurrenten, Stephan von Blois, letztlich erfolglos um die Herrschaft rang. Auch ihre Anerkennung als Herrin über England durch die Kirche konnte nicht verhindern, dass Mathilde den Kampf um den Thron aufgeben und sich in die Normandie zurückziehen musste.
Der finale Triumph war der ehrgeizigen Fürstin dennoch vergönnt: Stephan von Blois hatte keine Nachkommen, und so konnte ihr Sohn im Jahr 1154 als Heinrich II. den Thron von England besteigen.