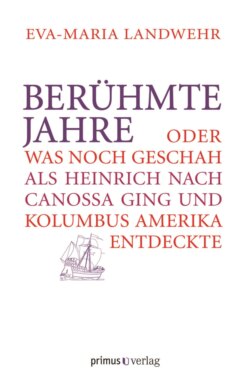Читать книгу Berühmte Jahre - Eva-Maria Landwehr - Страница 12
Karrierist, Erneuerer – Fälscher?: Suger wird Abt von Saint-Denis
Оглавление1793. Nachdem König Ludwig XVI. von Frankreich enthauptet worden war, entlud sich der Zorn der aufgestachelten Menge über Saint-Denis, und die Köpfe der steinernen Königsstatuen in der Abteikirche wurden mit roher Gewalt von ihren Rümpfen getrennt. Diese Tat entweihte die uralte Grablege der fränkischen und französischen Könige, die dort seit über tausend Jahren bestattet worden waren und die noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine ehrfürchtige Aura umgab. Doch die Revolution wollte nicht nur den Kopf des leibhaftigen Monarchen fallen sehen, sie wollte alles zerstören, was an das französische Königtum erinnern konnte.
Saint-Denis bei Paris war keine gewöhnliche Abtei, sondern ein nationales Heiligtum und nichts weniger als eine Inkunabel der französischen Kathedralgotik. Saint-Denis als Symbol der Einheit von Reich und Kirche war aber auch ein künstlich erzeugtes historisches Gebilde, ein lebendiger Mythos, der über viele Jahrhunderte hinweg mit manchmal fragwürdigen Methoden genährt wurde. Vor der Kulisse ihrer großen Vergangenheit aber war die ranghöchste unter den französischen Abteien bereits im 12. Jahrhundert eine alte und ehrwürdige Institution. Die Gründungslegende um den Märtyrer Dionysius sowie die Verehrung des gefeierten Erbauers, des Frankenkönigs Dagobert I. wurde mit großer Hingabe gepflegt. Aber auch dem Neuen, Zukunftsweisenden wurde mittels Reformen und wiederholten baulichen Maßnahmen unter respektvoller Referenz an die Tradition stets Raum gegeben. Jede neue Generation fühlte sich verpflichtet, die Überlieferung und gleichzeitig die ruhmvolle Geschichte fortzuschreiben und anzureichern – was nicht selten allzu wörtlich verstanden wurde und zu gewagten historischen Rekonstruktionen führte.
Der Grundpfeiler, auf dem nationale Bedeutung und Ehrwürdigkeit von Saint-Denis ruhten, war das Dreiecksverhältnis zwischen Abtei, Königtum und Papsttum. Diese Bande waren mal enger, mal lockerer geknüpft, aber im Kern unauflöslich. Saint-Denis war schließlich nicht irgendein beliebiges, abgeschieden gelegenes Kloster, in dem ein sanftmütiger Abt eine Handvoll betender und arbeitender Schäfchen in aller Seelenruhe hüten konnte. Saint-Denis, das dem Papst unmittelbar unterstellt war, hatte eine Aufgabe, die weit in die Zukunft wies: Je aktiver der Kult um die lange Reihe toter Könige betrieben wurde, desto gesicherter war der Fortbestand des Königtums. Zugleich galt es, die Verehrung für Dionysius, den ersten Missionar und Begründer des Christentums in Frankreich, stets präsent zu halten. Der Abt von Saint-Denis war demnach spiritueller Führer, Verwaltungsbeamter, Öffentlichkeitsarbeiter, Bauherr und rastlos an Höfe, an die Kurie oder zu Synoden reisender Diplomat in einer Person. Es kostet wenig Mühe, sich vorzustellen, dass ein solches Aufgabenspektrum den Inhaber dieses anspruchsvollen Amtes mit den ihm auferlegten klerikalen Idealen wie Demut und Bescheidenheit kollidieren lassen konnte.
Die wohl schillerndste Persönlichkeit, die je das Amt des Abtes von Saint-Denis bekleidete, war ein Mann namens Suger, der in der Überlieferung aufgrund seiner Intelligenz, seiner politischen Begabung und seines unbedingten Gestaltungswillens ein für mittelalterliche Begriffe ungewöhnlich individuelles Format bekommt. Nicht nur, weil König Ludwig VII. wegen seiner Teilnahme am Zweiten Kreuzzug (1147–1149) dem damals beinahe Siebzigjährigen für zwei Jahre die Regentschaft Frankreichs übertragen hatte. Sondern vor allem deshalb, weil Suger seit dem teilweisen Neubau der Abteikirche in den Jahren 1137 bis 1144 als einer der Väter der Gotik gilt.
Die Quellen zu Sugers Herkunft und seiner Familie sprudeln allerdings nicht besonders ergiebig. Man weiß, dass er um das Jahr 1081 wahrscheinlich in der Nähe von Saint-Denis geboren wurde und dass sein Vater Elinandus den zweifellos aufgeweckten und begabten zehnjährigen Jungen in die Obhut der Mönche von Saint-Denis gab. Auch wenn von einfachen familiären Verhältnissen die Rede ist und man den Namen seiner Mutter nicht kennt, lässt sich ein Zweig von Sugers Verwandtschaft doch zum niederen Ritterstand zählen. Funktionierende Loyalitätsstrukturen auch innerhalb der weiter verzweigten Familie zeigten sich in der nachfolgenden Generation, als einige männliche Verwandte von Sugers Karriere profitieren sollten und ihre geistliche Ämter wohl hauptsächlich seiner Protektion verdankten. Suger besuchte zunächst die Schule der angegliederten Priorei von Saint-Denis de l’Etrée, wo er – wenigstens für ein Jahr – zusammen mit dem designierten Thronfolger Ludwig erzogen und unterrichtet wurde. In die Abtei zurückgekehrt, wurde er in der Verwaltung klösterlicher Güter eingesetzt und konnte sich bald eindrucksvoll bewähren: Nach der raschen Sanierung einer Propstei in der Normandie entsandte man ihn bald in eine weitere Dependance südwestlich von Paris, die sich im Klammergriff eines benachbarten Burgherrn befand. Mit der Hilfe des Königs konnte der tatkräftige und beherzt agierende junge Mann diese Propstei damals aus ihrer misslichen Lage befreien. Es wird spekuliert, dass die guten Kontakte Sugers zum Hof vielleicht aus der gemeinsamen Schulzeit mit dem damaligen Kronprinzen resultierten – eine Begegnung der beiden Männer ist jedoch erst für das Jahr 1104 überliefert, als Verhandlungen mit Rom wegen der Aufhebung der Exkommunikation von König Philipp I. geführt wurden.
Mittlerweile war es unübersehbar, dass der junge Kleriker das Vertrauen sowohl des Hofes als auch seines Abtes genoss und verstärkt mit heiklen diplomatischen Missionen betraut wurde. Er avancierte zum ausgewiesenen Fachmann für Fragen zu Reich und Kirche und nahm deshalb an allen entscheidenden Verhandlungen teil, die die Aussöhnung von Krone und Kurie zum ausdrücklichen Ziel hatten. So war Suger, mittlerweile fünfundzwanzig Jahre alt, im Jahr 1106 bei der Synode in Poitiers anzutreffen, im Jahr darauf nahm er als Mitglied der königlichen Gesandtschaft an einem Treffen mit Papst Paschalis II. teil, wo hauptsächlich um eine Lösung im Investiturstreit mit dem deutschen König Heinrich V. gerungen wurde. Trotz dieses anspruchsvollen Diskussionsgegenstandes war Suger gleichzeitig umsichtig und vorausschauend genug, zu verhindern, dass der Bischof von Paris Hand an die Unabhängigkeit der Abtei Saint-Denis legte. Suger hatte auch keine Scheu, den außenpolitischen Mahner zu geben, als er den französischen König und dessen Sohn ohne falsche Ehrfurcht klipp und klar aufforderte, dem Beispiel Karls des Großen zu folgen und die Kirche vor Tyrannen wie Heinrich V. zu schützen. Bescheidenheit war Sugers Sache schon zu diesem Zeitpunkt nicht, denn er legte Wert darauf, in der von ihm verfassten Lebensgeschichte König Ludwigs VI., der Vita Ludovici Grossi, von seinen aufrüttelnden Worten zu berichten. Auch anlässlich der Synode im Jahr 1112, die auf dem Lateran in Rom abgehalten wurde, zögerte Suger nicht, seine Meinung unverbrämt kundzutun: Heinrich V. zeichnete er als verschlagenen und brutalen Menschen mit kriminellem Potenzial, verhehlte allerdings auch nicht seine Verachtung für den Papst, der ihm feige und entscheidungsschwach schien. Als stets agierende Persönlichkeit, als ‚Macher‘, hatte Suger für die abwartende und zögerliche Haltung des Papstes kein Verständnis und brachte dies auch deutlich zum Ausdruck.
Nachvollziehbar wird diese ungewöhnlich harte und unnachsichtige Position, wenn man die Mission betrachtet, der sich Suger wohl bereits seit seinem Eintritt ins Kloster verschrieben hatte und die er als seine Lebensaufgabe verstand: die bestehende Verbindung zwischen Saint-Denis und dem Königtum noch enger zu schnüren, das Ansehen der Abtei nochmals zu steigern und den Klosterpatron zum Nationalheiligen zu machen. Bereits im Jahr 1120, zu einem Zeitpunkt, als er der Abtei noch gar nicht vorstand, konnte er König Ludwig VI. zur Ausfertigung eines Diploms überreden, mit dem der König die Insignien seines verstorbenen Vaters Philipp der Obhut des heiligen Dionysius – und damit der Abtei Saint-Denis – anvertraute.
1122 sieht sich Suger am Ziel, das heißt, in einer Position, die es ihm endlich erlaubt, alle für die Verwirklichung seiner Vision notwendigen Maßnahmen in die Wege zu leiten. Wieder ist es eine Quelle aus seiner eigenen Hand, die bereits erwähnte Vita Ludovici Grossi, in der er davon berichtet, wie ihm das Amt des Abtes von Saint-Denis angetragen wurde: Auf der Rückkehr von einer seiner zahlreichen diplomatischen Reisen nach Rom erfährt Suger, dass ihn das Kapitel zum Nachfolger von Abt Adam gewählt hatte, der am 18. Februar verstorben war. Er verhehlt nicht, dass ihn anfänglich Zweifel bezüglich der Gültigkeit dieser Wahl geplagt hätten, da das Wahlgremium wohl versäumt hatte, den König in dieser Sache zu konsultieren. Suger nimmt die Wahl schließlich an, aber nicht ohne sich als routinierter Politiker nach allen Seiten abzusichern: Die kirchlichen Regeln, so sein Argument, seien eingehalten worden und der Papst hätte sich ebenfalls einverstanden erklärt.
Eine kurzfristige Rücksprache mit dem Hof war aufgrund des verzögerten Nachrichtenverkehrs nicht möglich gewesen, aber das persönliche Risiko, eine falsche Entscheidung zu treffen, schien aufgrund seiner ausgezeichneten Verbindungen zum Königshaus wohl überschaubar. Am 10. März wurde Suger dann auch unmittelbar nach seiner Ankunft in Saint-Denis von König Ludwig VI., dem Erzbischof von Bourges, dem Bischof von Senlis, seinen Mitbrüdern und vielen anderen mit allen Ehren empfangen. Bereits am Tag darauf, am 11. März, erfolgte seine Weihe zum Priester – eine zwingende Voraussetzung für sein neues Amt – und einen Tag später seine Ordination zum Abt.
Die folgenden Monate legen Zeugnis ab von Sugers schier unerschöpflicher Energie und Schaffenskraft. Handeln tat not, denn vor allem die finanzielle Lage der Abtei war mehr als prekär. Begangene Versäumnisse waren gewiss nicht nur Sugers Vorgänger, Abt Adam, anzulasten, denn dieser hatte sich bereits bemüht, Missstände zu korrigieren, die noch aus dem vorigen Jahrhundert stammten. Der lokale Adel hatte damals die lockere Amtsführung von Abt Ivo I. auszunutzen gewusst und sich mehr und mehr Sonderrechte angemaßt. Einige der verloren gegangenen Einnahmequellen und Güter waren bereits zurückgeholt worden, doch eine wirtschaftliche Reorganisation der Abtei war unumgänglich. Suger tat das, was er in solchen Situationen immer tat: Er wandte sich an den König. Auf seine Bitte hin bestätigte König Ludwig VI. auch noch im gleichen Jahr die Privilegien von Saint-Denis und fügte außerdem weitere hinzu – was die Situation vorerst stabilisierte. Es waren aber nicht nur administrative Aufgaben, die den neuen Abt forderten. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt sah sich Suger gezwungen, ein kompliziertes ideologisches Problem, das den Namenspatron von Saint-Denis betraf, möglichst geräuschlos und ohne öffentliches Aufsehen zu lösen.
Dionysius war vermutlich um das Jahr 250 nach Christus mit sechs anderen Bischöfen von Papst Fabianus nach Gallien geschickt worden, um die dort ansässigen Heiden vom Christentum zu überzeugen. Dem römischen Gouverneur missfiel sein missionarischer Eifer als Bischof von Paris, weshalb er ihn verhaften und zusammen mit seinen Begleitern Rustikus und Eleutherius auf dem heutigen Montmartre, dem ‚Berg der Märtyrer‘ enthaupten ließ. Der Legende nach soll Dionysius sein abgeschlagenes Haupt aufgenommen und mit diesem ganze sechs Kilometer Richtung Norden gegangen sein, bis zu der Stelle, die er sich als Grabstätte ausgesucht hatte und die nach ihm benannt werden sollte: Saint-Denis. Schon bald nach dem Erlass des Toleranzedikts durch Kaiser Galienus im Jahr 311 hatte sich über seinem Grab und den Gräbern seiner Begleiter (wie diese dorthin gelangten, ist leider nicht überliefert) eine erste Kultstätte etabliert. Jetzt, wo sie ihre Religion offen leben durften, bekannten sich einige Christen zu ihrem Glauben, indem sie sich in der unmittelbaren Nähe des Märtyrers bestatten ließen. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts soll Genovefa, eine Adelige aus Paris, den Bau einer Steinkirche finanziert haben, die kontinuierlich vergrößert und verändert wurde. Im Jahr 626 baute der fränkische König Dagobert an diesem Ort der Überlieferung nach eine Abtei, die den französischen Königen fortan als Grablege diente. Doch schon 150 Jahre später mussten alle älteren Bauten dem Neubau einer karolingischen Basilika durch Abt Fulrad (750–784) weichen.
Ein interessanter Fall für Kriminalisten wurde die Geschichte um den Gründer im Jahr 827, als Kaiser Ludwig der Fromme von seinem byzantinischen Amtskollegen die Schriften eines Theologen namens Dionysius Areopagita zum Geschenk bekam. Man war schnell bereit, diesen Namensvetter ohne allzu gewissenhafte Recherchen und trotz angebrachter Zweifel als Gründer von Saint-Denis zu identifizieren. Anders als der gallische Missionar galt dieser Dionysius als erster Bischof von Athen, der bereits im ersten nachchristlichen Jahrhundert von Apostel Paulus persönlich bekehrt worden war. Dass eine Übereinstimmung der beiden ‚Dionysii‘ allein schon angesichts der Lebensdaten völlig unmöglich war, konnte auch Hilduin, in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts Abt von Saint-Denis, selbst bei sehr wohlwollender Interpretation kaum verborgen geblieben sein. Aber ein solcher Ausnahme-Heiliger verlangte geradezu danach, zweckdienlich eingesetzt zu werden. In einer Person vereinigt, konnte man sich mit dem Märtyrer auf einen legitimen päpstlichen Stellvertreter in Frankreich berufen – und mit dem Bischof von Athen wiederum war man auf Augenhöhe mit Rom oder Konstantinopel angekommen.
Die Konfusion um den Patron von Saint-Denis ließ sich aber noch steigern. Der eine Dionysius präsentierte sich letztendlich als ein menschliches Mosaik aus insgesamt drei historisch beglaubigten Personen: dem päpstlichen Missionar in Gallien, dem Bischof von Athen – und einer Art mittelalterlichem ‚Trittbrettfahrer‘, das heißt einem relativ unbekannten christlichen Autor des 6. Jahrhunderts, der sich nur mit dem Namen des Paulusschülers Dionysius Areopagita schmückte! Zu allem Überfluss stammte die Schrift, die Ludwig der Fromme erhalten hatte, von eben jenem Pseudo-Dionysius, der sich weder durch ein Bischofsamt noch durch den Ruhm des Märtyrers auszeichnen konnte. Doch auch diese offensichtlich höchst widersprüchlichen Fakten waren mit viel Fantasie und ‚gutem Willen‘ zu synchronisieren – zum Beispiel, indem in der Liturgie von Saint-Denis hartnäckig verkündet wurde, dass Dionysius eben von Athen nach Rom und von dort nach Paris zur Mission geschickt worden sei!
Es gab jedoch einen streitbaren Geist, der nicht gewillt war, sich um des lieben Friedens willen an diesen eigenartigen Konsens zu halten: Petrus Abaelardus, der männliche Part des berühmten hochmittelalterlichen Liebespaares Abaelard und Heloise. Während eines Aufenthaltes in Saint-Denis, ausgerechnet im Jahr 1122, enttarnte er die wahre Identität des Dionysius Areopagita und stieß damit erwartungsgemäß in ein Wespennest. Geboren als Sohn eines Ritters aus der Bretagne, widmete sich Abaelard dem Studium der Theologie, der Philosophie und der Dialektik. Bereits mit knapp dreiundzwanzig Jahren gründete er in Paris eine eigene Schule und geriet aufgrund seiner kontroversen Denkmodelle und Lehransätze immer wieder in heftige Konflikte mit der etablierten Wissenschaft. In Paris nahm auch die hinlänglich bekannte Liebesgeschichte mit Heloise – und damit das Verhängnis – seinen Lauf. Er, damals als Hauslehrer tätig, verliebte sich in die hochintelligente junge Heloise und begann eine Affäre mit ihr, aus der der gemeinsame Sohn Astrolabius hervorging. Der Onkel von Heloise fand für den Gelehrten, der zu mehr als einer geheimen Ehe nicht bereit war, eine grauenvolle Strafe: die Entmannung. Während sich Heloise als Nonne in das Kloster Argenteuil zurückzog, suchte Abaelard nach diesem traumatischen Erlebnis Zuflucht in Saint-Denis, wo eine gut ausgestattete Bibliothek willkommene intellektuelle Ablenkung versprach. Ersten Unmut als Nestbeschmutzer zog der Gelehrte auf sich, als er den vernachlässigten Zustand der Abtei und den aufwendigen Lebensstil des Abtes anprangerte. Man hätte allerdings ahnen können, dass mit Abaelard, der gerade mal ein Jahr zuvor eine seiner kontroversen theologischen Schriften auf der Synode in Soissons hatte verbrennen müssen, ein Mann in die Abtei gekommen war, der Konfrontationen und Provokationen nicht aus dem Weg zu gehen pflegte. Die Problematik um die verschiedenen Dionysius-Versionen war innerhalb der Mauern von Saint-Denis durchaus bekannt, doch Abaelard war nach eingehendem Studium der Quellen nicht zu klugem Schweigen bereit und legte ohne zu Zögern seinen Finger in diese offene Wunde. Seine offensive Vorgehensweise brachte die anderen Mönche gegen ihn auf und Abt Adam beschuldigte ihn des Hochverrats, da seine lästerlichen Worte über den Kirchenpatron sich gegen König und Reich wendeten. Er bat Abt Adam um die Entbindung von seinem Gelübde und um die Erlaubnis, sich an einem Ort seiner Wahl niederlassen zu dürfen, was ihm unter Androhung der Exkommunikation verwehrt wurde. Bevor er dem König ausgeliefert werden konnte, gelang ihm jedoch die Flucht. Die Eskalation dieses Konflikts vollzog sich im Jahr 1122, kurz bevor Suger, der sich noch auf der Rückreise von Rom nach Frankreich befand, zum neuen Abt gewählt wurde. Die Zeit arbeitete in diesem Fall für Abaelard. Wenige Tage nach seiner Drohung starb Abt Adam und sein Nachfolger bewies schon jetzt ein kluges Gespür für die richtigen Entscheidungen: Suger vertraute darauf, dass eine möglichst unspektakuläre Lösung die erhitzten Gemüter beruhigen und zum Vorteil der Abtei sein würde. Nach Rücksprache mit dem König durfte sich Abaelard unter der Auflage, sich keinem neuen Konvent anzuschließen, an einen abgelegenen Ort zurückziehen.
Suger konnte sich nun ungestört seinen eigentlichen Aufgaben zuwenden, denn er hatte sich für sein Abbatiat kein geringeres Ziel gesetzt, als das Königtum noch fester an Saint-Denis zu binden. Die Grablege der Könige schien ihm für diesen Zweck nicht ausreichend genug, da dies bedeutete, dass die Abtei immer nur Pflegerin bereits vergangenen Ruhms sein durfte. Saint-Denis sollte aber auch in der Gegenwart des Königtums präsent sein, und welche Zeremonie unter kirchlicher Beteiligung empfahl sich dafür besser als die Krönung. Weil man mit einem solchen Ansinnen in direkte Konkurrenz zu Reims trat, war es notwendig, mehr als nur gute Argumente für Saint-Denis zu finden. Eine passende Urkunde tat not – und so ließ Suger kurzerhand ein Diplom Karls des Großen, datiert in das Jahr 813, anfertigen, in dem Dionysius als Lehensherr des Kaisers bezeichnet wird. Vor allem im zweiten Teil der Urkunde werden alle Register gezogen, als Karl der Große selbst erzählt, wie er seine Krone auf den Altar des heiligen Dionysius legte und ihm damit die Königsherrschaft übertrug. ‚Zufälligerweise‘ findet sich in diesem Diplom dann auch noch die Klausel, dass der Herrscher Frankreichs in Saint-Denis gekrönt werden muss! Doch damit war Suger offensichtlich zu weit gegangen. Ludwig VI., der stets ein offenes Ohr für die Ansinnen und Vorschläge des Abtes hatte, verweigerte sich diesem Manipulationsversuch und ließ seinen Sohn Philipp im Jahr 1129 demonstrativ in Reims weihen.
Aber Suger wäre nicht Suger gewesen, wenn er sich von diesem Misserfolg hätte entmutigen lassen. Gewissermaßen als Entschädigung für sein Scheitern holte er das wohlhabende und ökonomisch bedeutende Nonnenkloster Argenteuil in den Besitz von Saint-Denis zurück. Die Ansprüche der Abtei leitete er daraus ab, dass die moralisch verwerflichen Zustände in diesem Kloster dringende Reformen und eine Vertreibung der Nonnen notwendig machten. Das Ass im Ärmel des Abtes war jedoch eine Urkunde der Kaiser Ludwig und Lothar, die beweisen sollte, dass Argenteuil seit dem 9. Jahrhundert ohnehin zu Saint-Denis gehört habe. Von diesem Dokument ließ sich Ludwig VI. wiederum überzeugen und ordnete die Restitution an Saint-Denis an. Nachdem sich die Äbte vor Suger vergeblich in dieser Angelegenheit gemüht hatten, mag an dieser Stelle das wahre Alter der oben genannten Urkunde, auf der die Schrift wahrscheinlich kaum getrocknet war, bezweifelt werden …
Suger war für damalige Verhältnisse bereits ein Greis von fast sechzig Jahren, als er sich von 1137 bis 1144 seiner letzten großen Aufgabe stellte: dem Neubau der Abteikirche. Obwohl es ihm in erster Linie darum ging, einen neuen, prächtigeren Rahmen für die Reliquien und die begrabenen Herrscher zu schaffen, waren vor allem Letztere nicht davor gefeit, Sugers unbedingtem Gestaltungswillen zum Opfer zu fallen. Keine Ehrfurcht kannte er zum Beispiel vor alten Königen: Pippin, der Vater Karls des Großen, hatte sich als Geste der Demut ganz bewusst außerhalb der Kirche mit dem Gesicht nach unten bestatten lassen. Als die Bauarbeiten unter Suger, der mit Sicherheit von diesem Vermächtnis wusste, abgeschlossen waren, lag der große Pippin aber innerhalb der Kirche und seine Devotionsgeste war ad absurdum geführt!
Suger war kein Freund von persönlicher Bescheidenheit, wenn er sie für unangebracht hielt: Ohne Scheu reklamierte er für seine Verdienste um die Abtei eine angemessene Memoria sowie einen Jahrestag, an dem seiner gedacht werden sollte. Obwohl er stets beteuerte, dass er dies alles nicht für seinen eigenen Ruhm, sondern ausschließlich zur Ehre Gottes getan habe, ließ er sich in Bild und Text als Stifter omnipräsent verewigen: Ein kniender Suger hat sich in einem Fensterbild erhalten und allein fünf Inschriften in neu erbauten Architekturteilen nennen seinen Namen.
Suger sollte es erspart bleiben, zu erfahren, dass seine Baumaßnahmen kaum hundert Jahre überdauern würden. Denn es mutet fast wie eine Strafe für die Sünde des Hochmuts an, dass schon im Jahr 1231 wesentliche Teile ‚seiner‘ Abtei einem groß angelegten Umbau weichen mussten.