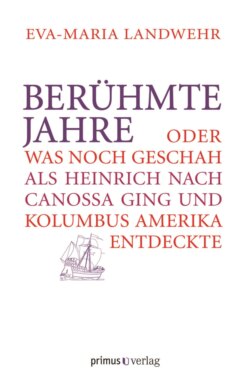Читать книгу Berühmte Jahre - Eva-Maria Landwehr - Страница 9
Wiederhergestellte Freiheit: Das Privileg des Nonnenklosters im Chiemsee
ОглавлениеEin Reisender, der sich im Jahr 1077 an einem ruhigen und klaren Herbsttag dem Ufer des Chiemsees näherte und auf das stille Wasser blickte, in dem sich die schneebedeckten Berge spiegelten, konnte hinter den Nebelbänken, die sich über dem noch sommerlich warmen Wasser gebildet hatten und nur allmählich von der Morgensonne aufgelöst wurden, die schemenhaften Umrisse von steinernen Gebäuden erahnen. Was er sah, war der Frauenkonvent, den Herzog Tassilo III. von Bayern etwa dreihundert Jahre zuvor auf einer der Inseln im Chiemsee gegründet hatte. Jeder einzelne Baustein war mühsam übers Wasser geschafft worden, dafür schützte der See wie ein riesiger Wassergraben und war außerdem ein zuverlässiger Lieferant für alle Arten von Speisefischen. Die alte Heerstraße, die dicht am Ufer vorbeiführte, sorgte dafür, dass man auch in insularer Abgeschiedenheit in den Genuss aktueller Nachrichten kommen konnte.
Im Jahr 788 verleibte sich Karl der Große den Inselkonvent ein und verlieh ihm den Status eines Reichsklosters. Sein Enkel, Ludwig der Deutsche, setzte 833 seine Tochter Irmengard als Äbtissin ein, die ihre Sache so gut machte, dass sie noch heute als zweite Gründerin des Klosters verehrt wird. Die Ungarneinfälle im 10. Jahrhundert erstickten mit deprimierender Regelmäßigkeit das immer wieder zaghaft aufkeimende klösterliche Leben, bevor mit dem Sieg Ottos des Großen auf dem Lechfeld im Jahr 955 eine Zeit des kontinuierlichen Aufbaus begann. Für das 11. Jahrhundert ist die Urkundenlage weniger als spärlich zu nennen: Als einzige namentlich bekannte Äbtissin gilt eine gewisse Tuta, in deren Amtszeit die Öffnung des Sarkophags der verehrten Irmengard fällt.
Aber das Stift im Chiemsee war äußerst wohlhabend, so viel ist klar. Sein umfangreicher Besitz, um den sich an die dreißig Probsteien, also Niederlassungen der klösterlichen Verwaltung kümmerten, erstreckte sich von Niederbayern bis Tirol. Über tausend Grunduntertanen entrichteten ihre Abgaben ans Kloster in Form von Geldzahlungen, Naturalien und Arbeitsdiensten. In den Uferregionen des Sees gelegene Höfe lieferten Hühner, Eier, Gänse, Lämmer und Schweine, auf den fruchtbaren Böden Niederbayerns wurde das Getreide für den Konvent geerntet. Damit sowohl für das leibliche Wohl als auch für das liturgische Abendmahl eine ausreichende Menge Wein zu Verfügung stand, verpachtete das Stift seine Ländereien in Südtirol und Niederösterreich an Bauern, die wiederum für die Bereitstellung des begehrten Rebensaftes zu sorgen hatten. Auch haltbare und leicht zu transportierende Waren wie Loden, Flachs, Schmalz und Käse kamen aus Tirol über die Alpenpässe nach Innsbruck. Ab dort wurden sie auf dem Inn bis Rosenheim geflößt, um dort wieder auf Wagen umgeladen zu werden. Boote setzten die kostbare Fracht dann von Gstaadt aus über den Chiemsee auf die Insel über.
Die Sorge um ihr Seelenheil brachte im Lauf der Jahrhunderte außerdem immer wieder vermögende Personen dazu, ihren weltlichen Besitz frommen Stiftungen zu überlassen – ein Vorgang, von dem nicht nur Frauenchiemsee in hohem Maße profitierte. Wie später bei der Errichtung von St. Peter in Rom konnte der Konvent Ablässe gegen Spenden gewähren, die für notwendige Baumaßnahmen eingesetzt wurden. Da man stets darauf achtete, dass sich das Vermögen mehrte und nicht verringerte, legte man großen Wert darauf, nur Frauen mit einer ansehnlichen Mitgift ins Stift aufzunehmen.
So weit, so gut. Wie aber darf man sich den Alltag in einem Frauenkloster oder einem Stift des Mittelalters überhaupt vorstellen? Wer begründete einen solchen Konvent, wer durfte dort eintreten und: Worin bestanden die Aufgaben der Frauen, die sich für ein solches Leben entschieden hatten? Die Beschreibung einer klösterlichen Lebensgemeinschaft könnte mit folgender klischeehaften Vorstellung beginnen: Ein Frauenkonvent des Mittelalters war ein weltfremder Ort der Abgeschiedenheit, Besinnung und inneren Einkehr. Hier lebten einfache, sanftmütige und demütige Frauen für das Gebet und gingen widerspruchslos und aufopferungsvoll der ihnen zugeteilten Arbeit nach. Zutreffender wäre wohl diese Beschreibung: Ein Frauenkonvent des Mittelalters war ein funktionstüchtiges Unternehmen mit einer klaren Hierarchie; er war ein florierender Wirtschaftsbetrieb mit umfangreichen, weitverstreuten Besitzungen, eine standesgemäße Herberge für durchreisende Fürsten, ein luxuriöser Ruhesitz für Königswitwen. Vor allem aber war er eine elitäre Erziehungs- und Bildungsanstalt, eine Art Luxusinternat für verwöhnte höhere Töchter mit eigenem Personal – und damit ein Hort des Eigensinns und der Extravaganz, in dem, wie es Ende des 10. Jahrhunderts Thangmar, der Vertraute des Bischofs von Hildesheim, beklagte, jede tat, was sie wollte.6
Die Wahrheit liegt, wie so oft, wohl irgendwo in der Mitte, denn das Klosterwesen erfuhr im 11. Jahrhundert eine Zeit des Umbruchs und der Reform. Rückzugsorte für Menschen, die ungestört von weltlichen Umtrieben ihre Religion leben wollten, gab es bereits seit dem 4. Jahrhundert – verbindliche Vorgaben, wie dieses gemeinschaftliche Miteinander auszusehen und sich zu vollziehen hatte, existierten jedoch lange Zeit nicht. Deshalb ist aus heutiger Sicht im Einzelfall schwerlich zu definieren, welche Gemeinschaften sich strengen Regeln unterwarfen und welche sich auf ein mehr oder weniger liberal angelegtes Zusammenleben verständigt hatten. In jedem Fall war das Bekenntnis zur Religion für Frauen bis ins hohe Mittelalter die einzige Alternative zu einem vorbestimmten Dasein als Ehefrau und Mutter und damit die Möglichkeit, ihr Leben – in Grenzen natürlich – selbst gestalten zu können. Vorbildhafte und nachahmenswerte Vorschriften gab es bereits seit Beginn des 6. Jahrhunderts. Damals hatte Benedikt von Nursia, der Namensgeber des Benediktinerordens, seine Regula Benedicti verfasst und auf dem Monte Cassino das erste Männerkloster gegründet, in dem nach diesen Grundsätzen gelebt wurde. Zur sogenannten stabilitas loci, also der ‚Residenzpflicht‘, wie man es heute nennen würde, gehörte unter anderem das Bekenntnis zur Keuschheit (Zölibat) sowie die Unterwerfung unter ein Zeitkonzept, das den Tag in Einheiten für das Gebet, die Arbeit und den Schlaf aufteilte und damit in ein straffes Korsett schnürte. Es gab also bereits Orte, an denen Männer und Frauen aus freien Stücken getrennt oder auch gemeinsam nach einer festen und strengen Ordensregel lebten. Die sogenannten Frauenstifte wiederum verstanden sich als religiöse Lebensgemeinschaften mit nur klosterähnlichen Strukturen, verlangten von ihren Bewohnerinnen keine Gelübde und keine Klausur und ließen Raum für persönliche Freiheiten und Annehmlichkeiten. Meist freiwillig, manchmal auf sanften Druck hin, traten junge Frauen aus dem Adel in diese durchaus als Schutzräume angelegten Stifte ein, um als Kanonissinnen ein in Maßen zurückgezogenes und religiöses Leben zu führen. Zurückgezogen wenigstens solange sie als potenzielle Fürstinnen oder Königinnen von ihren Familien nicht als heiratspolitische Schachfiguren ins Spiel gebracht wurden. In dieser bequemen Warteschleife erfuhren sie die bestmögliche Erziehung, lernten Latein, manchmal sogar Griechisch und Hebräisch und studierten die Heiligen Schriften. Sie befassten sich mit Schöngeistigem, wie Dichtung, Geschichtsschreibung, Philosophie, Buchmalerei und Kunsthandwerk, sie wurden aber auch in lebenspraktischen und karitativen Bereichen, wie zum Beispiel der Güterverwaltung oder der Armen- und Krankenpflege, unterwiesen. Dabei durften sie nach wie vor über ihr Privateigentum verfügen und mussten weder auf Personal noch auf reichhaltiges Essen und kostbare Kleidung verzichten. Sie waren in ihrer Bewegungsfreiheit kaum eingeschränkt und, da sie ihre eigenen Räumlichkeiten bewohnten, auch nicht gezwungen, sich den Gerüchen und Geräuschen eines gemeinsamen Schlafsaals auszusetzen. Wie unterschiedlich Nonnen und Kanonissinnen ihre Relevanz und ihre Stellung innerhalb der Ordensgemeinschaften einschätzten, offenbart sich in Bildzeugnissen wie der Buch- oder der Altarmalerei: Während sich Stiftsdamen oft selbstbewusst und annähernd gleichberechtigt groß mit den Kirchenpatronen in Szene setzen ließen, erreichten die Nonnen in ähnlichen Darstellungen nur ein deutlich geschrumpftes Bedeutungsniveau.
Es wird kaum verwundern, dass sich der Eintritt junger Damen von hohem Stand in einen Konvent nicht immer unproblematisch gestaltete. Als zum Beispiel im 10. Jahrhundert Sophia, die Tochter Kaiser Ottos II., im niedersächsischen Stift Gandersheim aufgenommen wurde, eilte ihr kein guter Ruf voraus: Gerade einmal zwölf Jahre alt, galt sie als kapriziös und ehrgeizig – den Weg zur Äbtissin betrachtete sie wohl als vorgezeichnet und damit als reine Formalität. Sie forderte – und bekam – für ihre Weihe den Bischof, den sie sich selbst ausgesucht hatte, und bewies damit ihre ausgeprägte Willensstärke.
Ein Stift wurde von einflussreichen und wohlhabenden Persönlichkeiten aus dem Adel und der hohen Geistlichkeit gegründet und finanziert – nicht ganz uneigennützig, wie man sich unschwer vorstellen kann. Der Gründer war auf den einwandfreien Zustand und die regelmäßige dies- wie jenseitige Pflege seines Seelenheils bedacht und ließ sich deswegen seine Großzügigkeit und seinen Schutz durch einen spirituellen ‚Rundum-Service‘ aus Gebeten und Fürbitten entlohnen. Diese religiösen Dienstleistungen bezogen sich nicht nur auf die Lebenden, sondern ebenso auf die Toten der Stifterfamilie, was die Sache ungleich komplizierter und aufwendiger machte. Namenslisten, die regelmäßig abgearbeitet wurden, stellten sicher, dass niemandes Seele in Vergessenheit geraten konnte. In späteren Jahrhunderten ließen sich die Stifter als permanente Gedächtnisstütze auch gern in Gebetbüchern oder – ganz klein zwar, aber doch unübersehbar – auf Altarbildern neben den heiligen Hauptakteuren darstellen.
Mit einer Gründungsurkunde allein war es jedoch nicht getan: Die Bewohnerinnen eines Stiftes wollten wirtschaftlich versorgt sein. Schenkungen von Höfen und Ackerland sowie Nutzungsrechte für Wälder und Gewässer garantierten eine gut organisierte Belieferung unter anderem mit Getreide, Fleisch, Eiern, Fischen und Wild. Für einen königlichen Stifter zum Beispiel waren vakant gewordene Lehen oder Güter, die aufgrund von Konfiszierungen oder Gerichtsurteilen einen neuen Herrn suchten, besonders ideal, weil in einem solchen Fall der Familienbesitz nicht angetastet werden musste. Andererseits war es notwendig, einen derart vollzogenen Besitzwechsel in regelmäßigen Abständen zu bestätigen, um Ansprüche Dritter abzuwehren. Vorteilhaft waren sogenannte Privilegien, also beurkundete Sonderrechte aus den Notariaten des Königs, des Landesherrn oder des Bischofs, die von Steuern und Abgaben befreiten, die freie Wahl der Äbtissin oder auch die alleinige Gerichtsbarkeit garantierten. Über allem schwebte konkurrenzlos der Schutz des Papstes, der einen Konvent vor dem Zugriff oder dem reformatorischen Eifer so manches Bischofs bewahren konnte.
Ebenso wie die Nonnen oder Kanonissinnen hatte selbstverständlich auch die Äbtissin einen weitverzweigten Stammbaum vorzuweisen. Sie entstammte meist der Stifterfamilie, die naturgemäß ein starkes Interesse daran hatte, ihre Investitionen auf diese Weise quasi im Familienbesitz und damit innerhalb ihrer Einflusssphäre zu halten. Für den Besitz, den man dem Kloster oder Stift übertragen hatte, war die Äbtissin als Lehns-, Grund- und auch Leibherrin die höchste Instanz mit einer umfassenden Entscheidungsgewalt. Nicht selten leitete sie mehrere Stifte oder Klöster in Personalunion – als Vorsteherin einer Reichsabtei führte sie zugleich auch den Titel einer Reichsfürstin. Äbtissinnen mit herausragenden Fähigkeiten bekamen sogar ganze Reiche unterstellt, wie Mathilde, eine Tochter Ottos des Großen, die um das Jahr 1000 dem Frauenstift St. Servatius in Quedlinburg vorstand. Das Vertrauen ihres Neffen, Kaiser Ottos III., in ihre administrative Kompetenz, ihr diplomatisches Talent und ihre Loyalität war so unerschütterlich, dass er sie vor seinem Zug nach Rom zur temporären Regentin ernannte. Ungeachtet einer solchen Machtfülle, der Ämterhäufung und der Verantwortung, die sie für viele Menschen zu tragen hatten, verwehrte man den Äbtissinnen die Ausübung des priesterlichen Lehr- und Weiheamtes, und auch die Seelsorge blieb in Frauenkonventen eine reine Männerdomäne.
Im 11. Jahrhundert gewann die religiöse Gesinnung als ausschlaggebendes Kriterium für den Eintritt ins Kloster oder Stift immer mehr an Priorität, und die Forderungen nach Reformen und nach einer Öffnung der Konvente für alle Schichten wurden immer lauter. In die Kritik gerieten vor allem die liberal und regellos ausgerichteten Stifte, die als allzu weltliche ‚Versorgungsanstalten‘ des Adels verschrien waren. Der Philosoph und Theologe Peter Abaelard plädierte zu Beginn des 12. Jahrhunderts dafür, die Äbtissin vor allem aufgrund ihrer Führungsqualitäten auszuwählen, denn es hatte sich wohl mehr als einmal bewahrheitet, dass adelige Frauen dieses Amt mehr als repräsentative Position und weniger als verantwortungsvolle Bürde gestalteten. Standesdünkel blieben aber faktisch unüberwindbar: Als Hildegard von Bingen um 1147 ein Frauenkloster gründete, wurde ihr von einer anderen Äbtissin vorgeworfen, dass sie entgegen der christlichen Prinzipien von der Gleichstellung aller Menschen nur wohlhabende adlige Damen aufnehme. Hildegard verwies in ihrer Antwort etwas pikiert auf die gottgewollte Existenz unterschiedlicher Stände – und dass man es den Tieren gleichtun solle, die sich ganz selbstverständlich vor einer widernatürlichen Vermischung hüten würden!
Vor allem aufgrund ihrer Freiheiten und ihrer ständischen Geschlossenheit verspürten also zahlreiche Stifte wenig Neigung, sich, wie es im 11. Jahrhundert gefordert wurde, den strengen benediktinischen Regeln zu unterwerfen. Auch wenn manche Äbtissinnen durchaus die ehrgeizigen spirituellen und disziplinarischen Zielsetzungen im Fall von Neugründungen guthießen, schreckten sie in ihren eigenen Häusern aber meist vor solch einschneidenden Veränderungen zurück. Der erbitterte Widerstand, den freizügige Konvente gegen eine vom Bischof angeordnete Einführung der Benediktinerregel leisteten, gab der Geistlichkeit die Handhabe zur Enteignung – eine Maßnahme, die gerne und nicht selten vor allem aus wirtschaftlichen Gründen angewandt wurde.
Welcher Regel sich die Chiemseer Stiftsdamen verschrieben hatten, ist aufgrund der fehlenden Quellen nicht mehr festzustellen, man nimmt aber an, dass sie sich an den benediktinischen Grundsätzen zumindest orientierten – offiziell führte die Abtei im Zeitraum von 788 bis 1803 die Bezeichnung „Königliches Stift und adeliges Kloster“. In jedem Fall scheinen sich die Stiftsdamen lange erfolgreich gegen jegliche Bevormundung und Fremdsteuerung gewehrt zu haben, denn noch im 12. Jahrhundert gehörte der Konvent zu den beiden Abteien im Bistum Salzburg, die erbitterten Widerstand gegen eine Reform leisteten! Im Jahr 1141 erhielt der Konvent auch die erste päpstliche Urkunde überhaupt, in der der gegenwärtige Besitz bestätigt wurde und mit der man sich der Reformpläne durch das übergriffige Erzbistum Salzburg erwehren wollte. Ein probates Mittel, um einen solchen Widerstand zu brechen, war Rufmord: Im 13. Jahrhundert versuchte Erzbischof Eberhard von Salzburg, den Konvent im Chiemsee beim Papst – letztlich erfolglos – anzuschwärzen, indem er ihm hinterbrachte, dass die dortigen moralischen Standards denen eines Bordells glichen.
Diese beherzte Widerständigkeit schützte zwar vor dem Erzbischof, nicht aber vor den egoistischen und intriganten Beratern des minderjährigen deutschen Königs. Im Dezember des Jahres 1062 erfuhr das Stift auf Frauenchiemsee die wohl einschneidendste Veränderung seit den knapp dreihundert Jahren seiner Gründung: Es wurde das Opfer territorialer und wirtschaftlicher Interessen. Heinrich IV., gerade einmal zwölf Jahre alt und unter der Vormundschaft von Erzbischof Anno von Köln stehend, sprach das Stift völlig überraschend dem Erzbistum Salzburg und damit Erzbischof Gebhard zu. Diese Überlassung erfolgte ohne jede Einschränkung, sodass den Stiftsdamen nur die ihnen ohnehin zugesicherten Einkünfte blieben. Misstrauisch aufhorchen lässt der Umstand, dass zu dieser Zeit auch der Erzbischof von Mainz und der Bischof von Passau mit wohlhabenden Klöstern ‚versorgt‘ wurden – Annos Einfluss auf den Kindkönig hatte also weitreichende Konsequenzen vor allem für die bayerischen Konvente. Erzbischof Gebhard von Salzburg galt bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich als verlässlich königstreu. Er hatte unter Heinrich III. in der königlichen Kapelle gedient, war auch nach dessen Tod am Hof geblieben, wo er vom Herbst 1058 an ein Jahr als Kanzler fungierte und 1062 schließlich zum Erzbischof von Salzburg aufstieg. Das Verhängnis nahm seinen Lauf, als Gebhard nach einer Romreise im Jahr 1074 mit den Reformplänen Papst Gregors VII. zu sympatisieren begann und sich folgerichtig gegen Heinrich IV. stellte, als dieser gegen den Papst opponierte und gebannt wurde. Auch nach Canossa blieb er konsequent ein Gregorianer, zwang Heinrich IV. – wieder einmal – den beschwerlichen Heimweg diesmal über Kärntens Pässe einzuschlagen, und schloss sich dem Gegenkönig Rudolf von Rheinfelden an.
Heinrichs Vergeltungsschlag ließ nicht lange auf sich warten. Die Salier hatten traditionell eine enge Beziehung zu Bayern, wo sie über mehrere Jahrzehnte hinweg immer wieder die Herzogswürde innehatten. Nachdem Heinrich einen seiner größten Gegner im Investiturstreit, Herzog Welf I., gegen Ende des Jahres 1077 aus Bayern vertrieben hatte, griff der deutsche König zuerst nach der Herzogskrone, um sich dann mit einer angemessenen Bestrafung Gebhards zu befassen, der nach Schwaben geflohen war. Weihnachten feierte der König in der Pfalz Regensburg, wo er sehr wahrscheinlich eine Urkunde für das Stift Frauenchiemsee mit folgendem Inhalt ausstellte: Der König widerruft die Schenkung an das Erzbistum Salzburg und unterstellt die Abtei wieder unmittelbar seiner Herrschaft. In einer Art Rückschau, die einer Bestätigung der langen und ehrwürdigen Geschichte gleichkommt, wird Herzog Tassilo als Gründer des Stiftes genannt, gefolgt von der Auflistung aller Könige von Karl dem Großen bis zu den nun regierenden Saliern, unter deren Schutz und Schirm der Konvent stand und steht.
Am eindrücklichsten ist jedoch noch heute der nun folgende, reuevolle Passus, mit dem der sonst so selbstherrlich agierende Heinrich IV. sein Bedauern ausdrückt, dem Stift durch den Einfluss von schlechten Beratern seine Privilegien genommen zu haben. Der König gesteht vor Gott und der Welt ein, dass er einen Fehler begangen habe und nun wieder zur Besinnung gekommen sei. Mit diesen Worten waren fünfzehn Jahre Fremdbestimmung für das Frauenstift im Chiemsee Geschichte.