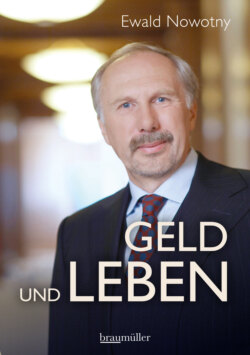Читать книгу Geld und Leben - Ewald Nowotny - Страница 10
3.Mein Weg zur Ökonomie – Vollbeschäftigung und Preisstabilität
ОглавлениеGeboren in Wien im Kriegsjahr 1944, konnte ich die folgenden Jahrzehnte des Friedens und des wachsenden Wohlstandes in Europa erleben. Die Familie meines Vaters hatte sich nach der Liquidierung der familieneigenen Bank zu einer noch immer wohlhabenden, aber wirtschaftlich extrem vorsichtigen „Hofratsfamilie“ entwickelt. Die Familie meiner Mutter war eine Offiziersfamilie. Mein Großvater, der viel älter war als meine Großmutter und den ich nie kennenlernte, wurde als Sohn des Leibarztes von Feldmarschall Radetzky noch in der Festung von Verona geboren, meine Mutter in einer requirierten Villa in Belgrad, wo mein Großvater als Offizier im Ersten Weltkrieg diente. Nach seinem Tod war meine Mutter stets auf Stipendien angewiesen, was zu einer manchmal extrem starken Leistungsorientierung führte, die mich zweifellos auch deutlich beeinflusst hat. Meine Schwester und ich wuchsen in einer Welt der klassischen Bildung und Kultur auf, die geprägt war vom Prinzip „mehr sein als scheinen“ und von Misstrauen gegenüber der Welt der Wirtschaft. Mein früh gewecktes Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge kam von außen und wurde von der Familie zuerst mit Misstrauen, später mit leicht ironischer Toleranz betrachtet.
Entscheidend waren hier zwei Onkel mit sehr unterschiedlicher Lebenserfahrung. Der eine war von extremer Korrektheit, in führender Position in einer internationalen Unternehmensgruppe tätig und wollte mich zu einem Schweizer Banker bestimmen. In diesem Sinn schenkte er mir zu meinem 15. Geburtstag ein Abonnement eines Schweizer Börsendienstes mit dem schönen Namen „Der Zürcher Trend zum Wochenend“. Verbunden war dies mit der Übergabe eines kleinen Aktiendepots, gemeinsam mit dem starken Rat, die darin enthaltenen Nestlé-Aktien nie zu verkaufen – ein Rat, den ich an meinen Sohn weitergegeben habe.
Der andere Onkel war das schwarze, aber eher „goldene“, Schaf der Familie. Seine Mutter entstammte einer sehr reichen Fabrikantenfamilie, er selbst wurde früh ein eher romantischer Linker, kämpfte zeitweise im Spanischen Bürgerkrieg und baute nach dem Zweiten Weltkrieg rasch wieder ein großes Vermögen auf. Er wohnte in einer prächtigen Villa in Döbling, fuhr riesige amerikanische Autos, war aber – wie er mir stets betonte – von der Instabilität des kapitalistischen Systems überzeugt. Dies äußerte sich eigenartigerweise darin, dass er in seiner Villa hinter jedem Bild Wandtresore voller Gold hatte. In der Tat kam es 1971 nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems zu einem massiven Anstieg des Goldpreises. Allerdings hatte mein Onkel nach einer Steuerprüfung bereits 1970 den größten Teil seiner Goldbestände verkaufen müssen – was ihn in seiner Sicht der Ungerechtigkeit des kapitalistischen Systems nur bestärkte.
Beide Onkel hatten je eine Tochter, aber keine Söhne, und wollten mich wohl entsprechend dem Geist der Zeit in ihrem Sinne formen – was ihnen nur in sehr geringem Maß gelang. Denn im Laufe meines Studiums erwachte meine Liebe zur Wissenschaft, und ich habe bei keinem meiner Onkel das geistige und materielle Erbe angetreten. Wohl aber entstand durch diese frühe Exponiertheit gegenüber unterschiedlichen wirtschaftlichen Lebensformen eine Vertrautheit mit interessanten Bereichen des wirtschaftlichen Lebens, insbesondere auch ein lebenslanges Interesse an dem Verfolgen und Interpretieren des Börsengeschehens, das ich stets analytisch hinsichtlich seiner Finanzierungsfunktion und nicht ideologisch betrachtete. Damit ergab sich wohl auch eine gewisse unmittelbare empirische Fundierung, die vielleicht stärker ist als bei manchen meiner Fachkollegen.
Mein nachhaltiges Interesse an gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen entwickelte sich jedenfalls aus politischen, historischen und gesellschaftlichen Perspektiven. Bis heute ist dabei für mich im besonderen Maß die Auseinandersetzung mit dem Faschismus prägend, speziell in seinen schrecklichen Ausprägungen in Österreich. Ich hatte von meinen Eltern schon früh über die Gräuel der Nazi-Zeit erfahren, eine tiefe emotionale Betroffenheit erlebte ich aber vor allem, als ich in den frühen 70er-Jahren in den USA lebte und dort Emigranten aus Österreich traf, die bereit und interessiert waren, einem jungen Österreicher ihre Erfahrungen weiterzugeben.
Meine Mutter war Schülerin eines privaten Mädchen-Gymnasiums gewesen, in dem Mädchen aus Familien der Wiener jüdischen intellektuellen Elite sehr stark vertreten waren. Sie hatte im Jahr 1938 ihren ehemaligen Mitschülerinnen, die sich ja nicht mehr auf die Straße wagen konnten, vielfache Hilfe leisten können, in einem Fall auch eine Verlobung ermöglicht. Viele dieser jungen Frauen haben sich in die USA retten können und waren in den 70er-Jahren, als ich an der Harvard Universität arbeitete, rührend bestrebt, meine Frau und mich einzuladen und zu verwöhnen.
Aus den vielen Gesprächen bei diesen Einladungen sind mir zwei prägende Erfahrungen geblieben. Zum einen: Der Mensch ist nicht gut „von Natur aus“ – er kann sich zum Guten wie zum Schrecklichen entwickeln. Es kommt darauf an, gesellschaftliche Umstände zu schaffen, die das Gute fördern und das Schreckliche bekämpfen. Aus der Kenntnis der Bestialität, die nicht nur in den KZ-Lagern, sondern schon in den schrecklichen Tagen des „Anschlusses“ in Österreich geherrscht hat, bin ich mir bewusst, wie dünn oft die Schicht der Zivilisation und des Anstandes sein kann, mit der – auch heute und weltweit – Gesellschaften leben, und wie wichtig es ist, schon bösen Anfängen zu wehren. Ich erinnere mich noch gut, wie mir bei einem dieser Abendessen mit jüdischen Freunden ein ehemaliger Arzt aus einem Wiener Gemeindebau erzählte, wie ihm im März 1938 eine Horde von Burschen, von denen er viele früher mit großem Einsatz ärztlich betreut hatte, die Fensterscheiben eingeschlagen hatte. Die Mutter eines dieser Burschen kam unmittelbar danach zu ihm, um sich zu entschuldigen, half ihm beim Aufräumen und erklärte, der „Bua“ sei halt in schlechte Gesellschaft geraten und der Vater schon so lang arbeitslos … Manche der jüdischen Freunde, die wir in Amerika getroffen haben, haben sich zu einem späteren Zeitpunkt dann doch entschlossen, Wien wieder zu besuchen, zu dem sie ja emotional doch eine starke Bindung hatten – trotz all der Schrecklichkeiten, die sie dort erlebt hatten. Meine Frau und ich haben diese Freunde dann bei vielen Spaziergängen begleitet und wir konnten das Gefühl mitempfinden, hier unter „normalen Menschen“ zu sein, bei denen man nicht wusste, wie sie oder ihre Verwandten sich in den Jahren der Nazi-Herrschaft verhalten hatten oder verhalten hätten.
Auf einer anderen Ebene habe ich aus den unmittelbaren Berichten über das Nazi-verseuchte Treiben an den österreichischen Universitäten der Zwischenkriegszeit (und der Vorläufer schon früher) gelernt, dass formale Bildung und Kultur kein Schutz gegen Unmenschlichkeit sind. Gerade aus dem intellektuellen Bereich können die Giftschwaden von Nationalismus und Rassismus auf eine gesamte Gesellschaft übergreifen – was in jüngerer Zeit etwa auch beim Zerfall Jugoslawiens tragisch zu beobachten war.
Wie Historiker und Philosophen richtig aufzeigen, haben Totalitarismus und Faschismus für ihr Wirksamwerden jeweils eine Vielzahl von Ursachen. Aber aufgrund vieler Gespräche mit Zeitzeugen und auch aus eigenen Analysen bin ich der Meinung, dass es in Österreich und Deutschland (wie in vielen anderen Staaten) zwar stets den Bazillus des übersteigerten Nationalismus und des Anti-Semitismus gab, dass der schreckliche Ausbruch im 20. Jahrhundert aber nicht erfolgt wäre, hätte es nicht die würgende Not der Weltwirtschaftskrise gegeben. Die Entwicklung der Nazi-Partei in Deutschland und Österreich korrelierte aufs Engste mit der entsetzlichen Entwicklung der Arbeitslosigkeit – und der Unfähigkeit der Wirtschaftspolitik in Deutschland und Österreich, dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Bei den letzten freien Wahlen in Österreich im Jahre 1930, also bei Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, kam die NSDAP nur auf 3 Prozent der Stimmen.8 Mit vollem Wirken der Wirtschaftskrise und gewaltiger Arbeitslosigkeit entstand aber dann bei vielen – nicht bei allen! – die Stimmung, die sich 1938 entlud. Auch in Deutschland war der Aufschwung der Nationalisten eng mit der wirtschaftlichen Notlage und der Unfähigkeit der Regierung, dagegen anzukämpfen, verbunden.9
Politisch noch dramatischer war der Rückgang der Arbeitslosigkeit nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Die expansive Wirtschaftspolitik der Nazis war zweifellos wesentlich durch ihre Kriegsvorbereitungen bestimmt – aus der Sicht der Arbeiterschaft aber bedeutete sie ein Ende von Massenarbeitslosigkeit. Diese expansive Politik war wieder in wesentlichen Teilen dadurch ermöglicht, dass die Deutsche Reichsbank – jedenfalls durch längere Zeit – bereit war, für die autoritäre Diktatur das zu tun, was sie der Republik verweigert hatte – nämlich de facto direkte Notenbank-Finanzierung für den Staat. Für das von Nazi-Deutschland mit wirtschaftlichen Sanktionen belegte Österreich, das weiterhin einer konservativen Finanzpolitik folgte, war in den Jahren vor 1938 der Unterschied zwischen der in Deutschland inzwischen erreichten Vollbeschäftigung und der Massenarbeitslosigkeit in Österreich politisch fatal. Zweifellos gab es eine Vielzahl von Gründen für den Zusammenbruch der Ersten Republik, aber es ist wohl nachvollziehbar, dass für viele Menschen das Beispiel Deutschlands als Ausweg aus existenzieller Hoffnungslosigkeit erschien – speziell auch für die politisch sensible Gruppe junger Männer. Dass nach dem „Anschluss“ die Arbeitslosenrate in kurzer Zeit rapid zurückging – von 22 Prozent im Jahr 1937 auf 12,9 Prozent und dann 3,2 Prozent in den Jahren 1938 und 193910 – trug wohl wesentlich zur raschen Akzeptanz der Nazi-Herrschaft auch im Bereich der Arbeiter und Angestellten bei. Mit zunehmendem Bewusstsein der Kriegsgefahr nahm diese Akzeptanz dann wieder ab – wogegen die NS-Regierung mit ungeheurem Propaganda-Aufwand und brutalem Terror ankämpfte.
Die Bedeutung der wirtschaftlichen Faktoren zeigte sich auch darin, dass eine der ersten Maßnahmen der einrückenden deutschen Truppen darin bestand, die durch eine verfehlte Politik des „harten Schilling“ angehäuften, erheblichen Goldreserven der Oesterreichischen Nationalbank sofort zu beschlagnahmen und den abnehmenden Währungsreserven der Reichsbank zuzuführen. Die dramatische Unfähigkeit der Regierungen in Deutschland und Österreich gegenüber den Folgen der Weltwirtschaftskriese stand in deutlichem Gegensatz etwa zu den Ansätzen eines New Deal in den USA oder der Politik Schwedens. Diese Unfähigkeit war zum Teil erzwungen durch eine kurzsichtige Gläubiger-Diktatur, sie war aber auch verursacht durch dramatisch falsche Ratschläge führender Wirtschaftswissenschafter jener Zeit, wie etwa eines F. A. von Hayek oder der orthodoxen Notenbanker in Österreich wie in anderen Staaten.
Eines der – leider seltenen – Beispiele dafür, dass es auch politisch und gesellschaftlich möglich ist, aus der Geschichte zu lernen, ist die internationale Reaktion auf die Finanzkrise 2007/2008 durch Finanzpolitik und Notenbanken. Die Finanzkrise hatte das Potenzial, sich zu einer neuen Weltwirtschaftskrise zu entwickeln. Ausgangspunkte waren wirtschaftspolitische Fehler, speziell eine überzogene Deregulierung des Bankensektors. Aber in der dann folgenden Krise war der internationale Konsens der Notenbanker, die Fehler der 1930er-Jahre nicht zu wiederholen. In diesem Sinn haben die Notenbanken wohl mitgeholfen, „die Welt zu retten“. Sie waren bereit, die drohende Illiquidität der Weltwirtschaft rasch durch unbegrenzte Kreditvergabe an das Bankensystem zu bekämpfen, und sie verhinderten Zusammenbrüche von Banken – und damit die massiven negativen Kettenreaktionen. Gleiches gilt für den entschlossenen Einsatz der Geld- und Finanzpolitik angesichts des dramatischen Einbruches der Weltwirtschaft im Zuge der Corona-Krise des Jahres 2020.
Ich werde auf diese Entwicklungen in den Kapiteln 13 und 20 noch näher eingehen. Hier möchte ich mich erinnern an ein Gespräch, das ich zu einem späteren Zeitpunkt mit Ben Bernanke, dem damaligen Präsidenten der US-Notenbank, hatte. Ben Bernanke hatte sich schon vor der großen Finanzkrise in einer langen wissenschaftlichen Karriere als Professor der Princeton Universität speziell mit der Krise der 1930er-Jahre beschäftigt. Ich war von Ben Bernanke schon von seiner akademischen Arbeit her sehr beeindruckt, ehe ich ihn auch persönlich kennenlernen konnte. Seine Familie kam aus dem Raum der Österreichisch-Ungarischen Monarchie und in seiner Autobiografie zeigt eines der wenigen Fotos seine Großmutter als junge Ärztin im Wiener Franz-Josef-Spital im Jahr 1918.
In einem der interessanten Gespräche, die ich mit ihm führen konnte, stellte er mir die Frage, wieso in Deutschland die Inflation der 20er-Jahre das grundlegende „wirtschaftliche Trauma“ darstellt, wo doch die Massenarbeitslosigkeit der 1930er-Jahre mit viel dramatischeren wirtschaftlichen und vor allem politischen Folgen verbunden war. Daraus ergibt sich auch der wesentliche wirtschaftspolitische Unterschied in der wirtschaftlichen Grundorientierung zu den USA, wo die wirtschaftliche Katastrophe der 1930er-Jahre das zentrale „Trauma“ darstellt. Eine einfache Antwort auf diese Frage besteht darin, dass die USA eben nie eine so dramatische Inflation erlebten, wie es in Deutschland und Österreich der Fall war. Eine komplexere Perspektive, die sich in diesem Gespräch ergab, betrifft die unterschiedliche soziale Betroffenheit der einzelnen Bevölkerungsgruppen durch Arbeitslosigkeit und Inflation. Speziell die Vernichtung des Geldvermögens des Mittelstandes durch die Hyperinflation hatte ein tiefes Trauma beim – durch die Ausrufung der Republik schon verunsicherten – meinungsbildenden Mittelstand hinterlassen, das dann nach Ende des Zweiten Weltkrieges speziell in Deutschland prägend wurde.
Massive Inflationen sind in der Regel die Folge von Kriegen, speziell von verlorenen. Als in den USA im Konnex des Vietnam-Krieges und der letztlich dadurch verursachten Dollar-Abwertung und Ölpreis-Erhöhung die Inflation Ende der 70er-, Anfang der 80er-Jahre fast zehn Prozent erreichte, erhöhte die amerikanische Notenbank unter ihrem Präsidenten Paul Volcker die Zinsen dramatisch (1981: 14 Prozent) und nach etwa drei Jahren war die Inflation auf 3,7 Prozent zurückgegangen – freilich um den Preis einer, allerdings vorübergehenden, starken Rezession. Aus amerikanischer – und ökonomisch zutreffender – Sicht kann eine Notenbank bei energischem Eingreifen eine überbordende Inflation immer erfolgreich bekämpfen, wobei es Aufgabe der Notenbank in einem demokratischen System ist, die jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Kosten und Nutzen der Inflationsbekämpfung abzuwägen. Dem entspricht auch das „doppelte Mandat“ der US-Notenbank, nämlich die Zielsetzung, Preisstabilität und hohe Beschäftigung zu erreichen. In der Praxis ergibt sich hieraus eine leicht höhere Inflationstoleranz der USA gegenüber dem Euro-Raum – bei gleichzeitig expansiverer Fiskalpolitik und höherem Wachstum der amerikanischen Wirtschaft.
Für Deutschland und Österreich bedeutete die dramatische Inflation nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg den Zusammenbruch der wirtschaftlichen Ordnung und der bürgerlichen Welt. Aber auch hier gilt: Die dramatische Inflation war zwar ein monetäres Phänomen, sie hatte aber politische Ursachen. Zum einen war es im politischen Chaos der Nachkriegszeit nicht möglich, eine dem gesunkenen wirtschaftlichen Produktionspotenzial entsprechende Bewirtschaftung durchzusetzen. Vor allem aber waren die Regierungen in Deutschland und Österreich zur Sicherung der stets gefährdeten politischen Stabilität gezwungen, Gehälter und Sozialhilfen auszuzahlen, die weder durch Steuern, noch durch die Aufnahme von Schulden auf den Kapitalmärkten gedeckt waren.
Am deutlichsten sichtbar wurde das in der dramatischen Entwicklung, die der unmittelbare Auslöser für die schrankenlose Inflation in Deutschland wurde: Im Frühjahr 1923 besetzten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet als Sanktion für Verzögerungen bei der Leistung der – unrealistisch hoch angesetzten – deutschen Reparationszahlungen. Als Gegenreaktion wurde im Ruhrgebiet der Generalstreik ausgerufen. Um diesen Generalstreik am Leben zu erhalten, erklärte sich die deutsche Reichsregierung bereit, die Löhne der Streikenden aus Staatsmitteln weiter zu zahlen. Dies konnte sie nur mittels Finanzierung durch die Notenbank – indem man „Geld druckte“ – und setzte so die sich selbst verstärkende Spirale des wirtschaftlichen Infernos in Gang. In der kollektiven Erinnerung der Deutschen ist nur dieses letztgenannte Phänomen präsent. Es ist aber wohl sinnvoll, auf die tieferen – politischen – Ursachen hinzuweisen.
Zu den politischen Aspekten gehört zweifellos auch der Umstand, dass es durch die massive Inflation nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner gab. Verlierer waren vor allem die bürgerlichen Kreise, deren Vermögen in Staatsanleihen – im Extremfall: Kriegsanleihen – angelegt war, Gewinner waren alle großen Schuldner, das heißt: neben dem Staat große Teile der Industrie und der Landwirtschaft. Es gab demnach zumindest zunächst durchaus politische Interessen gegen ein rasches Eindämmen der Inflation. Für die politisch ebenfalls gewichtigen bürgerlichen Kreise der Akademiker, der Journalisten, der Gewerbetreibenden bewirkte die massive Enteignung durch Inflation aber einen elementaren Vertrauensverlust in die junge Republik und das politische System der Demokratie. Dem entsprach die Forderung nach einer gegenüber dem politischen Geschehen völlig unabhängigen Notenbank mit absoluter Priorität auf Preisstabilität. Das Problem der Arbeitslosigkeit war für diese Teile der Bevölkerung von deutlich geringerer Bedeutung und daher von der Notenbank nicht zu berücksichtigen. Das Ideal konservativer Geldpolitik war der Goldstandard, der ja dann nach dem Ersten Weltkrieg sukzessive von den führenden Notenbanken der Welt wiedereingerichtet wurde. Wie in Kapitel 1 geschildert, hat dieses System wesentlich zur Vertiefung der Weltwirtschaftskrise beigetragen und wurde dann – meist zu spät – endgültig aufgegeben.
Die große Weltwirtschaftskrise ab 1929 traf demnach auf ein politisches Umfeld, das dieser Herausforderung weder wirtschaftswissenschaftlich, noch wirtschaftspolitisch gewachsen war. Hauptbetroffene waren in diesem Fall nicht das Bürgertum, sondern Arbeiter und kleine Angestellte. Der wirtschaftspolitische Gestaltungsspielraum war – sofern man ihn überhaupt nutzen wollte – durch die unter dem Eindruck der Hyperinflation geschaffenen, institutionellen Barrieren massiv eingeschränkt. Damit war die Politik der betroffenen Staaten von einer – teilweise gewollten – Unfähigkeit zu entscheidenden Gegenmaßnahmen bestimmt. In funktionierenden Demokratien wie in den USA und Skandinavien konnten die von der Krise betroffenen Gruppen einen geordneten – wenn auch vielfach bekämpften – politischen Wechsel erreichen. Deutschland und Österreich waren in mehrfacher Hinsicht nicht funktionierende und wirtschaftspolitisch vom Ausland abhängige Staaten. Diese Hilfslosigkeit führte zu einem massiven Vertrauensverlust in die demokratischen Parteien und letztlich – wie oben gezeigt – zum politischen Aufstieg des Nationalsozialismus.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die mit jedem Krieg verbundene Inflation durch rigorose Rationierungsmaßnahmen – mit freilich abnehmender Wirkung – zurückgestaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren dann die den Wiederaufbau tragenden Schichten vom Trauma der großen Inflation bestimmt, das Problem der Arbeitslosigkeit konnte aber durch die keynesianisch inspirierte Politik der Siegermächte entschärft und durch den nachfolgenden Wirtschaftsaufschwung über längere Zeit gelöst werden. Zentraler wirtschaftspolitischer Ankerpunkt war demnach die Schaffung einer unabhängigen Zentralbank mit der alleinigen Aufgabe der Sicherung der Preisstabilität. Das Trauma der großen Inflation sicherte – verstärkt durch kluge Öffentlichkeitsarbeit – der Deutschen Bundesbank eine geradezu mythische Stellung im Gefüge der Bundesrepublik. Damit entstand eine deutlich andere Akzentsetzung als etwa in der Welt der amerikanischen Politik. In Österreich errang die Nationalbank, die stärker sozialpartnerschaftlich gesteuert wurde, diesen „Mythos“ erst ab Mitte der 1970er-Jahre mit der Durchsetzung der „Hartwährungspolitik“, das heißt der Politik eines festen Wechselkurses zwischen Schilling und DM und damit der Aufgabe einer selbständigen Geldpolitik. Das „alte“, eigenständige, österreichische Nationalbank-Gesetz 1984 enthielt jedenfalls bis zur Anpassung an die EZB-Normen im Unterschied zur deutschen Gesetzgebung als Mandat der Notenbank neben der Verpflichtung zur Sicherung der Preisstabilität (§2 Abs. 3) auch die Verpflichtung, bei der Kreditpolitik den „volkswirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung zu tragen“ (§2 Abs. 4), das heißt, auch die Entwicklung des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen.
Bei den Bemühungen um die Gründung der Wirtschafts- und Währungsunion war die zentrale Herausforderung die Frage, ob und wie Deutschland bereit war, die „mythische DM“ zugunsten des Euro aufzugeben. Letztlich wurde diese Frage gegen hinhaltenden Widerstand der Bundesbank politisch entschieden. Um den deutschen Befürchtungen entgegenzukommen, wurde aber jedenfalls die neue Europäische Zentralbank (EZB) bezüglich ihrer rechtlichen Grundlagen und ihrer wirtschaftspolitischen Orientierung nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank gestaltet. Das entsprechende Mandat im Art. 127 des EU-Vertrags (AEUV) lautet demnach: „Das vorrangige Ziel des ESZB (Europäisches System der Zentralbanken) ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten.“ Hinzugefügt ist der folgende Satz: „Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik der Union, um zur Verwirklichung der im Art. 3 festgelegten Ziele der Gemeinschaft beizutragen.“ Zu diesen im Art. 3, EU-Vertrag, festgelegten Zielen gehören die Zielsetzungen „hohes Beschäftigungsniveau“, „beständiges, nicht inflationäres Wachstum“, aber auch entsprechende Aspekte des Umweltschutzes.
Als Notenbanker kann ich mit diesem Mandat gut leben und habe mich ihm immer verpflichtet gefühlt. Nicht zuletzt, weil Preisstabilität nicht nur effiziente wirtschaftliche Planbarkeit bedeutet, sondern auch soziale Risiken gerade für Bezieher kleinerer Einkommen mindern kann. Es hat in der Auslegung des gesetzlichen Mandats immer wieder Diskussionen – auch im EZB-Rat – gegeben, wobei die „orthodoxe“ Bundesbank-Politik dahin geht, dass Preisstabilität ohnedies die Voraussetzung für das Erreichen aller anderen genannten Ziele sei, der letzte Satz daher überflüssig sei.11 In der langen Frist ist dem wohl zuzustimmen, für die kürzere – und oft gerade beschäftigungspolitisch relevante – Sicht kann es freilich erforderlich sein, mit Augenmaß die gesamtwirtschaftlichen Folgen geldpolitischer Maßnahmen mit zu berücksichtigen. Noch viel mehr gilt dies bei Maßnahmen zur Sicherung der Finanzmarktstabilität, im Speziellen zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Banken- und Versicherungssektors einer Volkswirtschaft. Gefährlich ist es aber auch aus meiner Sicht, die Geldpolitik zu überlasten, sie zum „only game in town“ zu machen. Auf diese Problematik wird bei der Diskussion der EZB noch eingegangen werden.
8Gerhard Botz: Nationalismus in Wien: Machtübernahme, Herrschaftssicherung, Radikalisierung 1938/39. Mandelbaum, Wien 2008.
9Vgl. dazu: Tobias Straumann: 1931: Debt, Crisis and the Rise of Hitler. Oxford University Press, Oxford 2019.
10Felix Butschek: Österreichische Wirtschaftsgeschichte – Von der Antike bis zur Gegenwart. Böhlau, Wien 2011.
11Otmar Issing: Der Euro – Geburt, Erfolg, Zukunft. Vahlen, München 2008, S. 56 f.