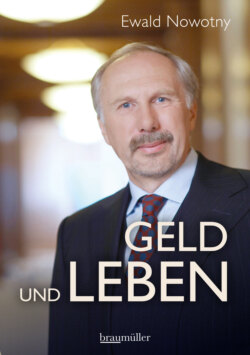Читать книгу Geld und Leben - Ewald Nowotny - Страница 12
5.Gedanken zu Theorie und Praxis
ОглавлениеWirtschaftspolitik – und ganz speziell Geld- und Währungspolitik – ist wesentlich bestimmt von den theoretischen Vorstellungen, die dem Handeln der Akteure (und leider seltener: Akteurinnen) zugrunde liegen. Wobei diesen Akteuren vielfach nicht bewusst ist, auf welchen, ihnen selbst „verborgenen“ Vorstellungen ihr konkretes Handeln beruht. John Maynard Keynes, ein bis heute unerreichtes Beispiel einer produktiven Verbindung von Theorie und Praxis, hat dies zu Ende seiner bahnbrechenden „Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ plastisch formuliert: „Die Gedanken der Ökonomen und Staatsphilosophen, sind sowohl wenn sie im Recht, als wenn sie im Unrecht sind, einflussreicher, als gemeinhin angenommen wird. Die Welt wird in der Tat durch nicht viel anderes beherrscht. Praktiker, die sich ganz frei von intellektuellen Einflüssen glauben, sind gewöhnlich die Sklaven irgendeines verblichenen Ökonomen. Wahnsinnige in hoher Stellung, die Stimmen in der Luft hören, zapfen ihren wilden Irrsinn aus dem, was irgendein akademischer Schreiber ein paar Jahre vorher verfasste. Ich bin überzeugt, dass die Macht erworbener Rechte im Vergleich zum allmählichen Durchringen von Ideen stark übertrieben wird. Diese wirken zwar nicht immer sofort, sondern nach einem gewissen Zeitraum; denn im Bereich der Wirtschaftslehre und der Staatsphilosophie gibt es nicht viele, die nach ihrem fünfundzwanzigsten oder dreißigsten Jahr durch neue Theorien beeinflusst werden, sodass die Ideen, die Staatsbeamte und Politiker und selbst Agitatoren auf die laufenden Ereignisse anwenden, wahrscheinlich nicht die neuesten sind. Aber früher oder später sind es Ideen, und nicht erworbene Rechte, von denen die Gefahr kommt, sei es zum Guten oder zum Bösen.“18
Auch heute gilt, dass wirtschaftspolitisches Handeln oft auf – den Handelnden wohl unbewussten – ökonomischen Theorien beruht, die manchmal vor Hunderten Jahren entwickelt wurden, wie etwa das Verhalten eines amerikanischen Präsidenten zeigt, dessen Betonung des wirtschaftlichen Protektionismus den Ansätzen des im 17. Jahrhundert entwickelten „Merkantilismus“ entspricht. Der Bereich der Geld- und Wirtschaftspolitik ist wohl am engsten und aktuellsten mit der Entwicklung wirtschaftswissenschaftlicher Theorien verbunden. Dies zeigt sich auch daran, dass sämtliche Notenbanken über umfangreiche volkswirtschaftliche Abteilungen verfügen und vielfach auch entsprechende Publikationen herausgeben.
Generell sind die Wirtschaftswissenschaften heute ein inhaltlich und methodisch breit ausgebautes und spezialisiertes Feld der Forschung, Lehre und Anwendung, mit entsprechend großen Differenzierungen. Diese Differenzierungen beruhen im Wesentlichen auf Unterschieden in theoretischen und gesellschaftspolitischen Ausgangslagen. Beispiele sind etwa die Unterschiede zwischen makroökonomisch, das heißt gesamtwirtschaftlich orientierten Vertretern einer „keynesianischen Position“ im Gegensatz zu Vertretern einer stärker mikroökonomisch, das heißt auf Einzelverhalten basierten „Angebots-orientierten“ Ökonomie. Es gibt aber gemeinsame „Denkmodelle“, die in vielen Aspekten gar nicht „spezifisch ökonomisch“ sind, sondern etwa dem „gesunden Hausverstand“, dem „Common Sense“ entsprechen. Gleichzeitig gibt es Beispiele, wo etwa die Sicht der „schwäbischen Hausfrau“ wichtige gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge außer Acht lässt. In vielen Fällen können sich jedenfalls massive Unterschiede im „typischen Herangehen“ von Ökonomen und Nicht-Ökonomen ergeben. Ich habe das in meiner Lebenspraxis, speziell als Wirtschaftspolitiker, vielfach bemerkt und mich bemüht, als Lehrender meine Studentinnen und Studenten auf diese Herausforderungen vorzubereiten. Im Folgenden einige wichtige Beispiele eines „spezifisch ökonomischen Denkens“ und entsprechender wirtschaftspolitischer Perspektiven.