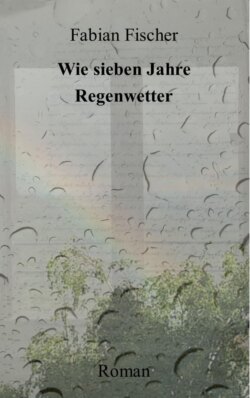Читать книгу Wie sieben Jahre Regenwetter - Fabian Fischer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Birkenweg – 16. Juni 2013
Оглавление»Morgen, hast du gut geschlafen?«
Lorenz stand vor dem Bett und blickte in das verschlafene Gesicht seiner Frau. In der rechten Hand hielt er seine Lieblingstasse, die mit einem großen blauen „L“ auf Vorder- und Rückseite. Aus ihr wehte Paula ein intensiver Geruch frischen Kaffees entgegen.
»Morgen, Schatz! Tief, ja. Aber gut? Ich habe von deiner Mutter geträumt! Beziehungsweise von dem, was sie dir mal gesagt hat. Also das war ein Albtraum, ich sag’s dir.«
Paula machte ein Gesicht, das man irgendwo zwischen drei Tage Regenwetter und »Ich bring dich um!« einordnen musste und schaute zum Wecker auf dem Nachttisch: 8:00 Uhr, Zeit zum Aufstehen. »Wie lange bist du denn schon wach, Lorenz?« Paula warf die Bettdecke zur Seite, setzte sich aufrecht an die Bettkante und schlüpfte in ihre Pantoffeln. »Ich bin auch erst vor zehn Minuten aufgestanden. Meine Mutter? Was hat sie denn gesagt? Und wann?« Lorenz überlegte kurz, was Paula damit meinen könnte, denn seine Mutter pflegte zu Lebzeiten tagein, tagaus sehr viel zu erzählen. »Dein Maul muss man nochmal separat totschlagen, wenn du schon unter der Erde liegst!«, hatte sein Vater oft am Tisch gefrotzelt. Ob er das eigentlich gemacht hat, nachdem sie vor vier Jahren verstorben war? Viel Zeit hatte er ja nicht mehr gehabt, bevor ihn selbst das Zeitliche gesegnet hatte. Falls er das nämlich nicht mehr geschafft hat, müsste das ja noch jemand machen und das wäre dann wohl ich, dachte sich Lorenz weiter. Nicht, dass Mamas Mundwerk schon jahrelang die Totenruhe der armen anderen Leichen stört. Lorenz musste kurz über seinen eigenen Witz schmunzeln, bevor ihm bewusst wurde, wie unangebracht es eigentlich war, über seine toten Eltern zu lachen. Auch wenn die Beziehung zu ihnen nie sonderlich gut gewesen war. Paula hatte kurz aus dem Fenster geschaut und daher nicht gesehen, wie sich Lorenz über seine eigenen Witze gefreut hatte. »Dass sie mich damals komisch fanden und so weiter. Und dir Geld geben wollten, wenn du die Beziehung beendest.« Sie presste dabei ihre Lippen aufeinander und schaute zu Lorenz rüber. »Oh weh, das. Wieso träumst du denn davon? Das ist doch dreißig Jahre her! Vergiss es doch bitte einfach mal.« Lorenz hatte ihr damals von der Aktion seiner Eltern erzählt, weil er ihr stets ehrlich gegenüber sein wollte. Er hatte allerdings nicht bedacht, was das in ihr auslösen würde. In den vergangenen Jahrzehnten hatten sie das Thema immer mal wieder besprochen. Jedes Mal hoffte Lorenz, dass es nun das letzte Mal gewesen wäre und sie es abhaken konnte. Jedes Mal wurde er aber eines Besseren belehrt. »So leicht verarbeitet man sowas auch nicht, Lorenz«, hatte ihm dann Paula in einem früheren Gespräch klargemacht. Und sich dann, unbemerkt für die Umstehenden und auch sich selbst, in den kommenden Monaten und Jahren immer mehr zurückgezogen. Ihr Temperament und ihr eher auffälliger Kleidungsstil hatten sich sukzessive ins Langweilige, Biedere gewandelt. »Ja, das sagt sich so leicht. Ach egal. Hast du mehr Kaffee gemacht? Dann stehe ich jetzt auch wirklich auf.« Mit einer kurzen Handbewegung wischte Paula das Thema in Richtung Wohnungstür und damit in Richtung Friedhof, wo ihre ungeliebten Schwiegereltern lagen. Aber komisch ist das schon, dass ich gerade heute Nacht davon geträumt habe. Das letzte Mal, dass ich wirklich aktiv darüber nachgedacht habe, muss zehn Jahre oder länger her sein, dachte sie sich noch, um dann das Thema auch wirklich beiseite zu schieben. »Du, ich weiß ja, dass das eine scheiß Aktion meiner Eltern war. Das haben sie doch aber irgendwann selbst eingesehen und sich dafür bei mir entschuldigt. Ich habe eine ganze Kanne vollgemacht. Warte, ich hole dir eine Tasse.« Eingesehen, dachte sich Paula. Eher haben sie gesehen, dass Magda, obwohl sie aus feinem Hause kam, sich ganz und gar nicht fein benommen hatte. »Maria Magdalena war nichts gegen Magda«, hieß es damals in vielen Freundeskreisen, manchmal ehrfürchtig, meistens aber abwertend gemeint. Passenderweise lief zu der Zeit der Hit von Sandra im Radio und auf Feiern rauf und runter. So bekam für Paula die Songzeile (I’ll never be) Maria Magdalena eine ganz andere Bedeutung. „Matratzen-Magda“ hatte es auch für zwei Tage an der einen Wand bei der Feuerwehr gestanden, in einem gesprayten Warnschild mit zwei großen Brüsten an der Unterkante. Es war einerseits lustig, andererseits aber auch gemein und beschämend. Und jeder in der Stadt lief daran vorbei und damit verbreitete sich auch das Gerede über Magda. In Schutz genommen hatte sie damals niemand. Sie wurde dann von ihren Eltern auf ein katholisches Internat im Westerwald gesteckt, was aber ihres Wissens auch nichts gebracht hatte: sie wurde schon in ihrer Schulzeit schwanger, der Vater des Kindes blieb unbekannt. Hatte sie einen Abschluss gemacht? Da variierte das Wissen der ganzen Klatschbasen im Ort. Mittlerweile lebte sie wohl auch wieder in der Stadt, das hatte Paula des Öfteren gehört. Ohne fertige Ausbildung, ohne wirkliche Familie. Ihr Kind hatte sie in eine Pflegefamilie gegeben. Ihre Eltern müssen wahnsinnig stolz auf sie gewesen sein. Genau diese Entwicklung war auch der Grund gewesen, warum Lorenz‘ Eltern irgendwann zur Besinnung gekommen waren. Definitiv nicht mein Bier, beruhigte sich Paula wieder. Sie ärgerte es aber trotzdem, dass ihre Schwiegereltern ihre Beziehung torpedieren wollten, weil sie eine andere Frau für passender hielten. Das hatte natürlich dazu geführt, dass sie ihren Schwiegereltern immer ablehnend gegenüberstand. Und auch Sepp und Marta, die grundsätzlich mit jedem irgendwie auskamen, wurden mit Lorenz‘ Eltern nie so wirklich warm. Familienfeiern in diesen Konstellationen verblieben sehr oberflächlich und alkoholreich. Mit diesem Gedanken schloss Paula aber auch wirklich das Thema für heute ab. Sie summte gerade die Melodie von „Maria Magdalena“ und schaute dabei aus dem Fenster, als sie in den Thujabäumen links im Garten etwas erblickte. »Lorenz! Komm schnell her, da ist jemand in unserem Garten! Ist das der Papa? Was macht der da im Gebüsch?« Paula machte einen Satz nach rechts und drückte ihr Gesicht an die Scheibe, um mehr vom Garten einzusehen. Aus dem neuen Winkel konnte sie trotzdem nur zwei Beine erkennen. Allerdings war das nicht ihr Vater, da war sie sich sicher. Er besaß nicht so eine Hose und war auf jeden Fall größer. Und warum sollte er dort so komisch auf- und abgehen? »Nein, das ist nicht Papa. Sondern irgendjemand anderes!« Sie wurde etwas schriller im Ton und übertrug den Anflug an Hysterie auf Lorenz. »Was? Moment, ich zieh mir nur schnell Schuhe an und dann schau ich runter. Bleib du hier!« Lorenz stellte seine Tasse auf die Anrichte und eilte ins Treppenhaus. »Pass bitte auf, ich weiß nicht, wer das sein soll. Warte, ich komme mit.« Auch sie stellte ihre Kaffeetasse auf den Tisch und packte noch schnell ihr Handy in die Hosentasche. Lorenz war bereits an der Haustür angekommen. Er rannte zu den Thujabäumen an der Grenze zum Nachbargrundstück, verlangsamte dann seinen Schritt und räusperte sich etwas. Dann rief er in Richtung der zwei sichtbaren Beine: »Hallo? Stopp! Kommen Sie raus aus dem Gebüsch, Sie haben hier nichts zu suchen. Sonst ruft meine Frau die Polizei.« Er schaute zu Paula rüber, die mit beiden Händen ihr Handy umklammerte und ihm zunickte. Sie war bereit, die 110 zu wählen.
Paula und Lorenz waren hier etwas sensibilisiert, nachdem zwei betrunkene Jugendliche vor fünf Jahren über die Friedhofsmauer in ihren Garten geklettert waren und diesen trotz mehrerer Gesprächsanläufe partout nicht verlassen wollten.
Schließlich waren sie sogar ausfällig und aggressiv geworden. Der eine hatte in seine Tasche gegriffen und ein Messer rausgeholt.
Allerdings kam er nicht mehr dazu, es gegen Paula oder Lorenz einzusetzen, da auf einmal drei Polizisten aus der Einfahrt stürmten und die beiden mit gezogener Waffe festnahmen.
Marta hatte die Situation zehn Minuten lang hinter den Gardinen in der Küche verfolgt und sich dann dazu entschieden, die Polizei zu rufen.
»Sicher ist sicher«, hatte sie später zu ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn gesagt.
»Es passiert viel Schlechtes auf der Welt.«
Wie sich später herausgestellt hatte, wurden die beiden Jugendlichen schon gesucht, da sie in den vergangenen Tagen eine Tankstelle überfallen und eine junge Mutter mit einem Messer bedroht hatten.
Dass es glücklicherweise nicht zu einem Unglück gekommen war, lag daran, dass just in dem Moment zwei Spaziergänger mit ihrem Rottweiler um die Ecke gekommen waren und diesen geistesgegenwärtig auf die beiden Halbstarken gehetzt hatten.
In der Zeitung stand am nächsten Morgen, dass sie wohl schon länger als eine Woche auf dem Friedhof in einem aufgebrochenen Mausoleum gelebt haben mussten. Das Mausoleum stand in einer stark bewachsenen und abgeschiedenen Ecke und fand daher nicht viel Beachtung der Friedhofsbesucher.
Das Thema wurde auch noch Jahre danach gerne von den Anwohnern diskutiert.
Viele davon, darunter Karl und Frau Schappert, verschwiegen dabei aber, dass sie selbst vor der Festnahme der Jugendlichen zahlreiche Gerüchte in Umlauf gesetzt hatten.
Die gängigste Behauptung war die, dass die beiden Jugendlichen »ganz sicher« aus dem Wohnblock ein paar Straßen weiter kommen würden.
Dieser Wohnblock, ein trister Bau aus den 50er Jahren, wurde von vielen Menschen mit Migrationshintergrund bewohnt und platzte aus allen Nähten. Oft stand die Polizei vor dem Gebäude, um kleinere Streitigkeiten aufzulösen. Bezogen auf die Masse an Bewohnern kam das nicht viel öfter vor als in den guten Vierteln. Nur wurden die Polizisten öfter zum Wohnblock geschickt, was dem Ganzen natürlich mehr Aufmerksamkeit brachte. Die Besitzerin des Wohnblocks versuchte schon seit Jahren mehr oder weniger erfolglos, die aktuellen Mieter aus dem Block zu drängen, um eine geplante Luxussanierung voranzutreiben. So kam es schon mal vor, dass der Strom ohne vorherige Information tagelang abgestellt wurde. Oder dass spontane Fassadenarbeiten an Wochenenden im Sommer die Bewohner dazu zwangen, von ihren kleinen Balkonen in die aufgeheizten Wohnungen zu flüchten. Diese Machenschaften waren jedem bekannt. Es kümmerte allerdings niemanden, sodass die Besitzerin unbeschadet davonkam. Die festgenommenen Jugendlichen kamen jedenfalls nicht aus dem migrantisch geprägten Wohnblock, sondern aus gutbürgerlichen Haushalten am Waldrand. Paula hatte sich damals beim Mittagessen mit der Familie sehr geärgert, dass diese Zusatzinformationen von der örtlichen Zeitung nicht aufgegriffen wurden. Denn das führte auch Jahre danach zu Situationen, in denen sie von Nachbarn auf die damaligen Angriffe »durch Migranten« angesprochen wurden, was Paula immer mühsam entkräften und widerlegen musste. Auch zwei wütende Briefe an die Redaktion hatten nicht zu einer Klarstellung geführt. Letztendlich mündete es darin, dass Paula ihr Abo kündigte und seitdem daran arbeitete, dass sich auch ihre Eltern anderen, seriöseren Informationsmedien zuwendeten. »Polizei? Wieso du rufen Polizei? Ich will Ball nur.« Die zwei Beine bewegten sich in Richtung Lorenz, die Äste der beiden Thujas wurden zur Seite gedrückt und aus dem Gebüsch heraus trat ein kleiner Junge mit braunen wuscheligen Haaren und großen Augen. »Was? Wer bist du denn? Was machst du? Ach so, du holst nur deinen Ball. Ja okay, das geht natürlich in Ordnung.« Lorenz atmete kurz durch, schaute zu Paula und zeigte ihr mit einem Daumen nach oben, dass die Situation unter Kontrolle sei. Dann richtete er seinen Blick wieder zum Jungen: »Bist du von nebenan? Normalerweise klingelt man an der Tür und bittet dann die Gartenbesitzer, den Ball zu holen. Oder man fragt um Erlaubnis, in den Garten zu gehen. Und geht nicht einfach rein, das ist nämlich Hausfriedensbruch. Weißt du denn nicht, ... Ach egal, das verstehst du wahrscheinlich nicht.« »Shu?« Der kleine Junge schaute Lorenz fragend an. Er war überall voller Erde und Äste, einen Ball hielt er aber nicht in der Hand. Shu war Arabisch und gleichbedeutend mit Häh? oder Was?, das wusste Lorenz von seinem Kollegen Hussein. Der war zwar schon 15 Jahre in der Firma und sprach fließend Deutsch. Aber wenn er gerade an etwas dachte und dann von jemandem aus seinen Gedanken gerissen wurde, entsprang ihm stets ein »Shu?«, was seine Kollegen wahnsinnig lustig fanden. »Ja, ist schon in Ordnung, alles gut. Wie heißt du? Ich bin Lorenz. Lorenz Hartmann und das da hinten ist meine Frau, Paula. Bist du von nebenan?« »Hallo, ich bim ... ich bin Rakan. Ich sieben Jahre Alter.« Der Junge ging noch etwas mehr auf Lorenz zu und streckte ihm seine rechte Hand entgegen. Lorenz musste grinsen. »Du bist sieben Jahre alt. Nicht Alter.« In seiner rechten Hand hielt Lorenz noch immer den Hausschlüssel fest umklammert. Daher streckte er Rakan seine freie linke Hand hin. Plötzlich ging alles sehr schnell: Rakan schnaubte kurz, schlug Lorenz seine ausgestreckte Hand weg und rannte davon. Lorenz, völlig perplex von der Situation, schaute Rakan nur nach, wie er erst in die Einfahrt rannte und dann auf dem Nachbargrundstück verschwand. »Hey! Und dein Ball? Was soll das denn?« Er war ganz irritiert, schaute kurz auf seine Hand, blickte zu Paula, die die Situation staunend verfolgt hatte und schüttelte seinen Kopf. »Na sowas, wie unerzogen.« Dann besann er sich wieder, warum Rakan überhaupt auf ihrem Grundstück gewesen war. In zwei Metern Höhe lag ein weißer, nicht mehr ganz so runder Fußball. Unerreichbar für Rakan, aber ein Kinderspiel für Lorenz. Er griff nach ihm, betrachtete ihn kurz und ging dann in Richtung Einfahrt. Er blickte zum Nachbarhaus und überlegte, ob er hinübergehen und klingen sollte. Mit Blick auf seinen Pyjama, den er noch trug und auch mit einer leichten Verärgerung über Rakans Reaktion entschied er sich aber dagegen und warf den Ball mit einem größeren Schwung aufs Nachbargrundstück. Dann ging er wieder zurück ins Haus. Paula war bereits in der Wohnung und hatte begonnen, das Frühstück vorzubereiten. »Seltsam«, sagte Lorenz. »Ne, nicht seltsam, frech war das! Hast du gesehen, wie der Kleine meine Hand weggeschlagen hat und dann davongerannt ist? Was sollte das denn?« »Ja, komisch. Was hast du ihm denn gesagt? Vielleicht wollte er dir lieber High five gegeben?« Paula hatte zu weit vom Ort des Geschehens gestanden, um alles mithören zu können. »Nein, er hat dagegen geschlagen. Von sich weggeschlagen. Dabei hat er doch seine Hand hingehalten, um mich zu begrüßen. Und ich habe es dann erwidert. Echt merkwürdig.« Lorenz grübelte weiter, während er sich zwei Scheiben frisch geschnittenes Bauernbrot auf den Teller lud. »Vielleicht hast du ihn mit irgendwas verschreckt? Du weißt ja nie, was Kinder so denken.« Paula nahm das Käsemesser in die Hand und schnitt sorgfältig die Rinde ab. Frühstück war ihr wichtig, fast schon heilig. Das konnte man an der Qualität, aber noch mehr an der schieren Masse an Essen sehen: Butter, Frischkäse, diverse Aufstriche, Marmeladen aus eigener Herstellung – mit Obst aus dem Garten, selbstredend – eine breite Palette an Aufschnitt und Käse. Dazu Brot, Brötchen und Brezeln. Im letzten Jahrzehnt hatte sich die Frühstückslust auch auf Paulas Körper ausgewirkt, woran sie, für alle unbemerkt, sehr knabberte. »Das Erste, was man als Nachkriegskind beigebracht bekommt, ist es, viel zu viel auf den Tisch zu packen«, hatte ihre Tochter Katharina immer gefrotzelt, wenn sie bei ihren Eltern zu Besuch war. Ein Scherz mit einem wahren Kern, das wusste jeder in der Familie. Katharina war 23 Jahre alt und lebte seit gut drei Jahren in Frankfurt am Main. Glücklich über die größere Anonymität einerseits und über das reichhaltige Angebot an Restaurants, Bars und Kulturstätten andererseits. Eine sehr ordentliche, minimalistisch lebende Person. Und sehr fakten- und evidenzbasiert, was sich auch an der Wahl ihres Chemiestudiums zeigte. »Man kann alles messen und beweisen, wenn es existiert. Und wenn man es nicht messen und beweisen kann, muss die Existenz des zur Diskussion stehenden Themas angezweifelt werden! Dann braucht mir auch keiner mit so einem ›Ich fühle mich aber so und so‹ kommen«, pflegte sie oft gebetsmühlenartig zu sagen. Auf Fremde wirkte das zunächst sehr arrogant und alles andere als empathisch. Wenn man Katharina aber mal besser kennengelernt hatte, konnte man mit ihrer Sichtweise gut umgehen. Und man spürte auch, dass sie in ihrem Innern keineswegs die kühle und abgeklärte Person war, die sie vorgab, zu sein. Ihr Bruder Jan, 19 Jahre alt, hatte vor einem knappen halben Jahr den Auszug aus dem Elternhaus vollzogen. Direkt nach dem Abitur war er mit einem Freund sechs Monate lang durch die Welt gereist und hatte dann sein Lehramtsstudium in Würzburg begonnen. Geschichte und Germanistik, Gymnasialstufe. Im Gegensatz zu seiner Schwester war Jan eher kreativ und extrovertiert. Er diskutierte gerne über alles lautstark und er nahm auch Dinge ernst, wenn sie für andere Personen auf einer emotionalen Ebene wichtig waren. Beide würden am Wochenende vorbeikommen, denn der Geburtstag ihres Vaters stand bevor und sie wollten ihn mit einem kleinen Gartenfest überraschen. Darauf freute sich Paula schon. Sie hatte eine wunderbare Familie, das war ihr bewusst. Leicht verschroben und alle ziemlich unterschiedlich. Aber genau das finde ich einfach nur toll. Während sie sich eine dicke Lage Butter auf das Brot schmierte, vernahm ihre Nase einen leichten Geruch von Tabak. Das muss von draußen kommen, bei uns raucht doch niemand. Sie blickte in Richtung Fenster: es war gekippt. Der Geruch muss vom Nachbarhaus kommen. Sie atmete normal aus und wieder ein, diesmal aber bewusster und tiefer. Das ist kein normaler Tabak, nicht so ein stinkiger. Das riecht man manchmal auch in der Stadt, bei diesen Shisha-Bars. Mmmh, schlecht riecht das nicht. Wie eine Obstwiese oder so. Paulas Sinne schienen etwas geschärft zu sein: Sie hörte zunächst das Weinen und Schluchzen von einem Kind und vernahm dann ganz leise Musik. Das ist aber keine Melodie, die man im Radio hören würde. Aber es klingt schön! Paula verschwand gedanklich in einer Welt aus Tausendundeiner Nacht. Sie saß auf einmal in einem Innenhof voller Brunnen und Orangenbäume. Es roch nach Weihrauch, Kaffee und Nüssen. Die ganze Szenerie war bunt, überladen. Sie blickte an sich herunter. Was trage ich denn da? Sie musste träumen, denn solche Kleidung würde sie eigentlich nie anziehen. Aber seltsamerweise störte sie es auch nicht. Die Kombination aus Grün, Rot und Blau gefiel ihr eigentlich sehr gut. Dann horchte sie auf. Sang da jemand ein Lied? »Schrecklich, dieser Gestank. Da bekommt man ja Kopfweh!« Paula hatte noch immer die Augen geschlossen und konzentrierte sich darauf, dem Lied weiter zu lauschen. Daher hatte sie nicht mitbekommen, wie Lorenz vom Tisch aufgestanden war und das Fenster wieder geschlossen hatte. Schließlich wurde das Lied immer leiser, bis sie gar nichts mehr hörte. Und auch der Geruch wurde weniger intensiv. Paula verschwand wieder aus dem Innenhof voller Brunnen und Räucheröfen. Sie saß nun wieder an ihrem Esstisch und schaute sich um. Dann blickte sie an sich herab: Kein Grün, kein Rot, kein Blau. Sie trug einen braunen knielangen Rock und ein dunkelgraues Shirt. »Also mir hat’s gefallen«, erwiderte sie leicht trotzig und griff zur selbstgemachten Marillenmarmelade. Lorenz schüttelte vehement den Kopf. »Ne ne, das ist ja wie in der Kirche mit dem ganzen Weihrauch. Und ungesund ist es auch. Und dann noch dieses Gejaule dazu. Da höre ich lieber so Deutschpop.« Paula war nun wieder im Hier und Jetzt angekommen. Schade, dachte sie sich. Das war irgendwie schön.