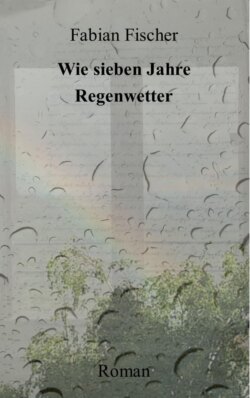Читать книгу Wie sieben Jahre Regenwetter - Fabian Fischer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Birkenweg – 15. Juni 2013
Оглавление»Guten Morgen, Mama. Ich habe dir das Bauernbrot vom Schneeg mitgebracht, sie hatten aber nur noch ein kleines. Und euren Camembert habe ich gestern aus Versehen hochgenommen, den Rest habe ich in euren Kühlschrank zurückgelegt. Wo ist der Papa, schon im Garten?«
Paula öffnete den Kühlschrank und nahm sich die Butter heraus. Dabei fiel ihr Blick zunächst auf den halbleeren Bierkasten am Boden.
Sie überlegte kurz, ob sie etwas sagen sollte. Dann schüttelte sie aber leicht und fast nicht sichtbar mit dem Kopf und schaute aus dem geschlossenen Fenster. Im hinteren Teil des Gartens erblickte sie ihren Vater, der gerade mit einem Spaten hantierte.
Während Marta das Brot in dicke Scheiben schnitt, erwiderte sie:
»Na sicher, er wollte heute die Tomaten einbuddeln und die Radieschen aussäen und da muss er noch einiges vorbereiten. Du kannst ihm ja helfen. Wobei, so wie du aussiehst, hast du wohl noch was vor. Ist das eine neue Hose? Du hast doch schon so eine. Gehst du noch wo hin? Arbeiten musst du am Samstag ja hoffentlich nicht. Vielleicht hat ja Lorenz Zeit, deinem Vater zu helfen?«
Paula reagierte zunächst nicht auf den ganzen Fragenkatalog ihrer Mutter, sondern schaute weiter aus dem Fenster:
Der Garten war voller Bäume und Blumen, hier ein sattes Grün der Lavendelbüsche, dort ein leuchtendes Pink der Pfingstrosen und überall, in unzähligen Blumenkästen: ein knalliges Rot. Geranien waren die Lieblingspflanzen ihres Vaters und das war definitiv nicht zu übersehen.
Während die Gärten der Nachbarn eher aus Lavagranulat, Buchsbäumen und einer sterilen Standardlaube vom Baumarkt bestanden, wirkte der Familiengarten wie ein schillerndes und farbenfrohes Paradies.
Das fand sie immer toll, schon von Kindesbeinen an.
Und nachdem ihr Vater in den Ruhestand gegangen war, hatte er sich noch mehr in die Gartenarbeit gestürzt. Seine einzigen Begrenzungen sind die Hauswand vorne, die Friedhofsmauer hinten und die Thujabäume zu den Nachbarn, dachte sich Paula. Wenn er könnte, würde er wahrscheinlich auch bei den Nachbarn aktiv werden und denen ein bisschen die Sterilität nehmen. Wobei, Paulas Blick schwenkte nach links, bei den alten Kisselbachs sieht es mittlerweile echt wüst aus. Aber gut, sie sind ja auch schon vor drei Jahren gestorben, da holt sich die Natur eben auch einiges zurück. Das nennt man wohl Schicksal. »Nein, wir können leider nicht helfen, wir fahren gleich ins Einkaufszentrum. Ich muss zur Schneiderei und Lorenz will im Media Markt eine neue Digitalkamera kaufen. Die Hose? Das ist keine neue. Das ist die, die du meinst. Nur 14,99 Euro, da kann man echt nichts sagen. Und das Beste daran ist, dass da viel Stretch verarbeitet wurde. Sieht man aber gar nicht, oder?« Paula wandte ihren Blick vom Garten ab und schaute zu ihrer Mutter. Diese war gerade damit fertig geworden, das Roggenmischbrot in dicke Scheiben zu schneiden. »Ach so, ja dann ist das wohl dieselbe Hose. Nein, das sieht man nicht mit dem Stretch.« Schon wieder eine neue Kamera? »Seid ihr dann gegen 13 Uhr wieder zurück? Ich koche Hackfleischgulasch.« »Ja, das schaffen wir. Sollen wir noch was aus der Stadt mitbringen?« Paula überlegte kurz, ob sie ihre Mutter – wie so oft – darauf hinweisen sollte, dass es kein Gericht namens Hackfleischgulasch gab. Das ist eine leckere, aber stinknormale Bolognese. Wie kommt sie darauf, es Gulasch zu nennen? Sie dachte an einen Moment in ihrer Schulzeit zurück. In der Pause hatte sie mit ihrer damaligen besten Freundin Renate Bilder von Hackfleischgulasch gemalt: Durchgewolftes Fleisch in Blockform, das war durch den Einsatz unterschiedlicher Buntstifte in Braun allein schwer darzustellen. Aber es gibt ja eine Reihe lustiger Begriffe in meiner Familie, die manch anderer nicht versteht, also was soll’s. »Nein, danke, wir haben alles. Wir sind alt, was sollten wir also noch brauchen?« Marta dachte kurz an die Kamera und überlegte, ob sie nach der Notwendigkeit des Neukaufs fragen sollte. Eine Sekunde später schob sie den Gedanken aber beiseite und wechselte das Thema: »Ach so, weißt du, ob jemand nebenan einzieht? Gestern haben dein Vater und ich vor dem Haus von Kisselbachs einen Laster gesehen, aber es hat so viel geregnet, dass ich nichts erkennen konnte. Und Karl meinte vorher schon zu mir, dass das Haus verkauft worden sei. Weißt du da mehr?« »Nein, keine Ahnung.« Paula dachte kurz nach und fand es irgendwie lustig, dass sie gerade erst an die alten Kisselbachs und ihren Garten gedacht hatte. »Wir haben gestern Abend Wer wird Millionär geschaut und sind dann ins Bett. Aber ganz ehrlich, woher sollte ich auch wissen, was hier so passiert? So, wie der Garten aussieht, wäre es gar nicht so schlecht, wenn da mal wieder etwas Leben einzöge. Wir müssen nun los. Bis später, Mama.« »Bis später, Paula«. Paula verließ das Haus und lief ans Ende der Ausfahrt. Dort stand ihre Familienkutsche und ihr Mann Lorenz saß bereits ungeduldig drin. Nachdem sie den Birkenweg verlassen hatten und auf die Umgehungsstraße Richtung Einkaufszentrum gefahren waren, fragte sie: »Mama hat mir eben erzählt, dass gestern wohl Leute ins Haus der Kisselbachs eingezogen wären. Hast du da was mitbekommen?« Lorenz bog um die Ecke. »Hm ... Ich war um 1 Uhr kurz auf dem Klo und habe draußen laute Stimmen gehört. Habe schon überlegt, ob ich rausgehe und mich beschwere, aber nachdem ich fertig gepinkelt hatte, war es schon wieder still.« Paula fragte sich, wieso sie durch die lauten Stimmen dann nicht wach geworden war, denn eigentlich war sie doch die mit dem leichten Schlaf. Sie drehte ihren Kopf zum Fahrersitz und musterte ihren Mann. Aber gut, Lorenz ist auch nicht mehr der Jüngste und wenn die Blase drückt, drückt sie. Allerdings stimmt es, dass Männer mit zunehmendem Alter noch attraktiver werden. Mit seinen graumelierten Schläfen sieht er nicht mehr nach Sportschüler, sondern Sportlehrer aus. Aber so langsam zeigt sich auch bei ihm ein kleines Bäuchlein. Dann bin ich endlich nicht mehr die einzige, die ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen hat. »Na ja, okay, egal. Vielleicht stellen sie sich uns ja vor, wenn es soweit ist. Wäre doch klasse, wenn hier nette Leute in unserem Alter wohnen würden. Hier sind ja echt nur komische oder alte Menschen und das ist auch absehbar, wie lange das noch so sein wird. Und dann sind wir am Ende in dem Nest allein. Du kannst mich da vorne rauslassen, dann komme ich in einer Stunde zum Media Markt. Passt doch zeitlich, oder? Wobei, lass uns lieber in eineinhalb Stunden sagen, ich muss nämlich noch zum Friseur.« Lorenz wollte schon seinen Mund öffnen, da fuhr Paula fort: »Keine Sorge, ich muss nur einen Termin ausmachen. Sobald sich meine Haare kräuseln, sind sie einfach zu lang. Und das Grau schimmert auch schon durch, das gefällt mir nicht.« Damit schnallte sich Paula ab und zog am Türgriff. »Halt, warte doch, bis ich angehalten habe! Ja, das passt. Ich habe ja schon online nach der Kamera geschaut, die ich möchte. Laut Website ist sie verfügbar, das sollte also schnell gehen. Und ich finde, dass dir so leicht graue Haare stehen. Aber mach, wie du magst. Bis später, Schatz.«
»Hallo, der Herr. Möchten Sie sich in unserer Liste eintragen und etwas für die Mittelmeerbrücke spenden?«
Lorenz hatte gerade das Einkaufszentrum betreten, als er von zwei alternativ gekleideten Jugendlichen angesprochen wurde.
»Hallo, ihr beiden. Mittelmeerbrücke? Was ist das? Seid ihr von Amnesty International? Oder Greenpeace?«
Er schaute dem einen Jungen direkt in die Augen.
Als dieser nicht antwortete, sondern nur verdutzt zurückschaute, blickte Lorenz zum Stand rüber.
Dort standen drei weitere Jugendliche und versuchten aufgeregt, Besucher von ihrer Sache zu überzeugen.
Allerdings entdeckte Lorenz keinen Hinweis auf Amnesty oder Greenpeace. Die Frage hättest du Schlaumeier dir eigentlich auch sparen können, dachte er und schaute wieder zu den beiden Aktivisten vor sich. »Nee, wir sind von MigrAction e.V. und wir sammeln Geld für zwei Kapitäne, die mit ihren Schiffen ehrenamtlich aufs Meer fahren und in Not geratene Flüchtlinge retten. Wir sind recht klein, aber dafür geht das meiste Geld auch nicht für die Verwaltung drauf.« Der Junge ratterte noch viele weitere Informationen runter, griff währenddessen tief in seine Umhängetasche und holte einen leicht verkrumpelten Flyer heraus. Mit einem müden, aber ehrlichen Lächeln hielt er ihn Lorenz hin, dessen Gedanken schnell zwischen Renn weg! und Nimm den blöden Flyer! hin und her rasten. Er entschied sich für letztere Option. Dabei bemühte er sich, interessiert zu wirken und murmelte den beiden zu, dass er jetzt noch was zu erledigen hätte, aber später wiederkommen würde. Lorenz wusste in seinem tiefsten Innern, dass die große Mehrheit derjenigen, die einen Flyer mitnahmen, sich dieser oder einer ähnlichen Ausrede bedienten. Und in den Augen des Jugendlichen konnte er beinahe die Worte Ich weiß, dass du lügst lesen. Daher bemühte er sich noch um ein verkrampftes Lächeln und der Jugendliche tat es ihm gleich. »Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir stehen hier, falls Sie weitere Fragen haben. Auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen«, entgegnete Lorenz und tat beim Weggehen so, als würde er den Flyer interessiert studieren. Er bog um die Ecke und schaute gleich nach einem Mülleimer, um das Papier direkt zu entsorgen. Da er aber keinen auf die Schnelle fand, packte er den Flyer in seine Jackentasche und ging in Richtung Media Markt.
»Hallo, Mama, gibt’s schon Essen? Es hat schon so gut gerochen, als ich die Haustür geöffnet habe.«
Paula stellte die Tasche mit den Hosen aus der Änderungsschneiderei auf den Boden und zog ihre Jacke aus.
Da die Garderobe mit den drei Jacken ihrer Eltern schon voll war, schmiss sie sie über die Lehne des Küchenstuhls.
»Hallo, Paula. Nein, es muss noch etwas einkochen. Ich denke mal, dass wir in 15 Minuten essen können. Wollt ihr Nudeln oder Brot dazu?«
Marta liebte es, das Bauernbrot von Bäcker Schneeg in die Soße zu tunken. Damit konnte man den Teller fast schon sauber wischen. Wobei, haben wir überhaupt noch so viel Brot? Sepp hat heute früh ordentlich zugelangt, kein Wunder bei der ganzen Gartenarbeit. Und seitdem der Schneeg hier zugemacht hat, kann ich nicht so einfach los und schnell ein neues Brot kaufen. »Nudeln, ganz klar. Brot und Bolognese, ich meine Hackfleischgulasch, das mögt glaube ich nur ihr. Wisst ihr schon mehr, wer nebenan eingezogen ist?« »Nicht wirklich«, erwiderte Marta und ihre Stirn wurde dabei leicht runzelig. »Ich habe gelernt, mich nicht zu sehr in Sachen reinzustecken. Der Karl weiß bald sicher mehr. Oder die Schappert von gegenüber. Die tratscht gerne.« »Ja, genau. Und ihr nicht, was? Du hast mich doch vorhin gefragt, ob ich weiß, wer da einzieht. Du und Papa, ihr tratscht selber gerne. Ich gehe noch kurz in den Keller, soll ich Wasser und Apfelsaft mitbringen?« »Tratschen? Das ist doch gar nicht wahr. Ja, gerne Apfelsaft. Und ein oder besser zwei Bier für deinen Vater. Die hier im Kasten sind warm und der Kühlschrank ist voll mit Essen.« »Puh, das mit dem Trinken wird im Alter auch nicht aufhören, was?« Paula überlegte, wann ihr Vater zuletzt kein Bier getrunken hatte. Eigentlich kenne ich ihn nur mit seinem Warsteiner. »Was soll ich da machen? Ihm schmeckts halt. Und versuch du mal, eine Angewohnheit aus einem 87 Jahre alten Mann rauszubekommen. Das ist ja bei euch schon nicht möglich, wenn ich an all das unnötige Zeug denke, das ihr euch kauft. Das braucht ihr doch alles nicht, aber ich sage auch nichts dazu.« »Ach Mama, du sagst ja doch was. Und ich sehe auch immer deine Blicke. Ich bin 56 Jahre alt und möchte mir mit meinem Geld auch mal was kaufen können, ohne dass jemand was dazu sagt. Ich bin doch nun wirklich kein Kind mehr. Und Lorenz geht es genauso. Ich weiß ganz genau, dass du dich an seiner neuen Kamera störst, aber die alte war ... na ja, alt und hat keine guten Fotos gemacht.« Paula griff schnell zu ihrer Jacke, um ihre Mutter in der Küche alleine zu lassen. Sie wollte damit einer unliebsamen Diskussion entgehen. »Nun siehst du, du willst deinem Vater das Bier verbieten, aber das Kaufen willst du dir nicht verbieten lassen. Also nun lassen wir das, in Ordnung?« Paula blieb im Türrahmen stehen und schaute zu ihrer Mutter zurück. Dann presste sie ihre Lippen zusammen und schnaufte hörbar durch ihre beiden Nasenlöcher aus. Sie nickte ihr zu und verabschiedete sich in ihre Wohnung. Marta stimmte grundsätzlich ihrer Tochter zu, dass Sepp zu viel trank. Aber sie war keine konfrontative Person, das war sie noch nie gewesen. Alles, was sie wollte, war Ruhe und Frieden. Sei froh, mein Kind, dass du nicht so viel wie wir durchmachen musstest, dachte sie oft in solchen Situationen. Nachdem das Hackfleischgulasch noch etwas eingekocht war und Marta den Tisch schnell gedeckt hatte, rief sie die ganze Familie zusammen. Das Essen verlief ohne sonderlich erwähnenswerte Vorkommnisse. Nachdem Lorenz noch einen selbstgemachten Ofenschlupfer vom Vortag aus dem Kühlschrank in ihrer Wohnung geholt und verteilt hatte, strömten alle wieder in die unterschiedlichsten Himmelsrichtungen aus: Sepp ging zurück in den Garten, Paula und Lorenz in ihre Wohnung und Marta räumte die Küche auf. Auch wenn sie vorgegeben hatte, sich nicht in fremde Angelegenheiten reinzustecken, war sie trotzdem neugierig, zu erfahren, wer die neuen Nachbarn waren. Geduld ist eine Tugend, dachte sie sich und verteilte das übriggebliebene Hackfleischgulasch zum Einfrieren in Plastikbehälter. Während sie die Deckel auf die Behälter drückte, dachte sie kurz an ihre Mutter. Ich bin vielleicht keine sonderlich kreative Köchin, aber das, was ich mache, schmeckt immer. Danke, Mama, dass du mich das alles gelehrt hast. Du fehlst mir manchmal. Sehr. Uns allen.Marta schaute aus dem Küchenfenster. Sie überblickte eine Forsythie, ignorierte die Geranien, machte kurz Halt bei Sepp an seinen Tomaten und lächelte dann in Richtung Friedhofsmauer. Dort, keine 150 Meter über der Mauer, lag seit gut dreißig Jahren ihre Mutter. Gestorben in diesem Haus, das sie zusammen mit der buckeligen Verwandtschaft in den späten 50er Jahren zu ihrem Reich gemacht hatte. Das waren noch Zeiten, da hat jeder noch richtig angepackt. Selbst ich habe noch die Säcke geschleppt, die eigentlich viel zu schwer für mich waren. Aber die Zeiten sind vorbei. Einerseits gut, aber irgendwie auch schade. Marta war eine eher melancholische Person. Sie lachte viel, das stand außer Frage. Früher aber, als viele Familienmitglieder noch gelebt hatten und oft große Feste veranstaltet wurden, hatte sie vielleicht noch ein bisschen öfter gelacht. Es gab aber auch manchmal Momente, in denen sie innehielt und nachdachte. Über das Miteinander. Über das Früher und das Jetzt. Und über das Hätte-etwas-anders-laufen-müssen? Dann schüttelte sie aber meist schnell den Kopf und wischte die Gedanken wieder beiseite. Klar, ein paar Dinge könnten besser sein: Die gemeinsamen Essen sind in den letzten Jahren doch eher zu einem Termin der gemeinsamen Nahrungsaufnahme geworden. Und ich würde gerne meine Enkel mehr sehen. Katharina und Jan studieren so weit von hier entfernt und kommen nur alle paar Monate zu Besuch. Das Verständnis von Familie hat sich doch sehr geändert. Aber wie hat mein lieber Vater immer gesagt: »Nichts ist beständiger als der Wandel.« Und grundsätzlich ist die Situation doch gut. Alle sind gesund, alle haben zu essen und Gott sei Dank gibt es selten Streit. Also was soll die viele Trübsal. So endete meist Martas Ausflug in ihre Gedankenwelt. Meist überlegte sie dann, was sie als nächstes im Haus machen könnte. Und meist hatte es mit Wäsche waschen oder Kochen zu tun. Oder mit Unkraut jäten im Vorgarten. Sepp konnte zwar noch viel im Garten machen, aber sich längere Zeit bücken, das funktionierte zunehmend schlechter. Und Marta fand den Gedanken, dass sich die Nachbarn über Unkraut im Vorgarten belustigen könnten, ganz schrecklich. »Also auf zum Unkraut!«, überzeugte sie sich selbst, nahm ihre Schürze ab, legte sie auf den Stuhl am Küchenfenster und öffnete die Terrassentür. Von dort führte – an der Einfahrt ihrer Nachbarn vorbei durch den Steingarten hindurch – ein kleiner Weg in den Vorgarten. Sie ärgerte sich, einen falschen Moment erwischt zu haben, denn ihr Nachbar Karl stand dort gerade hinter einem Baum und hantierte mit einer Heckenschere. Auf ein Gespräch mit ihm hatte sie gerade nun wirklich keine Lust. »Hallo, Marta! Wunder dich nicht, ich schneide mal euren Thuja ordentlich ab. Der wuchert hier wie Unkraut und das sieht nicht gut aus. Vor allem nicht bei uns auf der Seite.« Karl hob sein Werkzeug an und schnitt laut schnaufend und schwitzend mit einem kräftigen Satz drei kleine vorstehende Äste ab. An einem dickeren Ast auf ihrem eigenen Grundstück hatte er sich mit der Heckenschere versucht, war aber daran gescheitert. »Was macht die Familie? Doris ist hinten und liest Lea und Tim eine Geschichte vor. Die Geschichte hat Doris schon das vierte oder fünfte Mal vorgelesen und ich war davon mindestens dreimal in Hörweite, da kann ich die Zeit besser nutzen. Ihre Eltern haben sie bei uns abgeladen und sind in die Stadt gefahren, die haben ihren Hochzeitstag! Der elfte oder zwölfte, da habe ich nicht genau zugehört. Doris und ich feiern sowas schon gar nicht mehr, ist doch affig. Aber was ich lustig finde: Sie gehen in eine Ausstellung im Stadtmuseum und dann essen. Wer geht denn an seinem Hochzeitstag in eine Ausstellung?« »Hallo, Karl. Der Familie geht‘s gut, danke. Es gibt aber eigentlich nichts zu erzählen, Paula und Lorenz sind oben und Sepp ist hinten bei seinen Tomaten. Du hast ihn sicher dort schon gesehen. Wenn wir was mit den Thujas machen sollen, gibst du uns aber Bescheid, ja? Dann kann einer von uns rüberkommen und die Hecke einmal gerade abschneiden. Das musst du nicht machen.« Marta verhielt sich Karl gegenüber immer freundlich und korrekt, aber sie mochte ihn nicht sonderlich. Ihre Meinung zu ihm glich im Grunde der ihrer Tochter. In den 40 Jahren Nachbarschaft hatte sie es nie erlebt, dass er etwas getan hatte, ohne dafür etwas im Gegenzug zu fordern. Kleine Tomatenpflanzen, die Sepp gezogen hatte. Äpfel aus dem Garten. Oder auch die Hälfte des Feuerholzes vom alten Christbaum, den sie vor rund 15 Jahren in den Garten gepflanzt hatten und der im vergangenen Jahr gefällt werden musste, weil er zu hochgewachsen war.
Diese »kleinen Tauschgeschäfte», wie sie Karl stets nannte, hatte er dann alles andere als subtil eingefordert, nachdem er auf eigene Initiative hin Sepps Thuja geschnitten oder – und das konnte Marta an einer Hand abzählen – mit seinem Auto eine Ladung Grünabfall aus deren Garten zur Annahmestelle am Friedhof gefahren hatte.
»Ach was, das mache ich schon. Wir sind doch Nachbarn. Freunde! Wir halten zusammen, was?«
Damit zwang sich Karl zu einem schmalen Grinsen.
Marta musste an sich halten, ihre Stirn nicht vollständig in Falten zu legen.
»Ach so: Die neben euch, das sind wohl Syrer! Hat die Schappert erzählt. Sind gestern eingezogen, in einer Nacht- und Nebelaktion! Ich hatte den Laster gehört, als er in die Straße gefahren ist, aber es hat viel zu viel geregnet, um etwas zu sehen und bei dem Wetter raus wollte ich auch nicht. Was die wohl hier machen?«
Karls Blick schweifte an Marta vorbei zum Haus der Kisselbachs.
Es hatte definitiv schon bessere Tage erlebt: Böse Zungen würden es als Bruchbude oder Geisterhaus bezeichnen.
Wobei einer dieser bescheuerten Makler aus der Stadt sicher eher irgendetwas von »Dornröschenschlaf« gefaselt hätte, aus dem es »wachgeküsst« werden müsste.
Karl war ein eher jähzorniger Typ und regte sich oft auf. Vor allem am Esstisch bei seiner Frau Doris.
Die Thujabäume der Nachbarn, die in seinen Garten hinübergewehten Blüten und Blätter von Sepps Blumen oder wenn Lorenz zu lange oder überhaupt am Sonntag Rasen mähte.
Aber nichts fand er schlimmer, als auf seinen einsamen Spaziergängen am Haus der Kisselbachs vorbeizugehen und die bröckelnde Fassade, das zu hochstehende Gras oder das rostige Garagentor anschauen zu müssen.
»Wenn das nicht bald unter den Hammer kommt, kommt es bald unter die Abrissbirne!«, sagte er dann oft vorm Zubettgehen zu Doris, die das ständige Lamentieren nicht mehr hören konnte und dann auf Durchzug schaltete.
Sie war hochgewachsen und recht hager und damit optisch genau das Gegenstück von Karl. Und sie war immer sehr aufs Äußere bedacht, selbst wenn sie in den Garten ging. Ungeschminkt hatte sie im Viertel sicher noch nie jemand gesehen. Und schon gar nicht in Alltagskleidung.
Auch charakterlich lagen oft Welten zwischen ihnen, was sich in den Anfangsjahren ihrer Beziehung aber noch nicht so sehr gezeigt hatte.
Im Gegensatz zu Karl und Doris konnte man die Ehe von Sepp und Marta als sehr glücklich bezeichnen, doch scheiden lassen hätte sich Doris von Karl nie.
»Syrer? Ach was, woher weiß Frau Schappert das denn? Hat sie mit ihnen gesprochen?«
Marta war in der Schule immer sehr gut in Geographie gewesen. Syrien auf einer Landkarte zu verorten fiel ihr daher nicht schwer. Abgesehen davon waren auch die Zeitungen der letzten Monate voll mit Meldungen über das Land gewesen. Bürgerkrieg, Chemiewaffen, Leid und Elend. So schrecklich, dachte sie sich dann und versuchte umgehend – auch mit Blick auf ihre eigene Vergangenheit – sich anderen Artikeln zu widmen. Manchmal legte sie die Zeitung auch ganz beiseite und machte etwas anderes. »Ja, hat sie. Ist wohl mit einem Brot rübergelaufen und hat geklingelt. Trick 17, das macht sie ja immer so. Sie hat sich aber geärgert, dass sie nicht hereingebeten wurde. Im Eingang hätte es sehr dreckig ausgesehen, hat sie erzählt. Deswegen wollte sie eigentlich auch gar nicht reingehen. Die sprechen wohl aber zumindest Deutsch. Ob die das dort gelernt haben? Ich habe ja nichts gegen so jemanden, aber ich frage mich trotzdem, was die hier machen. Ich meine, den Özen aus der Wiesenstraße kenne ich noch von früher. Der ist aber deutscher als ein Deutscher. Und seine Frau ist, glaube ich, sogar hier geboren. Aber wer weiß, wie die da so drauf sind. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Unsere Straße war doch im Vergleich immer sehr ruhig.« Man merkte Karl seine Unruhe an, da sein Blick immer wieder vom Haus der Kisselbachs zu Marta und wieder zurückwanderte. »Ruhig im Vergleich wozu? Wir wohnen an einem Friedhof, das wird sicher auch in Zukunft so ruhig bleiben.« Marta lachte kurz laut auf. Dann verzog sie ihre Mundwinkel aber schnell wieder zu einem neutralen Balken, als sie merkte, dass Karl nicht zum Lachen zumute war. »Dass es im Eingang dreckig ist, könnte ja entweder am Einzug liegen oder an der Tatsache, dass die einzigen Bewohner der letzten Jahre Mäuse und Marder waren, meinst du nicht auch? Syrer, ja? Und was hat Frau Schappert noch erfahren?« »Mehr nicht. Noch nicht! Ich denke mal, dass das Muslime sind, die Frau trägt wohl ein Kopftuch. Ich wüsste nicht, warum sie das sonst tragen sollte. Die Amine vom Özen, die ist aber nicht so, die trägt sowas nicht. Finde ich auch schöner so.« »Na ja, das ist sicher Geschmackssache. Ich habe früher auch ein Tuch auf dem Kopf getragen, wenn ich in die Kirche gegangen bin.« Die Kirche ... In der Kirche war ich schon echt lange nicht mehr. Seit dem Skandal mit Pfarrer Dohl und dem Klingelbeutel. Das war auch echt eine Frechheit. Aber der Dohl ist ja tot, ich könnte nun eigentlich mal wieder hingehen. Marta faltete ihre Hände wie zum Gebet, konzentrierte sich wieder auf das eigentliche Geschehen und wandte sich ihrem Nachbarn zu. »Ja, aber das ist ja was anderes. Mehr weiß ich über die auch nicht, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Ich muss jetzt hier weitermachen, sonst werde ich mit eurer Hecke nie fertig. Mach‘s gut, Marta. Und Grüße an den Sepp und die Tochter!« »Nicht so schlimm?« Das ist wieder typisch Karl, diese unnötige Schwarzmalerei. Marta mochte es ganz und gar nicht, wenn prophylaktisch immer das Schlechteste befürchtet wurde. »Was ist denn an diesem Kopftuch anders als an jenem? Na ja, dann frohes Schaffen, die Grüße richte ich aus! Bitte sag Doris Hallo von mir, sie soll doch gerne die Tage mal auf einen Schwatz zu mir kommen.« Doris war nicht unbedingt Martas beste Freundin. In all den Jahren hatten es beide nicht geschafft, eine so enge Verbindung aufzubauen, wie Marta es noch aus ihrer Heimat kannte. Trotzdem war Doris mit Abstand die Person in der Nachbarschaft, mit der sich Marta am liebsten traf. Der Plausch mit Karl hatte sie zwanzig Minuten gekostet, in denen sie schon viel Unkraut hätte jäten können. Aber immerhin hatte sie ihre Neugierde etwas stillen können und Informationen zum Einzug nebenan erhalten. Sie schob die alte pinkfarbene Ritsche zwischen die Beine und schaute auf ihre Uhr. »Los geht’s, Marta, spuck in die Hände. In einer Stunde gibt es Kaffee und bis dahin muss hier alles in Ordnung gebracht sein.« Marta zog nun die nächsten 40 Minuten jegliches wild gewachsene und unliebsame Pflänzchen samt Wurzel aus dem Vorgarten. Für den Betrachter von außen wirkte sie sehr darauf konzentriert, ihre Arbeit richtig zu tun und keine Wurzel in der Erde zurückzulassen. Doch Marta war hier zu routiniert, um über irgendetwas Wurzel- oder Unkrautbezogenes nachdenken zu müssen. In ihrem Kopf spielten stattdessen Karls Worte und ihre positiven Gedanken Pingpong. »Vielleicht wird es gar nicht so schlimm.« Was soll denn überhaupt schlimm werden? Nachdem das Nachbarhaus so lange leer gestanden hat, sind nun neue Leute eingezogen. Das ist doch grundsätzlich erstmal gut. Sie hatte auf der Straße schon zweimal Teenager reden gehört, die zum »Gruselhaus« wollten. Damit war das Haus der Kisselbachs gemeint. Eingewachsen, unbeleuchtet, ramponiert. Prädestiniert dazu, dass man dort einstieg und gruselige Filmszenen nachstellte oder irgendeine Mutprobe einging, ohne auf schlafende Bewohner zu treffen. Aber hilfreich, um das Haus soweit intakt zu halten? Eben nicht! Abgesehen davon, dass sich das auch auf die Immobilienpreise der ganzen Straße auswirkte. »Das ist doch erst einmal prima, dass da wieder Leben einzieht. Sowas Blödes!», sprach Marta ihre Gedanken laut aus und verfehlte in dem Moment den Eimer voller Unkraut. Die in einem kunstfertigen Griff soeben herausgezogene Wurzel samt Blattwerk landete auf dem Pflasterstein und hinterließ darauf mehrere kleine Erdbrocken. Sie erschrak für einen Moment über ihren kurzen, aber dennoch hörbaren Ausbruch. Sie blickte zunächst nach links und rechts, ob sie jemand gehört hatte, bückte sich dann nach vorn und griff nach der am Boden liegenden Wurzel. Dann schmiss Marta sie schnell in den Eimer zu ihren Artgenossen. Ein leises Räuspern ließ sie wieder in den Arbeitsmodus wechseln. Doch sie musste weiter an Karls Worte denken. »Ohne Kopftuch finde ich auch schöner.« Wer, denkt Karl denn, wer er ist? Sowas von oberflächlich. Eigentlich müsste man ihn dann auch entsprechend beurteilen. Ohne Bierbauch, puterroten Kopf und den permanenten Mundgeruch, das finde ich auch schöner und da bin ich sicher nicht die Einzige, dachte sich Marta. Beim Wort puterrot musste sie kurz kichern, denn sie stellte sich nun Karl mit einem Truthahnkopf auf dem schwabbeligen Hals vor. Sie wischte die Aufregung in ihrem Kopf wieder beiseite und stand auf. Es war Zeit, die Vorbereitungen in der Küche zu machen. Diesmal ging sie aber nicht den direkten Weg über den Steingarten, sondern ums Haus herum zum Kompost. Die Wurzeln und Unkrautblätter warf sie dort hinein, dann brachte sie die Handschuhe und den Eimer zurück in den Schuppen. Dann schaute sie noch kurz bei Sepp vorbei und informierte ihn über den in Kürze fertigen Kaffee. Er hatte schon eine beachtliche Anzahl an Tomatenpflanzen eingebuddelt und an Rankstäben festgemacht. »Prima, ich komme in zehn Minuten, mir fehlen nur noch drei Pflanzen.« Sie nickte ihm zu und ging dann zurück in ihr Reich. Sie fand den Begriff, den sowohl sie als auch Sepp verwendete, nicht abwertend. Es war eben ihr Reich, so wie der Garten Sepps Reich war. Sie bekam natürlich mit, dass es in der heutigen Zeit als sexistisch oder altmodisch bezeichnet wurde, wenn man Frauen in der Küche mit Backzeug und Schürze und Männer im Garten mit der groben Erde und den gefährlichen Werkzeugen verortete. Und grundsätzlich hätte sie dem auch zugestimmt, wenn diese traditionelle Aufteilung ihr zugewiesen worden wäre und sie keine Wahl gehabt hätte. Ihre Freundinnen von früher wurden alle sehr früh Mütter und blieben dann Hausfrauen, weil sie es von ihren Eltern so eingebläut bekommen hatten. Das war damals in ihrer Heimat, so wie in ganz Deutschland, vielleicht auch ganz Europa, die ungeschriebene Regel gewesen. Ihre Eltern dagegen ließen sie machen, worauf auch immer sie Lust hatte. Sie durfte sogar, das war noch kurz vor und während des Kriegs, eine Ausbildung machen, die sie sich selbst ausgesucht hatte. Sie wurde Telefonistin und begann, in einer Bank zu arbeiten. Nach dem Krieg entschieden sich aber die beiden wieder Vereinten – Sepp war gerade erst aus der Kriegsgefangenschaft in Murmansk zurückgekommen – Kinder zu bekommen und sich aufs Haus und den Garten zu konzentrieren. Marta bekam mehr und mehr Lust darauf, Gurken oder Sauerbraten einzulegen als in ihrem gelernten Job mit lauter Fremden zu arbeiten und Sepp brauchte durch seine eigentliche Arbeit als Gießer den Ausgleich an der frischen Luft. Er fand großes Gefallen daran, Bäume und Pflanzen zu hegen und zu pflegen: Seine Tomaten, Gurken oder Radieschen waren regelmäßig die größten und saftigsten weit und breit und die Blumenbeete hätte ein Landschaftsgärtner nicht schöner anlegen können. Ohne Geld wäre dieses Leben aber nicht möglich gewesen, weswegen Sepp wieder in seinem alten Betrieb zu arbeiten anfing. »Zzzzzzzzwisch.« Der Pfeifton des Wasserkochers wurde immer lauter und schriller und Marta wickelte gekonnt ein Küchentuch um ihre Hand, bevor sie den Regler am Herd ausschaltete. Sie war es gewohnt, seit jeher Kaffee mit einem Porzellanfilter zu machen. Auch diese Tätigkeit war für sie also reine Routine. Allerdings die Routine, die ihr am meisten Spaß machte. Denn der Duft der frisch in einer Handmühle zerkleinerten Bohnen und der Geschmack des fertigen Kaffees war ihr persönlicher Höhepunkt am Tag. Den Sträselkucha, mit dem Originalrezept ihrer Großmutter gebacken, hatte sie bereits am Morgen aus der Tiefkühltruhe zum Auftauen geholt. Ein Stickel Heimat, dachte sie und fragte sich, ob ihre Großmutter größere oder kleinere Streusel gemacht hatte. »Lang lang ist’s her, das kann ja keiner mehr wissen. Aber Hauptsache, es schmeckt!« Sie lief ins Treppenhaus, rief nach Paula und Lorenz und eilte dann geschwind ans Küchenfenster, um auch Sepp zu informieren.
Sepp saß als Erster am Tisch. Er mochte zwar schon älter und optisch das Gegenteil ihres Nachbarn Karl sein, aber essen konnte er. Und Trinken natürlich auch, fügte Marta gedanklich hinzu. Sie griff nach der Kuchenschaufel und gab Sepp ein großes Stück. Dann berichtete sie ihm von ihrer Begegnung am Gartenzaun: »Ich habe vorhin mit Karl gesprochen, als ich das Unkraut jäten wollte. Er meinte, dass nebenan Syrer eingezogen wären. Und dass das vielleicht Muslime seien, weil die Frau Kopftuch trägt.« Sepp schaute sie aus einer Mischung aus Erstaunen und Desinteresse an, schluckte einen Bissen runter und frotzelte: »Das hat die Kisselbach auch immer um ihren Kopf getragen, dann ändert sich ja gar nicht so viel. Da muss ich nur aufpassen, dass ich die Frau nicht als Frau Kisselbach anspreche, wenn ich sie mal von hinten sehe. Und dann erschrecke, dass mir keine Leiche zurück grüßt, sondern die neue Nachbarin.« »Ach Sepp, du schaffst es echt immer wieder, Witze über Verstorbene zu machen. Das gehört sich nicht.« Aber lustig war es schon, dachte sie sich. Sie fand Sepps schwarzen Humor immer schon gut, auch wenn sie es nie offen zugegeben oder Witze in derselben Kategorie gerissen hätte. Sepp wusste das natürlich, weswegen er ihre Aussagen nie ernst nahm. »Und was hat er noch so erzählt, der Plotsch? Hm, Syrer ... Ich habe gestern im Radio wieder von einem Bootsunglück vor Griechenland gehört, da sind wohl 115 Leute ertrunken. Ein Jammer, so viele Tote. Viele waren wohl aus Syrien und dem Irak oder so. Wäre das nicht sicherer, wenn sie vielleicht einfach dort blieben?« Sepp las oder hörte zwar Nachrichten, interessierte sich aber eher für den Sportteil. Die große Welt und ihre großen Krisen mied er, weswegen seine Fragen manchmal wie vom Stammtisch wirkten. »Ach, ich weiß auch nicht«, seufzte Marta. »Das ist ja auch nicht so einfach dort. Das liest und hört man doch überall. Aber ich bin da nicht so tief drin. Und was ist schon Sicherheit? Ich meine, damals bei uns ... « In dem Moment betrat Paula das Zimmer. Sie hatte bis eben einen kleinen Mittagsschlaf gehalten und sah entsprechend verknautscht aus. »Hallo, Mama, hallo, Papa. Was gibt‘s Neues? Lorenz ist noch auf dem Friedhof, der Gärtner hat wohl lange nicht mehr das Grab seiner Eltern gepflegt und nun macht er es eben selber. Wir sollen ihm aber ein Stück vom Streuselkuchen aufheben.« »Du liebe Güte, hast du mich erschreckt. Ich war gerade ganz woanders und da stehst du auf einmal in der Tür. Setz dich, hier hast du ein Stickel.« Marta war aufgrund von Paulas plötzlichem Erscheinen zwei Zentimeter vom Stuhl gerutscht und setzte sich nun wieder aufrecht hin. »Was? Aber ihr zahlt doch ein Schweinegeld, das ist ja eine Frechheit.« Sepp ärgerte es immer, wenn er über den Friedhof ging und die zahlreichen ungepflegten Gräber sah. »Wenn man nicht in der Nähe wohnt und daher die Gräber seiner Verwandten nicht selbst pflegen kann, bezahlt man einen Gärtner dafür. Und wenn man das nicht machen möchte, dann sollte man für seine Verwandten vielleicht auch kein Reihengrab aussuchen, sondern sie verbrennen und in eine Urne stecken. Ein normales Grab muss gepflegt sein, sonst zeigst du damit den anderen, dass dir die Familie nichts wert ist.« Diese Sichtweise von Sepp kannte jeder in der Familie. Er legte sie aber stets aufs Neue dar, wenn er verärgert von seinen Spaziergängen zurückkam. »Aber richtig blöd ist natürlich die dritte Option: Du zahlst ein Schweinegeld für den Gärtner und der schafft trotzdem nichts.« Marta sprach nicht gerne über den Tod oder Begräbnisse. Jeder muss irgendwann mal sterben, aber ich habe nun schon so viel Leid und Elend in meinem Leben gesehen, dass ich darüber nicht auch noch ständig am Esstisch sprechen muss, dachte sie sich dann und wechselte das Thema. »Wir haben gerade über unsere neuen Nachbarn gesprochen. Karl meinte, dass das Muslime seien!« Marta ärgerte sich unmittelbar darüber, wie seltsam sie Muslime ausgesprochen hatte. Das hatte sie gar nicht so abwertend gemeint, wie es nun wahrscheinlich rübergekommen war. »Echt? Na ja, aber warum auch nicht. Vorne im Hochhaus wohnen ja auch viele. Hat er sich echauffiert, dass die Straße dann nicht mehr so Deutsch ist?« Paula drückte beim Wort Deutsch sofort ihren Rücken gerade und schob, während ihr Gesicht finsterer wurde, die beiden Beine wie ein Soldat eng zusammen. Das Schauspiel konnte sie aber nicht lange aufrechterhalten. Sie musste ob ihrer gezogenen Schnute sofort kichern und ihr Körper erschlaffte wieder. Auch Marta grinste. »Meint ihr, die haben das Haus gekauft oder gemietet? Hat er mehr gesagt? Türken? Araber?« »Kind, du stellst aber viele Fragen. Ich weiß nur, beziehungsweise Karl weiß das von der Schappert, dass es wohl Syrer seien. Kennst du dich da mehr aus?« »Was, mit Syrern oder Syrien?« Paula überlegte sich bereits während der Fragestellung, ob sie eine der Auswahlmöglichkeiten überhaupt bejahen könnte und verneinte das umgehend. »Mit beidem. Das, was man von Syrien in den Nachrichten hört, ist ja ganz schlimm.« Marta dachte kurz an die Videos und Bilder, die im Fernsehen gezeigt wurden. Bombardierte Häuser, Zeltstädte mit lauter Flüchtlingen, Leichensäcke. »Nein, ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich bekomme halt was über die Nachrichten mit, so wie ihr auch, aber mehr auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, wer da nun alles gegen wen kämpft.« »Ja egal, macht nichts«, erwiderte Marta und wollte schnell das Thema wechseln, um die Bilder aus ihrem Kopf zu bekommen. »Also es ist nicht egal, aber wir können ja eh nichts daran ändern.« »Und was machen sie hier? Sind das Flüchtlinge? Geht das dann überhaupt, sich selbst eine Unterkunft auszusuchen? Ich dachte immer, Flüchtlinge werden in irgendwelchen Containerhäusern am Stadtrand untergebracht.« Als Paula das aussprach, schämte sie sich gleich für ihre Wortwahl. Containerhäuser hätte problemlos durch Käfige ausgetauscht werden können, so wie sie es betont hatte. Hier merkte man ihre Unbeholfenheit und ihre fehlenden Erfahrungen im Umgang mit anderen Kulturen und Nationalitäten. Im Statistischen Amt, wo sie arbeitete, war die Diversität des Landes und selbst ihrer Stadt in weitem Bogen vorbeigegangen. Ob die Bewerbungen dieser Kandidaten freiwillig ausblieben oder ob im Amt bei Einstellungen darauf geachtet wurde, dass Neuzugänge eine weiße Hautfarbe haben und christlich erzogen worden sind, konnte sie nicht beantworten. Ihr fiel es nur in manchen Situationen auf, dass alle ihre Kolleginnen und Kollegen Schmidt, Fischer oder Gruber hießen und alle aus der Gegend kamen. Sie selbst, eine angeheiratete Hartmann, fiel da auch nicht sonderlich auf. Paula versuchte stets, längeren Gesprächen mit ihren Kollegen aus dem Weg zu gehen. Warum wusste sie gar nicht. Vielleicht, weil diese meist recht einseitig und belanglos verliefen. »Das wusste Frau Schappert wohl auch nicht.« Marta hatte nicht an Käfige gedacht, als ihre Tochter von Containerhäusern sprach. Bei ihr kam eher der Vergleich Besser-im-Container-als-in-zerbombten-Häusern-leben-müssen auf. Paula ärgerte sich noch immer über ihre Wortwahl und wollte daher auch lieber das Thema wechseln. »Na ja, geht uns ja auch nichts an. Hoffen wir mal, dass sie nett sind und sich gut anpassen.« Auch hier fragte sie sich aber umgehend, was sie damit eigentlich ausdrücken wollte. Aber bevor sie ihren Ausspruch revidieren konnte, mischte sich Sepp ein: »Anpassen! Du meinst, dass sie nicht nachts mit einem Maschinengewehr in die Luft schießen?« »Sepp, hast du getrunken? Was erzählst du da?« Marta legte ihr Besteck hin und richtete sich auf. Sepp schaute seine nun mit geradem Rücken und ernsten Blick schauende Frau leicht irritiert an: »Das machen die doch, wenn die sich freuen! Habe ich mal in der Zeitung gelesen. In Berlin haben sie die ganze Nacht in die Luft geschossen, weil sie irgendein Fußballspiel gewonnen haben.« Dann griff er mit der rechten Hand zur Kaffeekanne, wandte seine Augen aber nicht von Marta ab. »Reg dich wieder ab, das war doch nicht böse gemeint.« Paula beobachtete kurz, wie sich die vier Augen ihrer Eltern anstierten, fast schon durchbohrten und mischte sich nun auch ein: »Wer macht das, Papa, die Syrer?« Sepp blickte nach rechts zu seiner Tochter, dachte kurz nach, was er damals eigentlich genau gelesen hatte und entgegnete dann, als er sich nicht mehr konkret erinnern konnte: »Nein, insgesamt. Keine Ahnung, Türken waren es, glaube ich. Ach, ich weiß ja auch nicht mehr.« Paula reagierte, bevor Marta ihrem Mann etwas entgegnen konnte: »Das ist doch nicht dasselbe, Papa. Und das habe ich auch eben gar nicht damit gemeint. Eigentlich weiß ich selber nicht, was ich damit ausdrücken wollte. Egal, können wir jetzt essen? Ich habe Hunger und Lorenz braucht bestimmt noch etwas. Die Nachbarn sind sicher nett und schießen nicht mit irgendwas in die Luft.« Marta schaute nun auch zu ihrer Tochter und entspannte sich innerlich wieder etwas. Ihr Mund formte sich zu einem nach oben geöffnetem Halbmond. »Ja, wir essen jetzt. Setz dich hin, hier hast du noch die Milch für den Kaffee. Und dann lasst es euch nun schmecken. Komm Herr Jesu, sei unser Gast und segne uns, was du uns bescheret hast. Amen.« »Amen«, antworteten sowohl Sepp als auch Paula, obwohl beide alles andere als gläubig waren. Aus Tradition und ihrer Frau und Mutter zuliebe beteten sie aber jedes Mal vor dem Essen. Auch Martas Religiosität hatte in den vergangenen Jahren gelitten. Nicht zuletzt, weil herausgekommen war, dass der frühere Pfarrer Dohl regelmäßig Geld aus dem Klingelbeutel entwendet hatte. Und das Geld nicht für soziale Zwecke, sondern gehobene Abendessen mit seiner Geliebten, der Hausärztin Dr. Habernack, ausgegeben hatte. Früher dagegen war Marta sehr regelmäßig in die Kirche gegangen. Die Organisation ist doch durch und durch korrupt. Aber all das widerfahrene Elend und die Entbehrungen müssen doch trotzdem zu etwas gut gewesen sein, dachte sie, um sich gleich darauf zu versichern, dass sie sich hier doch ein wirklich gutes Leben aufbauen konnten und dass doch nicht alles schlecht gewesen sei. Mit diesen Gedanken räumte sie den Tisch ab und begann, den übrigen Kuchen in den vollen Kühlschrank zu quetschen. Sepp war schon wieder im Garten und Paula oben in ihrer Wohnung, da dachte Marta noch einmal an die Situation einige Stunden zuvor, als ihre Tochter in der Küchentür stand. Sicherheit ist etwas so Großes und Vielschichtiges. Man kann sich in Sicherheit wiegen und auf einmal ist die Situation doch eine ganz andere. Man kann auf Nummer sicher gehen und verliert trotzdem. Sicher ist eigentlich nur, dass nichts sicher ist. Das war bei uns so und das war bei denen vielleicht auch so, überlegte sie und blickte durchs Flurfenster zum Nachbarhaus. Aber das geht mich nichts an. Solange man mich lässt, lasse ich auch. Ich hätte dem Karl einfach sagen müssen, dass er das vielleicht auch so handhaben müsste. Vielleicht bin ich nächstes Mal etwas schlagfertiger. Wobei, unnötig verärgern muss ich ihn ja auch nicht. Immerhin erfahre ich schon gern Neuigkeiten, da hatte Paula recht. Mit diesen Gedanken beendete sie den Ausflug in die nachbarschaftliche Gerüchteküche und widmete sich wieder ihrer Hausarbeit. Lorenz kam am frühen Abend vom Friedhof zurück. Sein Gesicht und seine Hände waren voller dunkler Erde und seine Kleidung voller Laub und Geäst. Er war nicht nur von der Zusatzarbeit genervt, sondern hatte auch gleich noch einen leichten Sonnenbrand nach Hause gebracht. Nichts Ungewöhnliches für ihn mit seiner weißen Haut, das geht echt immer so schnell, dachte sich Paula. Aber einschmieren sollte er sich trotzdem regelmäßig, mit seinen ganzen Muttermalen. Na ja, er ist alt genug und ich bin nicht seine Mutter. Beim Gedanken an Lorenz Mutter machte sich auch bei Paula für ein paar Sekunden ein genervter Gesichtsausdruck breit. Seine Mutter hat sich ja auch nie um die wesentlichen Dinge gekümmert, also bin ich definitiv nicht wie sie. »Hallo, Schatz. Ja, ich weiß, ich sehe aus wie ein Schwein. Und nicht nur wie eines, das sich im Dreck gesuhlt hat, sondern auch eines, was kurz in kochendes Wasser gehalten wurde. Ich geh gleich duschen. Haben wir denn noch Après-Soleil? Ich habe mich irgendwie verbrannt.« Lorenz stellte seinen Rucksack in die Ecke und begann, erst seine Schuhe und dann seine Hose auszuziehen. »Hallo, mein Liebling. Du siehst ja übel aus. Du bist echt nicht für die Gartenarbeit gemacht, du Bürohengst.« Dabei schaute Paula ihren Mann mit einer Mischung aus echtem und gespieltem Mitleid an. »Ja, wir müssten noch eine Tube im Schrank haben. Aber nächstes Mal solltest du dich vielleicht prophylaktisch mit Sonnencreme einschmieren, was meinst du? Das ist nämlich echt nicht gesund, das schreit schon regelrecht nach Hautkrebs. Irgendwann lernst du hoffentlich noch, dass du kein Latino bist.« Unbewusst schien das für Paula eine gute Überleitung zum Thema des Tages zu sein und so erzählte sie Lorenz schnell die Neuigkeiten von den Nachbarn, bevor er in der Dusche entschwinden konnte. »Das ist ja mal was, wenn das stimmt! Und nur die Schappert hat bislang mit denen gesprochen? Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Ich meine, erst müssen sie jahrzehntelang neben diesem Undercover-Alt-Nazi mit seiner Bulldogge von Frau leben und nun ziehen genau dort Ausländer ein. Und dann auch noch Syrer!« Bei diesem Satz malte Lorenz Anführungszeichen in die Luft, um seiner Aussage die gedachte Ironie zu unterlegen. »Herr Kisselbach würde sich im Grab rumdrehen, wenn er erfahren würde, wer in sein Haus gezogen ist. Vielleicht gezogen ist. Das finde ich echt lustig. Eine Ironie des Schicksals, wenn du überlegst, wie er damals ... « »Ja ja, wie er sich damals uns gegenüber verhalten hat. So ein richtiges Arschloch, der Typ. Wenn ich damals nicht so jung gewesen wäre, hätte ich ihm sicher die Meinung gegeigt. Widerlicher Typ. Und seine Frau war ja keinen Deut besser. Vielleicht sogar schlimmer. Bei ihm wusste man gleich, dass das ein Arschloch ist. Bei ihr dagegen hat meine Mutter ja erst Jahre später herausgefunden, wie sie gegen uns intrigiert hat. Und so nach vorne hat sie immer so freundlich getan. Wenn man sie überhaupt mal zu Gesicht bekommen hatte. Ich weiß, man wünscht keinem den Tod und das mache ich auch jetzt nicht. Da sie schon tot sind, freue ich mich einfach und denke mir, dass es die Richtigen getroffen hat. Vielleicht ein paar Jahre zu spät.« Paula hatte sich, wie immer bei diesem Thema, in Rage geredet. Lorenz wusste zwar, dass die Kisselbachs für seine Frau ein sehr sensibles Thema waren. In dieser Minute hatte er aber Paulas Reaktion unterschätzt. Er wollte ja eigentlich nur schnell duschen und die Strapazen der Grabpflege vergessen. Um Paula wieder einzufangen und das Gespräch doch lustig enden zu lassen, entgegnete er ihr: »Wenn du magst, gehe ich morgen nochmal schnell auf den Friedhof und verliere auf dem Weg zum Grab meiner Eltern, sagen wir mal auf Höhe des Kisselbach-Grabs, unseren Biomüll? Dann haben die ganzen Eierschalen und der Kaffeesatz noch einen höheren Sinn, als nur zu verrotten.« Paula stellte sich vor, wie das akkurat gepflegte Grab der Kisselbachs mit dem weißen Kies und dem einen langweiligen Buchsbaum aussähe, wenn dort – aus Versehen – ihr Biomüll landen würde. Der Gedanke an diesen harmlosen und doch schändlichen Angriff auf das Grab der beiden Personen, die vor allem ihren Eltern so lange das Leben zur Hölle gemacht haben, gefiel ihr sehr gut. Lorenz sah Zustimmung in Paulas Augen, zwinkerte ihr einmal zu und entschwand dann splitterfasernackt im Badezimmer. Der weitere Abend verlief weitgehend unaufgeregt. Nachdem Lorenz geduscht und die beiden nach dem Abendessen ihre Lieblingsdokumentation auf DVD weitergeschaut hatten, machten sie sich langsam bettfertig. Seit dem Gespräch mit Lorenz hatte sie nicht mehr an die neuen Nachbarn gedacht. Auf dem Weg ins Bett kam Paula allerdings am Flurfenster vorbei, aus dem sie – hinter Gardinen und einer großen Pflanze versteckt – gut das Nachbarhaus beobachten konnte. In ein paar Zimmern im oberen Stock brannte noch Licht, allerdings sah sie niemanden dort umherlaufen. Syrer. Wie die wohl hierhergekommen sind? Und wieso genau hierher? Was die wohl gerade machen? Es war zwar nicht allzu spät, aber Paula merkte, dass sie von den ganzen Fragen leicht benebelt wurde. Was geht dich das eigentlich an? Wahrscheinlich haben sie eben auch ferngesehen und sich gefragt, was die dicke Deutsche gegenüber so macht, sagte sie zu sich in Gedanken und öffnete die Schlafzimmertür. Lorenz war schon eingenickt und lag leise schnarchend auf der Seite. Er hatte, wie immer, ihr Nachttischlicht angemacht. »Damit du den Weg ins Bett findest«, hatte ihr das Lorenz dann immer erklärt, wenn sie sich über die zusätzliche Arbeit aufregte. »Damit du nicht das Licht ausmachen musst und sofort einschlafen kannst«, entgegnete ihm dann Paula. Der Nutzen für beide lag klar auf der Hand, weswegen sich keiner ernsthaft beschwerte. Bevor Paula die Lampe ausschaltete, dachte sie noch ein letztes Mal an die neuen Nachbarn. Wieso beschäftigt dich das eigentlich so sehr? Dass ins Haus am Wendehammer hinten letztes Jahr auch neue Nachbarn eingezogen waren, hatte sie, hatte ihre Familie erst zwei Monate später erfahren. Ihre Mutter hörte davon erst in einem Gespräch mit Frau Schappert, als diese einen unbekannten Namen mit dem neuen Vorsitz in der Gartenkolonie in Verbindung brachte. »Die Wendlandts? Die sind doch im Juni hierhergezogen. Wollten nicht mehr bei den Eltern von Frau Wendlandt wohnen, sondern etwas Eigenes haben. Wohnen direkt neben Frau Seubert. Sie sind in das Haus der Seipels gezogen. Hatte ich das noch nicht erzählt? Na ja, ist ja auch nichts Besonderes, sie sind ja nur zehn Kilometer weggezogen!«, hatte Frau Schappert die Situation kurz und knapp kommentiert. Die neuen Nachbarn dagegen stufte Frau Schappert wohl als eine besondere Situation ein. Das wurde dadurch deutlich, dass sie gerade einmal einen Tag nach deren Einzug gebraucht hatte, um die halbe Nachbarschaft darüber zu informieren. Ziemlich verschroben, die Schappert. Aber das ist ja nichts Neues, dachte sich Paula. Dann schlief sie, fertig vom Tag, sehr schnell ein.