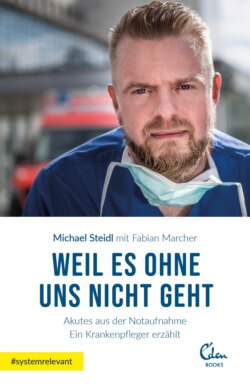Читать книгу Weil es ohne uns nicht geht - Fabian Marcher - Страница 10
Darmverschluss Nähe, Distanz und die professionelle Fassade
ОглавлениеIn Zimmer acht liegt ein Darmverschluss. Das ist nicht schön. Am wenigsten für denjenigen, um dessen Darm es geht. Doch in der engen Taktung des Klinikalltags gerät der Mensch hinter dem Symptom oder der Diagnose allzu oft aus dem Blick. Dann heißt es nur noch: hier der Lagerungsschwindel, dort der Verdacht auf Appendizitis, nebenan die Unterarmfraktur. Patienten spüren, wenn sie derart reduziert werden. Es macht sie misstrauisch und unzufrieden. Wer lässt sich schon gern mit einem Etikett versehen? Wir alle wollen als Menschen und Individuen wahrgenommen werden – auch in der Notaufnahme.
Im Unterschied zu den Ärzten haben wir Pflegekräfte meist mehr Zeit direkt am Patienten. Wenn wir aufmerksam sind, erkennen wir, ob jemand etwas braucht, Angst hat oder sich unzureichend informiert fühlt. Wir können manche Gelegenheit nutzen, um ein kurzes Gespräch zu führen, nachzufragen, die Situation des Patienten besser zu verstehen. Wer Empathie, Wachsamkeit und Verantwortungsbewusstsein mitbringt, kann anderen das Gefühl vermitteln, wahr- und ernst genommen zu werden. Und dieses Gefühl ist manchmal ebenso wichtig wie eine punktgenaue Diagnose oder eine ausgeklügelte Therapie.
Wenn ich sage, dass jeder gern als Mensch gesehen werden möchte, dann gilt das natürlich in gleicher Weise für uns Pflegekräfte und das medizinische Personal. Oft werden wir bei der Arbeit mit einer enormen Anspruchshaltung konfrontiert: Wir sind diejenigen, die sich kümmern müssen, und zwar sofort und möglichst ohne Unterbrechung. Wir sollen niemanden warten lassen, immer ausreichend informieren, alles im Blick behalten, dabei freundlich sein und stets auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen. Diese Aufgaben gehören zweifellos zu unserem Beruf. Aber unter der weißen oder blauen Arbeitskleidung steckt nun mal kein Roboter. Auch wir haben bessere und schlechtere Tage. Wenn wir unaufmerksam oder nicht zu Scherzen aufgelegt sind, könnte das auch daran liegen, dass wir die vergangenen zwei Nächte im Dienst durchgewacht haben. Oder daran, dass im Behandlungsraum nebenan jemand liegt, für den wir nicht mehr viel tun können.
Viele von uns haben sich unter anderem deshalb für diesen Beruf entschieden, weil sie anderen helfen möchten. Um mit unseren persönlichen Ressourcen hauszuhalten und vom Bagatellfall bis zum Polytrauma für alle gleichermaßen da sein zu können, balancieren wir permanent auf dem schmalen Grat zwischen Empathie und professioneller Distanz. Das gelingt meist, aber nicht immer.
So wohltuend es ist, nicht ausschließlich in seiner professionellen Rolle gesehen zu werden, so sehr kann es allerdings auch irritieren, wenn ein Patient oder eine Patientin plötzlich zu »persönlich« wird. So ging es mir, als ich eine etwa dreißigjährige Frau in Behandlungsraum sechs betreute, die von ihrem Hausarzt zu uns geschickt worden war. Sie wirkte nicht beunruhigt, sondern war ziemlich entspannt und sehr freundlich. Ja, vielleicht sogar ein wenig überdreht und ein bisschen zu freundlich.
Ich beschloss, es zu ignorieren und mich einfach auf meinen Job zu konzentrieren. Als Nächstes galt es, bei ihr Blut abzunehmen. Wir legen dafür in der Regel gleich einen Zugang – eine sogenannte Venenverweilkanüle – für den Fall, dass später eine Infusion verordnet wird. Die Patientin erklärte mir, sie habe Rollvenen, weshalb es bei ihr nie auf Anhieb gelänge, eine Kanüle zu legen.
»Die Wette halte ich«, entfuhr es mir spontan. Ich bin ein kompetitiver Charakter. Wenn ich eine Herausforderung sehe, will ich sie meistern. Allerdings spürte ich in dieser Situation sofort, dass ich einen Fehler gemacht hatte.
In meiner Ausbildung gab es einen Vorgesetzten, der mir beim Legen der Venenverweilkanüle stets über die Schulter sah. Das war höchst unangenehm – aber sehr effektiv. Heute bin ich tatsächlich ziemlich gut darin. Unzählige Male haben mir nervöse Patienten erzählt, dass sie regelmäßig von Ärzten oder Pflegern gequält würden, die drei oder vier Anläufe benötigten, bis sie die Vene endlich träfen. Ich lasse mich davon nicht beunruhigen. Normalerweise schaffe ich es beim ersten Versuch.
Und dieses Gerede von sogenannten Rollvenen, die der Nadel ausweichen, war mir sowieso schon immer suspekt. Klar gibt es günstige und weniger günstige Umstände: Manche Patienten sind dick, manche dünn, manche haben mehr Muskeln, manche weniger, auch die Haut kann unterschiedlich beschaffen sein. Aber eine Vene ist und bleibt eine Vene. Dachte ich. Bis ich an jenem Vormittag in Behandlungsraum sechs nach gründlicher Vorbereitung die Nadel in den rechten Handrücken der Patientin stach. Zunächst schien alles in Ordnung, doch dann – kam nichts. Kein Blut. Die Vene war mir im letzten Augenblick entwischt.
Ich seufzte, schüttelte den Kopf, sah die Patientin vorsorglich nicht an und versuchte es gleich noch einmal. Dabei bemühte ich mich, weiterhin eine ruhige Hand zu bewahren. Das gelang mir auch einigermaßen, doch am Ende landete meine Kanüle wieder im Nirwana. Ich spürte, wie mir der Schweiß auf die Stirn trat. Hätte ich doch bloß meine Klappe gehalten.
»Ich probiere es mal auf der anderen Seite«, murmelte ich.
»Ja, das wird besser sein«, meinte die Patientin. Während ich aufstand und zum Versorgungswagen ging, fügte sie hinzu: »Und, was habe ich gewonnen? Ich würde sagen, eine Einladung zum Abendessen müsste drin sein, oder?«
Na also, jetzt hatte ich den Salat. Mit meinem blöden Gerede hatte ich die Frau förmlich zur Grenzüberschreitung eingeladen. Wie sollte ich da wieder rauskommen, ohne sie vor den Kopf zu stoßen?
»Sie sehen doch: Ich bin Krankenpfleger«, antwortete ich schließlich, als ich mich wieder gesetzt hatte und ihre linke Armbeuge desinfizierte. »So eine Einladung, das kann ich mir gar nicht leisten.«
In diesem Fall wäre es mir eindeutig lieber gewesen, wenn mich die Patientin ausschließlich in meiner Rolle als Pfleger betrachtet hätte. Als Mann muss ich zwar nicht ganz so häufig mit derartigen Situationen umgehen wie meine Kolleginnen, doch für uns alle sind Grenzüberschreitungen ein immer wiederkehrendes Problem.
Natürlich muss umgekehrt auch das Personal darauf achten, Grenzüberschreitungen gegenüber den Patientinnen und Patienten zu vermeiden. Zum Beispiel beim Zwölf-Kanal-EKG. Da bringen wir Saugnapf-Elektroden an verschiedenen Stellen des Oberkörpers sowie an den Extremitäten der betreffenden Person an. Soll das bei einer jungen Frau geschehen, die ich betreue, gebe ich diese Aufgabe, wenn möglich, an eine Kollegin ab. Ist gerade kein weibliches Personal verfügbar, frage ich zuerst, ob es in Ordnung ist, wenn ich das EKG schreibe. Normalerweise lässt sich die Angelegenheit dann auch erledigen, ohne dass die Patientin sich ganz frei machen muss. Es genügt, wenn sie sich den BH auszieht – damit keine Metallteile das Signal stören – und die Bluse, den Pullover oder das T-Shirt beim Anbringen der Elektroden bis knapp über die Brust anhebt. So kann es gar nicht erst zu missverständlichen Situationen kommen.
Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass persönliche Grenzen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Eine junge Frau, die ich gerade über das anstehende EKG informiert hatte, stand mir bereits im nächsten Augenblick – bevor ich überhaupt irgendeine Frage hätte stellen können – »oben ohne« gegenüber. Ich versuchte, die Situation mit derselben Selbstverständlichkeit zu betrachten wie sie. Schließlich bist du hier der Profi, ermahnte ich mich. Wo kämen wir denn da hin, würdest du dich von einem Paar Brüste aus dem Konzept bringen lassen?
In diesem Fall handelte es sich allerdings um wirklich bemerkenswerte Brüste. Es war unmöglich, das zu übersehen, als sich die Patientin auf der Liege ausstreckte. Klar, dass da jemand nachgeholfen hatte, und zwar mit dem rechten Augenmaß. Wer auch immer hierfür die Verantwortung trug, hatte sein Handwerk verstanden und der Frau zwei Meisterstücke der plastischen Chirurgie verpasst. Wahrscheinlich ist sie stolz darauf und zeigt sie deswegen so freimütig her, dachte ich, während ich – jeden unangemessenen Blick und jede unnötige Berührung peinlich genau vermeidend – die Elektroden unter dem linken Busen platzierte. Kann man ja auch verstehen, die waren bestimmt ziemlich teuer.
Das Gerät begann, die EKG-Kurve auszudrucken. Die Patientin schien völlig entspannt und hatte sich zu keinem Zeitpunkt unangemessen verhalten. Gerade deshalb fühlte ich mich besonders in der Pflicht, mir nichts anmerken zu lassen. Doch diese Brüste waren längst zum sprichwörtlichen rosa Elefanten geworden, an den man nicht denken soll und den man gerade deshalb nicht aus dem Kopf bekommt.
Bald war der Ausdruck fertig, ich warf einen Blick darauf und erkannte sofort, dass etwas damit nicht stimmte. Offenbar hatte sich eine der Elektroden gelöst. Ich sah genauer hin. Verdammt, es handelte sich um die Elektrode V3. Die liegt genau unter der Brust.
»Entschuldigung«, wandte ich mich wieder an die Patientin. »Da hat sich etwas gelöst.« Ich deutete vage in Richtung der Elektrode. »Ich müsste dann noch mal …«
»Ja, klar.« Die Patientin lächelte mich völlig ungerührt an. »Kein Problem.«
Das galt vielleicht für sie. Ich dagegen wurde jetzt richtig nervös, während ich die betreffende Stelle erneut mit Kontaktspray einsprühte. Nur keine falsche Bewegung. Und vor allem: nicht noch eine der benachbarten Elektroden lockern. Sonst kommt sie auf den Gedanken, ich hätte das alles mit Absicht inszeniert. Je mehr ich mich bemühte, professionell zu bleiben, desto fahriger wurde ich. Erst zerriss mir ein Gummihandschuh, dann verhedderten sich zwei Kabel, dann drückte ich die falsche Taste am Drucker. Sobald man über jeden einzelnen Handgriff nachzudenken beginnt, lauern plötzlich überall Stolperfallen. Als ich am Ende trotz allem einen einwandfreien EKG-Ausdruck in der Hand hielt, war ich so erleichtert, als hätte ich das gerade zum ersten Mal gemacht.
Das sterile Umfeld, die unverwechselbare Arbeitskleidung, eine mit Fachausdrücken und Abkürzungen gespickte Sprache – sich im Krankenhaus hinter eine professionelle Fassade zurückzuziehen ist ziemlich leicht. Und oft ist das die einzige Möglichkeit, mit den Härten unseres Berufsalltags umzugehen. Doch diese Fassade bietet eben nicht nur Schutz. Sie verleitet uns auch dazu, unsere Patienten unter rein professionellen Gesichtspunkten zu betrachten, sie als wandelnde Symptome oder Diagnosen zu sehen. Die Fassade verstellt außerdem dort den Blick, wo wir selbst als ganz normale Menschen mit Stärken und Schwächen wahrgenommen werden möchten. Und wenn sie einmal unerwartet Risse bekommt – und sei es nur wegen eines Paares gekonnt modellierter Brüste –, geraten wir umso leichter aus dem Tritt.
Nun ist es aber genug. Ich sollte nicht so viel grübeln, sondern mich stattdessen um meine Arbeit kümmern. Blutproben müssen ins Labor geschickt werden, der Wartebereich füllt sich bedenklich, im morgigen Dienstplan klafft außerdem noch eine Lücke. Und nicht zu vergessen: In Zimmer acht liegt ein Darmverschluss.
Briefing: Die Zentrale Notaufnahme
Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) ist in Deutschland eine relativ junge Einrichtung. Ursprünglich waren Notaufnahmen in der Regel an den jeweiligen Fachbereich angegliedert und wurden von dessen Personal mitbetreut. So konnte es innerhalb eines Krankenhauses einen unfallchirurgischen, einen internistischen, einen urologischen Bereich und möglicherweise noch weitere zur Versorgung von Notfallpatienten geben.
Demgegenüber bietet die zentralisierte »Emergency Unit« – das angelsächsische Vorbild der ZNA – viele Vorteile. Pflegepersonal und Mediziner sind hier auf die Versorgung von Notfällen aus allen Fachrichtungen spezialisiert. Röntgengeräte und Computertomografen sind direkt vor Ort verfügbar. Deshalb ist in der ZNA eine schnelle und tiefgehende Diagnose und oft sogar die Einleitung einer Therapie möglich, bevor man die Patienten entweder entlässt oder zur weiteren Behandlung und Beobachtung auf eine Station verlegt.
Inzwischen hat sich dieses System auch in Deutschland flächendeckend durchgesetzt. Im Pflegebereich wurde eine Zusatzqualifikation mit dem Namen »Gesundheits- und Krankenpfleger/in für Notfallpflege« geschaffen, um den speziellen Anforderungen an das Personal in einer ZNA gerecht zu werden. Für Notfallstrukturen in Krankenhäusern gibt es seit 2018 drei Kategorien. Die Art und die Anzahl der Fachabteilungen der jeweiligen Klinik, die Anzahl und die Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals sowie die Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten sind für die Einstufung ebenso entscheidend wie die medizinisch-technische Ausstattung und die Strukturen und Prozesse der betreffenden Notaufnahme. Dieses Buch handelt von einer Notaufnahme der umfassenden Versorgungsstufe, also der höchsten Kategorie.
Der Idealtyp einer modernen ZNA ist nicht in Fachbereiche unterteilt, sondern hochflexibel: Jeder Patient kann überall behandelt werden, Pflegepersonal und Ärzte wissen mit jeder Art von Notfall umzugehen. Eine organisatorische – nicht räumliche – Zweiteilung in einen internistischen und einen unfallchirurgischen Bereich, wie sie in diesem Buch beschrieben wird, ist jedoch nicht unüblich. Letztlich liegt es in der Verantwortung und im Ermessen jeder Klinik, eine für sie passende und praktikable Organisationsform zu finden.