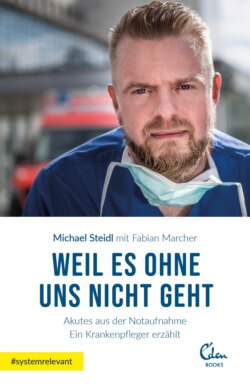Читать книгу Weil es ohne uns nicht geht - Fabian Marcher - Страница 7
Reingestolpert Wenn man mich fünf Minuten alleine lässt
ОглавлениеMein erster Tag auf der unfallchirurgischen Seite beginnt ruhig. Wir haben Frühschicht ab sechs Uhr. Weil noch keine Patienten da sind, kümmere ich mich mit Mike um die Wischdesinfektion der Oberflächen im Gipsraum, während er mir von der Feier erzählt, in die er gestern Abend reingestolpert ist.
»Reingestolpert?«
»Meine Nachbarin hatte Geburtstag. Wir wussten gar nichts von einem Fest. Dann haben wir uns über den Zaun hinweg unterhalten, es gab das eine oder andere Bier, und dann kam die Frage auf, warum wir eigentlich nicht rüberkämen …«
Mike wirft ein Desinfektionstuch in den Müll, nimmt ein neues aus der Packung und wischt damit sorgfältig die Kabel eines Überwachungsmonitors ab. »Ich hab zu meiner Frau gesagt: Morgen ist Frühdienst, bitte, sei du die Stimme der Vernunft! Aber nichts da, sie wollte auf jeden Fall hingehen. Und dann … Du weißt ja, wie das ist, wenn man erst mal zusammensitzt.«
Wir putzen weiter, nach einer Weile bricht Mike erneut das Schweigen.
»Ich bin froh, dass wir heute auf der Unfallseite sind. Hab vorhin kurz mit Steffen geredet. Du weißt schon, der rothaarige Internist.«
Ich nicke und beuge mich zu den Vorratsschränken für die Verbände hinunter. Meine Aufgabe ist, jeden Einzelnen der unzähligen Schubladengriffe sorgfältig zu desinfizieren.
»Die haben in der Nacht einen echt deprimierenden Fall reingekriegt«, fährt Mike fort. »Junge Frau, Mitte zwanzig, metastasierendes Lungenkarzinom im Endstadium. Ist wohl kollabiert. Jetzt liegt sie in der Nummer sieben.«
Wir putzen ein paar Minuten schweigend weiter, bevor er innehält, sich zu mir umdreht und sagt: »Das sind Sachen, die einen runterziehen können. Ich meine, wenn jemand alt ist und vielleicht auch noch Kettenraucher, dann … Aber die hatte ja noch nicht mal genug Zeit, um irgendwas falsch zu machen.«
Das Telefon in Mikes Brusttasche klingelt. Er streift seine Gummihandschuhe ab, wirft sie schwungvoll in den Abfallsack und geht ran.
»Ja?«
Er lauscht, zieht die Augenbrauen hoch und reckt den Zeigefinger in die Luft. Das ist kein gewöhnlicher Anruf.
»Schockraum«, flüstert er mir zu. Mike hat mir das Prozedere in solchen Fällen erklärt: Die Leitstelle benachrichtigt den zuständigen Unfallchirurgen, der spricht die Informationen auf Band und schickt diese Nachricht dann gleichzeitig an das Pflegeteam in der Notaufnahme und an alle weiteren Beteiligten in der sogenannten Schockraum-Schleife: Chef- und Oberarzt der Notaufnahme, Anästhesist und Anästhesiepfleger, Oberarzt der Unfallchirurgie, Radiologe, Abdominalchirurg, das Labor. So ist innerhalb von wenigen Minuten das ganze Team informiert.
Mike legt auf.
»Eine Frau, ungefähr fünfzig Jahre alt. Ist mit hundert gegen einen Baum gefahren. Die schneiden sie noch aus dem Auto. Bedingt ansprechbar.«
Ich spüre ein Kribbeln in Händen und Füßen, mir wird ein wenig mulmig. Aber bin ich nicht genau deshalb hier? Wollte ich nicht mit eigenen Augen sehen, wie in der Notaufnahme um Leben und Tod gerungen wird? Vielleicht ist es nun so weit.
»Alles klar«, sage ich, während ich ebenfalls meine Gummihandschuhe ausziehe. »Wir sind hier drin sowieso fertig, oder?« Mike sieht sich noch einmal prüfend um, nickt und verlässt das Zimmer.
Wenig später stehe ich neben ihm im Unfall-Schockraum. Noch sind wir allein. Er startet den Computer und überprüft, ob alles an seinem Platz ist. Im Vorbeigehen haben wir mitbekommen, dass der Tag auf der internistischen Seite langsam Fahrt aufnimmt. Gerade wird dort eine verwirrte ältere Frau mit hohem Fieber und Verdacht auf Meningitis eingeliefert. Weil ohnehin bereits zwei infektiöse, isolationspflichtige Patienten in Behandlung sind, bricht da drüben langsam Hektik aus.
Ein weiß gekleideter, durchtrainierter Mann betritt den Schockraum. Er dürfte nicht älter als 35 sein.
»Das ist Patrick«, sagt Mike, »der diensthabende Unfallchirurg.«
Ich stelle mich kurz vor, der Arzt begrüßt mich mit einem Nicken. Die Nacht sei ruhig gewesen, sagt er, er habe sogar recht viel Schlaf bekommen. Eine Minute darauf erscheint der Anästhesieassistent, dann treffen in kurzen Abständen weitere Mitglieder des Schockraum-Teams ein. Über den kommenden Einsatz wird nur andeutungsweise gesprochen. Jemand wirft einen Blick auf die Uhr über dem Eingang. »Noch zehn Minuten.«
Ich trete hinaus auf den Flur und blicke zu der Doppeltür, durch die die Sanitäter besonders schwere Fälle bringen. Das ist der kürzeste Weg zu den Schockräumen, außerdem bekommen auf diese Weise Angehörige und Patienten an der Sichtung und im Wartebereich weniger mit. Noch ist hier bei uns alles ruhig, anders als in der internistischen Abteilung, aus der ich immer wieder hektische Kommandos höre.
»Ich brauche ein Ultraschallgerät!«
»Ich habs doch vorhin schon gesagt: Wir haben kein freies Überwachungsbett. Die sollen auch mal woanders hinfahren, verdammt!«
»Christoph, schaust du schnell in den Großraum? Ich kann jetzt nicht weg.«
»Wo ist denn jetzt das Ultraschallgerät?«
Sieben Minuten. Mike hat mir schon vor Tagen erzählt, womit ich rechnen muss. Bei Motorradfahrern etwa trete manchmal die sogenannte Schmetterlingsfraktur auf, bei der der zertrümmerte Beckenknochen nach hinten auseinanderklappen könne, als habe er Flügel. Vorsorglich werde den Patienten vom Notarzt oder den Sanitätern ein stabilisierender Gurt umgebunden. Wenn man diese Beckenschlinge im Schockraum öffne, könne es jedoch passieren, dass innere Verletzungen aufbrächen und das Unfallopfer innerhalb von Sekunden verblute. Ich atme tief ein. Wieder dieses seltsame Kribbeln.
Ein Surren, und die Tür öffnet sich. Ein Rettungssanitäter erscheint, er zieht eine Trage hinter sich her, gefolgt von einer Kollegin und dem Notarzt. Sie sind fünf Minuten früher dran als angekündigt. Trotzdem ist alles bereit, das siebenköpfige Schockraum-Team ist komplett, alle mit Gummihandschuhen und weißen Plastikschürzen ausgerüstet. Ich trete ein paar Schritte zurück, um nur nicht im Weg zu stehen. Dann geht es sehr schnell.
Die Trage wird in den Schockraum geschoben. Die Verunglückte liegt darauf, eine Decke ist über ihren Körper gebreitet, ich kann ihr Gesicht und ihr glattes helles Haar sehen. Zunächst erscheint sie bewusstlos, beinahe friedlich schlafend, doch dann hebt sie die Lider und starrt die Leute an, die sich von allen Seiten über sie beugen. Ein ungläubiges Lächeln umspielt ihre Mundwinkel, bevor sie sich wieder in sich selbst zurückzieht.
Der Notarzt referiert in kurzen, prägnanten Sätzen, wie die Frau vorgefunden wurde, wie sich der Unfall wahrscheinlich abgespielt hat, wie ihr Zustand nach der ersten Beurteilung ist, welche Maßnahmen bereits ergriffen und welche Medikamente verabreicht wurden. Kreislauf den Umständen entsprechend stabil, keine schwerwiegenden äußeren Verletzungsanzeichen. Der Wagen hat sich wohl vor dem Aufprall zur Seite gedreht, sodass der Einschlag im hinteren Bereich erfolgte.
Einer der Sanitäter zeigt den Bildschirm des NIDApads in die Runde, darauf ist ein Foto vom Unfallort zu sehen. Der rote Kleinwagen ist total verformt, hat sich um den Baumstamm gewickelt. Dass die Frau in augenscheinlich gutem Zustand aus diesem Wrack herausgeholt werden konnte, erscheint mir wie ein Wunder.
Jemand nimmt die Decke weg. Die Kleidung der Frau wird aufgeschnitten und in einen Plastikbeutel gesteckt, ihr nur noch mit einem Slip bekleideter Körper auf Spuren von Verletzungen untersucht. Dann wird ihr ein knallrotes Umlagerungsbrett aus Kunststoff untergeschoben.
»Drei, zwei, eins, jetzt!«
Mit vereinten Kräften zieht das Team die Frau von der Trage auf die Schockraum-Liege. Jede Bewegung wirkt routiniert, alle wissen genau, was sie zu tun haben. Patrick überprüft noch einmal kritische Stellen auf eventuelle Knochenbrüche, währenddessen wird eine Infusion vorbereitet, die Radiologieassistentin öffnet die Zwischentür, die Schockraum und CT-Bereich trennt. Wenig später steht die Liege bereits direkt vor dem Computertomografen, das ganze Team wechselt den Raum, nur ich bleibe zurück.
Durch ein Fenster in der nun wieder geschlossenen Zwischentür kann ich beobachten, wie sie das Unfallopfer für die Untersuchung vorbereiten. Zuerst scheint alles glattzugehen, doch plötzlich entsteht Unruhe. Durch die Tür kann ich die Aufregung in den gedämpften Stimmen der Ärzte und Pfleger hören.
Die Patientin bewegt sich, einen Augenblick lang sieht es so aus, als wolle sie sich aufrichten. Mehrere Hände helfen ihr, sich auf die linke Seite zu rollen, jemand greift nach einem Plastikbeutel und hält ihn ihr vor das Gesicht. Die Frau übergibt sich hinein. Drei Mal innerhalb von einer Minute. Schließlich wird sie wieder behutsam auf den Rücken gedreht, und die Vorbereitungen für die Computertomografie laufen weiter.
Etwas später hat sich das Schockraum-Team in den Beobachtungsbereich zurückgezogen, das CT-Gerät arbeitet. Nur Mike steht nun draußen neben mir und späht ebenfalls durch das kleine Fenster.
»Sie ist bei Bewusstsein?«, frage ich.
»Ja, die meiste Zeit schon«, antwortet Mike, ohne den Blick vom Geschehen abzuwenden, »aber sie steht total neben sich. Kann sich an nichts erinnern. Wir haben sie gefragt, wohin sie wollte, was sie vorhatte, aber da kam nichts. Sie weiß nicht mal, welcher Tag heute ist. Kein Wunder bei der Geschwindigkeit. Und dann fast ungebremst gegen den Baum.«
»Meinst du, es war Absicht?«
Mike schüttelt den Kopf und deutet auf eine transparente Tüte, die die Sanitäter in einer Ecke des Schockraums abgestellt haben, bevor sie gegangen sind.
»Da sind die persönlichen Sachen aus dem Auto drin. Ein Rucksack, Turnschuhe, Sportklamotten. Das nimmt man nicht mit, wenn man sich umbringen will.«
Stimmt. So etwas hat man dabei, wenn man an seinem freien Tag irgendwo ein bisschen Sport treiben möchte oder wenn man zu einer leichten Wanderung in die Berge aufbricht. Man packt seine Tasche, greift nach den Autoschlüsseln, verlässt das Haus. Vielleicht verabschiedet man sich vorher noch vom Partner und von den Kindern, wechselt am Gartentor ein paar Worte mit der Nachbarin. Ohne auf den Gedanken zu kommen, dass es das letzte Mal sein könnte.
Als der Computertomograf fertig ist, stößt Mike wieder zum Team. Ich bleibe allein im Schockraum zurück und starre in Gedanken versunken auf die Tüte mit den Sportsachen. Irgendwann merke ich, dass meine Kehle total ausgetrocknet ist. Im Pausenraum habe ich eine Wasserflasche abgestellt. In einer Minute werde ich zurück sein. Auf dem Weg komme ich am Organisationstresen vorbei. Dahinter, im internistischen Bereich, herrscht jetzt totales Durcheinander. Eine Ärztin beklagt sich bei zwei Sanitätern, die gerade einen weiteren Pflegefall abgeliefert haben.
»Was stellen die sich vor? Erst melden sie einen Schockraum an – und schicken uns dann noch drei Rettungswagen! Hier stehen eh schon alle kopf. Wie sollen wir das schaffen?«
Die beiden Sanitäter zucken betreten mit den Schultern, ihr Gesichtsausdruck gibt die Antwort: Wir können nichts dafür, wir machen auch nur unseren Job. Ich hole meine Wasserflasche aus dem Pausenraum, nehme sie mit hinaus zum Organisationstresen, wo ich sie öffne und einen Schluck trinke.
»He, du – kannst du mir vielleicht helfen?«
Eine atemlose Frauenstimme in meinem Rücken. Ich drehe mich um. Es dauert einen Moment, bis ich hinter der hellgrünen Mund- und Nasenschutzmaske das Gesicht einer jungen Neurologin erkenne, die ich während der vergangenen Tage bereits ein paarmal gesehen habe. Miteinander gesprochen haben wir allerdings noch nie.
»Ja, natürlich«, antworte ich. Dann denke ich an mein wohl irreführendes Pfleger-Outfit und füge hinzu: »Aber ich bin nicht vom Fach, deswegen weiß ich nicht …«
»Hast du Angst vor Nadeln?«
»Nein.«
»Kannst du eine ältere Frau festhalten?«
»Ja, ich denke schon. Aber …«
»Dann kannst du mir helfen. Aber du musst dir Schutzkleidung anziehen. Komm!«
Kurz darauf stehen wir im internistischen Bereich, direkt vor dem Behandlungsraum Nummer zwei. Ich kämpfe mit dem langärmligen grünen Kunststoffkittel, während ich erfahre, dass es um die vorhin eingelieferte vermeintliche Meningitis-Patientin geht. Wegen der Möglichkeit einer Infektion wurde sie isoliert – was bedeutet, dass man ihr Zimmer nur mit Schutzkleidung betreten darf und im Umgang mit ihr auch ansonsten strenge Hygienestandards gelten.
»Ich muss eine Lumbalpunktion vornehmen, damit wir eine Meningitis ausschließen können«, erklärt die Neurologin. »Leider ist die Frau sehr unruhig und etwas verwirrt. Da habe ich allein keine Chance. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sich nicht bewegt, solange der Eingriff dauert.«
Eine Lumbalpunktion habe ich in den letzten Tagen bereits zweimal aus sicherer Entfernung beobachtet. Dabei wird eine ziemlich lange Nadel in den Lendenwirbelbereich des Patienten eingeführt, um Liquor, also Rückenmarksflüssigkeit, zu entnehmen und vom Labor untersuchen zu lassen. Da jeweils fünf bis sechs Proben genommen werden, dauert das etwa eine Viertelstunde. Allerdings waren die Patienten, bei denen ich den Eingriff verfolgen konnte, relativ jung und haben die ganze Zeit über brav stillgehalten.
»So, jetzt noch Handschuhe, dann gehts los.«
Ich habe mir inzwischen ebenfalls eine Mund- und Nasenschutzmaske angelegt. Nun nehme ich mir gelbe Einweg-Gummihandschuhe der Größe L aus dem Karton und ziehe sie mir über. In der Milchglastür, die den Behandlungs- vom Wartebereich trennt, sehe ich mein Spiegelbild. Es erinnert mich an Klausjürgen Wussow alias Dr. Brinkmann in seinem OP-Outfit im Vorspann der Schwarzwaldklinik. Ich schüttle den Kopf. Was tue ich hier?
»Los, nur Mut!«
Die Neurologin steht bereits im Behandlungsraum und wartet ungeduldig auf mich. Ich sehe mich noch mal um. Es geschieht kein Wunder, niemand erlöst mich. Kein Mensch hat überhaupt die Zeit, Notiz von mir zu nehmen. Abgesehen davon, dass in meinem jetzigen Aufzug sowieso keiner merkt, dass ich nur der Autor bin, der hier seit ein paar Tagen neugierig herumschleicht. Ich drehe mich wieder um und betrete das Behandlungszimmer.
»Das ist Frau Brenner«, sagt die Neurologin. Und dann, zu der mit dem Überwachungsmonitor verkabelten Dame im hellblau geblümten Nachthemd gewandt, die mich von ihrer Liege aus etwas verschreckt anstarrt: »Frau Brenner, wir müssen nun eine Lumbalpunktion bei Ihnen vornehmen. Ich habe mir den Kollegen geholt, der mir dabei helfen wird. In Ordnung?«
Frau Brenner zeigt keine Regung, sie starrt mich noch immer unverwandt an. Ich habe nicht den Eindruck, dass der zierlichen alten Frau mit den verstrubbelten, rötlich gefärbten Haaren der Begriff »Lumbalpunktion« etwas sagt. Ich bin nicht einmal sicher, dass sie weiß, wo sie sich befindet.
»Grüß Gott.« Ich versuche mich an einem vertrauenerweckenden Lächeln. Keine Reaktion.
Die Neurologin hat einen OP-Beistelltisch neben die Liege gefahren und darauf die Liquor-Röhrchen und die für die Punktion nötigen sterilen Instrumente bereitgelegt.
»Gut, dann fangen wir jetzt an.« Sie bemüht sich, deutlich zu sprechen. »Wir müssen Sie auf die Seite drehen, Frau Brenner.« Sie bedeutet mir, mit anzufassen.
»Ich muss dann mal raus!« Die Stimme der alten Dame klingt erstaunlich forsch.
Die Neurologin seufzt, sieht erst mich an, dann Frau Brenner. »Müssen Sie auf die Toilette?«
»Ja.«
Auf der Stirn der Ärztin erscheinen kleine Schweißtropfen. Auch ich merke, wie sich meine Körperwärme unter der Schutzkleidung zu stauen beginnt.
»Groß oder klein?«
»Ja.«
Okay, das dürfte länger dauern. Natürlich könnten wir das Anliegen der alten Dame als Folge ihrer offensichtlichen Verwirrung abtun. Andererseits ist es vielleicht die Ursache für Frau Brenners Unruhe. Immer wieder versucht sie aufzustehen und muss mit beruhigenden Worten und sanftem Druck überzeugt werden, liegen zu bleiben. Wenn ich ihren Arm berühre, spüre ich durch den Gummihandschuh die Hitze ihres fiebrigen Körpers.
Die Ärztin schickt mich raus, ich soll eine Bettpfanne besorgen. Dazu muss ich den Isolierbereich verlassen und die Schutzkleidung wieder ablegen. Dann wende ich mich an eine vorbeihetzende Pflegerin, die sofort abwehrend die Hände hebt. »Tut mir leid, ich habe jetzt wirklich keine Zeit!«
Ich stelle mich ihr in den Weg und erkläre mit knappen Worten, was ich brauche. Sie hält gezwungenermaßen inne, öffnet eine Schublade in einem Schrank gegenüber dem Organisationstresen, holt eine Bettpfanne heraus und drückt sie mir mit einem knappen »Viel Glück!« in die Hand. Eine Sekunde später sehe ich sie nicht mehr.
Mit einem neuen Satz Schutzkleidung ausgerüstet, versuche ich kurz darauf, Frau Brenner, der ich gemeinsam mit der Ärztin die Erwachsenenwindel abgenommen habe, die Bettpfanne unterzuschieben.
»Ich muss mal raus«, sagt Frau Brenner, strampelt mit beiden Beinen und will sich wieder aufrichten. Für ihren Zustand und ihr Alter ist sie erstaunlich kräftig.
»Es hilft nichts«, seufzt die Neurologin. »Wir brauchen einen Toilettenstuhl.«
Es ist klar, wer den besorgen wird. Ich nicke und mache mich auf den Weg, entledige mich draußen erneut des Mund- und Nasenschutzes, der Schürze und der Handschuhe. Dann laufe ich in Richtung des Nebeneinganges, wo sich ein als Materiallager genutztes Zimmer befindet.
»Wo kommst du denn her?«
Mike steht auf dem Flur und starrt mich entgeistert an.
»Das willst du nicht wissen.«
»Mann, da lässt man dich mal fünf Minuten alleine …«
»Ich brauche einen Toilettenstuhl.«
Wortlos kehrt Mike um und begleitet mich. Eine Minute später habe ich mir zum dritten Mal neue Schutzkleidung übergezogen, schiebe den Stuhl, dessen Sitzfläche eine verschließbare Kunststoffschüssel bildet, in Behandlungsraum Nummer zwei, stelle ihn neben Frau Brenners Liege ab, blockiere die Räder mit den Feststellbremsen und hieve die alte Dame gemeinsam mit der Neurologin darauf. Während wir anschließend darauf warten, dass Frau Brenner ihr Geschäft erledigt, spricht die Ärztin ohne Unterlass.
»Ich weiß nicht, wie das klappen soll, so agitiert, wie die ist. Aber in einer halben Stunde muss ich zur Visite mit dem Oberarzt, bis dahin muss die Lumbalpunktion erledigt sein. Obwohl es nur darum geht, die Meningitis auszuschließen, die sie meiner Ansicht nach sowieso nicht hat. Ich tippe auf einen Harnwegsinfekt. So gesehen ist sie eigentlich gar nicht meine Patientin, sondern ein Fall für die Urologie …«
Wir lassen ein paar Minuten vergehen, das Ergebnis ist eine winzige Urinlache im Auffangbehälter des Toilettenstuhls. Dafür hat sich die ganze Aktion kaum gelohnt. Immerhin haben wir etwas gelernt: Wenn Frau Brenner sitzt, bewegt sie sich deutlich weniger. Das könnte unsere Chance sein. Wir heben sie wieder zurück, legen ihr mit einiger Mühe eine neue Windel an und setzen sie dann auf die Bettkante. Von draußen dringt gedämpft das Geräusch schwerer Stiefel herein, begleitet vom Quietschen und Klappern einer Trage. Die Rettungssanitäter bringen schon wieder Nachschub.
»Ab jetzt gut festhalten!«, ermahnt mich die Neurologin. »Das ist wichtig.«
Ich fasse Frau Brenner mit beiden Händen an den Oberarmen und blicke ihr in die Augen.
»Frau Brenner, die Ärztin wird jetzt einen kleinen Eingriff vornehmen«, erkläre ich. »Und solange das dauert, legen Sie bitte Ihre Arme um mich und halten sich an mir fest. In Ordnung?«
Ich lächle, dann fällt mir ein, dass der verdammte Mundschutz meine Mimik unsichtbar macht. Frau Brenner reagiert auch nicht, sondern starrt mich nur an und sagt: »Ich muss raus!«
»Das geht nicht, Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden, bis die Ärztin fertig ist. Zwischendurch spüren Sie vielleicht ein Piksen im Rücken, aber dann halten Sie sich einfach an mir fest. Ich denke, das kriegen wir hin, oder?«
Ich lächle wieder, diesmal versuche ich, es vor allem mit meinen Augen zu tun. Und tatsächlich: Frau Brenners Mundwinkel zucken für einen Moment nach oben, sie nickt. Das kriegen wir hin, wiederhole ich in Gedanken, wie um mich selbst zu überzeugen. Die Ärztin hat Frau Brenners Nachthemd hochgezogen, um ihren Rücken freizulegen. Ich greife nach dem Stoff, wobei ich meine Arme um die alte Frau lege. Sie beugt sich nach vorn, drückt ihre Stirn auf meine Brust. Das ist die optimale Position, auf dem abgerundeten Rücken zeichnen sich deutlich die einzelnen Wirbel ab. Die Neurologin desinfiziert die gesamte Umgebung der Lendenwirbelsäule großflächig mit einer bräunlichen Flüssigkeit. Dann nimmt sie die beeindruckend lange Nadel in ihre rechte Hand, während sie mit der linken die richtige Stelle für die Punktion ertastet. Jetzt geht alles sehr schnell: Frau Brenner zuckt zusammen, die Nadel steckt, eine Kanüle wird nachgeschoben. Kurz darauf tropft die Rückenmarksflüssigkeit langsam, aber stetig in das erste der fünf Röhrchen.
Die Patientin stöhnt, bewegt sich, streicht immer wieder mit ihrer Hand das dunkelgrüne Tuch auf ihrer Liege glatt, als sei es eine Tischdecke. Eine Übersprunghandlung, eine Geste, die sie in einem anderen, selbstbestimmten Leben zehntausend Mal ausgeführt hat.
»Sie machen das sehr gut, Frau Brenner.« Schweiß läuft mir von der Stirn in meine Augen, mein eigener Rücken beginnt zu schmerzen. Durch den Mund- und Nasenschutz bekomme ich kaum genügend Luft, aber immerhin dämpft er die unangenehme, durch das Behandlungszimmer wabernde Mischung aus Schweiß- und Uringeruch. Die Ärztin ist beim vierten Röhrchen angelangt, drei liegen bereits gefüllt nebeneinander. Die Flüssigkeit in der ersten Probe ist durch die Blutung der Einstichstelle ein wenig rötlich gefärbt, in den anderen ist sie glasklar.
»Noch ein bisschen durchhalten, bald haben Sie es geschafft.« Ich rede, als wüsste ich, was hier vor sich geht. Ob meine Worte Frau Brenner beruhigen, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls hält sie still.
Wie lange dauert das noch? Immer wieder dringt Stimmengewirr von draußen durch die Tür, mischt sich mit dem unablässigen Piepsen des EKG-Geräts und dem gelegentlichen Ächzen der fiebrigen Frau in meinen Armen.
»So, das wars.« Die Ärztin zieht die Kanüle heraus, desinfiziert die Einstichstelle und klebt ein steriles Pflaster darauf. Dann zieht sie Frau Brenners Nachthemd herunter. »Sie dürfen sich jetzt wieder hinlegen.«
Ich helfe Frau Brenner dabei, sich umzudrehen, und lasse sie dann vorsichtig auf die Liege sinken. »Das haben Sie wirklich sehr gut gemacht.« Zwei wässrige blaue Augen blicken mich fragend an, als hätten sie mich gerade erst bemerkt.
»Alles in Ordnung?«, erkundige ich mich. Die Antwort beschränkt sich auf ein leises Seufzen.
»Kann ich hier noch etwas tun?«, frage ich die Neurologin, die dabei ist, die Liquor-Röhrchen mit den Patientenaufklebern zu versehen. Sie schüttelt den Kopf. »Danke, jetzt komme ich allein zurecht.«
Ich nicke. »Auf Wiedersehen, Frau Brenner. Und alles Gute.«
Draußen ziehe ich die Schutzkleidung aus, werfe sie in den Müll. Erst Schürze und Handschuhe, dann den Mund- und Nasenschutz. Mein hellblaues Oberteil ist durchnässt. Um mich herum herrscht noch immer hektischer Betrieb, das Pflegepersonal eilt zwischen den Behandlungsräumen hin und her, ein Oberarzt studiert gemeinsam mit einer jungen Assistenzärztin einen EKG-Ausdruck, eine Frau vom Transportdienst schiebt einen älteren Herrn im Rollstuhl in Richtung Ausgang. Ich sehe Mike, wie immer in Eile.
»Und, wie gehts?«, erkundigt er sich im Vorübergehen.
»Keine Ahnung.«
Er lacht trocken auf, nickt und verschwindet in Richtung des unfallchirurgischen Bereiches. Ich wische mir mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn und halte mitten in der Bewegung inne. Irgendetwas hat sich verändert, plötzlich ist es so merkwürdig still. Im Augenwinkel nehme ich wahr, dass von links – aus dem Behandlungsraum Nummer sieben – eine Liege den Flur entlang in Richtung Ausgang geschoben wird. Reflexartig trete ich einen Schritt zurück.
Die junge Frau mit dem metastasierenden Lungenkarzinom wird auf eine Station verlegt. Der Rückenteil ihrer Liege ist so weit aufgestellt, dass sie beinahe aufrecht sitzt. So kann jeder gut erkennen, dass unter ihrem brünetten lockigen Haar aus einem bleichen Gesicht zwei sehr erschöpft wirkende und von tiefen Ringen gezeichnete Augen hervorblicken. Während der zehn, fünfzehn Sekunden, in denen sie über den Flur rollt, schafft es niemand, nicht zu ihr hinzusehen. Obwohl jedem von uns klar sein dürfte, dass sie das leid ist. Wahrscheinlich ist es genau diese Art, angesehen zu werden, die sie – abgesehen von den sich ausbreitenden Tumoren in ihrem Körper und der Therapie, die dagegen ankämpfen soll – so unendlich müde macht. Die Mitarbeiterin des Transportdienstes drückt auf den Schalter an der Wand, die Ausgangstür öffnet sich, sie schiebt die Liege hindurch, alle wenden sich wieder ihrer Arbeit zu.
Gleich werde ich mich hinter den Organisationstresen setzen, mein Notizheft zücken und mir ein paar Stichworte aufschreiben. Der Signalton des Arrivalboards wird in unregelmäßigen Abständen die Ankunft von Alkoholvergiftungen, Kreislaufschwächen und Dehydrierungen ankündigen. Ich werde zusehen, wie der Unfallchirurg Röntgenbilder begutachtet und sich mit dem Radiologen bespricht. Ich werde beobachten, wie er Platzwunden näht und den beim Fußballspielen gebrochenen Arm eines 13-jährigen Jungen untersucht, den eine Pflegerin danach sorgfältig mit einem Kunststoffverband versieht. Irgendwann werde ich Hunger bekommen und im Pausenraum auf Mike treffen, der sich ein halbes Hähnchen aus der Kantine geholt hat. Ich werde mein Käsebrot auspacken, und Mike wird mir von Problemen mit dem Dienstplan erzählen, wegen derer sich alle Welt bei ihm beschwere, obwohl er nun wirklich nichts dafürkönne. Dann wird mir die Frau aus dem Schockraum wieder einfallen, der Autounfall von heute Morgen, der für ungefähr eine halbe Stunde meine ganze Aufmerksamkeit absorbiert hatte und dann total in den Hintergrund gedrängt wurde.
»Was hat eigentlich das CT ergeben?«
»Was? Ach so, das. Keine Auffälligkeiten. Die Frau hat echt Glück gehabt. Ist schon auf der Station.«
Ich werde mein Heft aus der Tasche ziehen, eine Seite zurückblättern und eine entsprechende Notiz eintragen. Die Patientin aus dem Schockraum werde ich nie wiedersehen. Genau wie Frau Brenner, die noch immer in Behandlungsraum Nummer zwei liegt und deren Rückenmarksflüssigkeit gerade auf dem Weg ins Labor ist. Dort wird man keine Meningitis-Erreger finden.
5. März 2020 – Gut und schlecht zugleich (Michael Steidl)
Irgendjemand hat das Desinfektionsmittel geklaut. Der Spender auf der Toilette ist leer gepumpt bis auf den letzten Tropfen. Das ist leider nichts Neues mehr. Seit in den Drogeriemärkten und Apotheken Desinfektionsmittel ausverkauft sind, verlieren einige Leute offenbar jegliche Skrupel. Eine Kollegin von einer unserer Stationen hat mir gestern erzählt, bei ihnen sei sogar Wasser nachgefüllt worden, damit man den Diebstahl nicht gleich bemerkt. Anderswo hat man einfach den ganzen Spender mitgenommen. Auch Mund- und Nasenschutzmasken sind schon abhandengekommen. Ist es nicht rücksichtslos genug, dass die Leute angefangen haben, Nudeln und Toilettenpapier zu horten, als gäbe es schon morgen nichts mehr?
Inzwischen werden unsere Vorräte im Krankenhaus knapp, neue Lieferungen lassen auf sich warten. Eine Klinik, in der es an so elementaren Dingen wie Masken und Desinfektionsmittel fehlt, kann lebensrettende Maßnahmen nicht mehr durchführen. Das betrifft dann nicht nur Corona-Patienten, sondern alle. Ich frage mich, ob das denen, die uns bestehlen, klar ist. Morgen schon könnten sie selbst oder ihre Freunde, Eltern, Ehepartner oder Kinder auf unsere Hilfe angewiesen sein.
Gerade komme ich von einer Besprechung. Bisher gab es bei uns keinen bestätigten Corona-Fall, doch die Notaufnahme und die gesamte Klinik bereiten sich auf den Umgang mit einer hohen Zahl infektiöser Patienten vor. Dafür schaffen wir jetzt neue Strukturen und Kapazitäten.
Eine Station der Klinik wird so zügig wie möglich frei gemacht, in den dortigen Zimmern sollen dann Verdachtsfälle und bestätigte Corona-Patienten behandelt werden. In der Notaufnahme werden wir den internistischen Bereich teilen: die Behandlungsräume zwei bis acht für mögliche und bestätigte Covid-19-Patienten, für andere internistische Fälle bleibt dann noch der Großraum.
Heute Morgen kam eine Frau zu uns. In der fünften Woche schwanger, seit gestern plötzlich hohes Fieber. Die Standardprozedur ist derzeit: zuerst der Influenza-Schnelltest, der in einer knappen Viertelstunde ein Ergebnis bringt. Sollte der negativ ausfallen, folgt noch der deutlich sensitivere Influenza-Labortest, auf dessen Resultat wir etwa zwei Stunden warten. Ist auch dieser negativ, müssen wir bei entsprechenden Symptomen auf Corona testen und den Patienten isolieren, bis wir das Ergebnis haben.
Bei der schwangeren Patientin schlug bereits der Schnelltest an: Influenza. Sie war erleichtert, wir irgendwie auch. Obwohl es keinen Grund zur Entwarnung gibt, denn in ihrem Zustand ist eine Grippeinfektion keineswegs zu unterschätzen. Es gibt Nachrichten, die gut und schlecht zugleich sind.
Eine eindeutig positive Neuigkeit: Unsere hausinterne Apotheke stellt ab sofort selbst Desinfektionsmittel her.