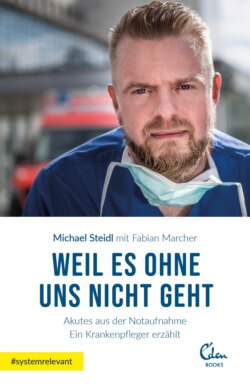Читать книгу Weil es ohne uns nicht geht - Fabian Marcher - Страница 8
Dommel Whisky, Koks und Panzerglas
Оглавление»Verdammt, der macht mir die Einrichtung kaputt!«
Ich stemme mich gegen den Griff der Schiebetür von Behandlungsraum drei. Meine ganze Kraft ist nötig, um den Patienten am Ausbruch zu hindern. Bis eben hat er, begleitet von lautem Gebrüll, immer wieder heftig an der Tür gerissen. Inzwischen ist er dazu übergegangen, die mit Rollen ausgestattete Patientenliege wie ein mittelalterliches Belagerungsinstrument gegen die Wand zu rammen. Auch damit wird er nichts erreichen. Aber die Erschütterungen und der Lärm sind beeindruckend.
Ich mache mir Sorgen um das Inventar des Behandlungsraums. Diese Zimmer sind in der Notaufnahme zwar spartanisch eingerichtet – schließlich müssen sie nach jedem infektiösen Patienten grundgereinigt werden, und das soll schnell und unkompliziert ablaufen. Trotzdem befinden sich da drin nicht nur ein Hocker, ein Infusionsständer und die Patientenliege, sondern auch ein Computer mit Bildschirm und Tastatur sowie der Überwachungsmonitor. Wenigstens ist der Versorgungswagen bereits in Sicherheit. Er steht hinter mir auf dem Flur. Bei Patienten mit Drogenproblematik entfernen wir ihn vorsorglich aus dem Behandlungsraum, damit sie sich nicht unbemerkt an unserem Material bedienen können.
Mein Kollege Christoph hat den Lärm gehört. Er kommt aus Richtung des Großraums gestürmt und greift, ohne lange nachzufragen, mit zu – gerade rechtzeitig, denn der Patient zerrt jetzt wieder wie verrückt an der Tür.
»Wow!«, entfährt es Christoph. »Da ist wohl jemand in den Zaubertrank gefallen.«
»Whisky und Kokain«, präzisiere ich. »Anscheinend eine ziemlich explosive Mischung.«
Wir müssen nicht mehr lange durchhalten. Bernd, der Oberarzt, hat bereits die Polizei benachrichtigt, normalerweise sind die Beamten in solchen Fällen innerhalb sehr kurzer Zeit bei uns.
Der Mann, der sich in Behandlungsraum drei austobt, heißt Dominik Schubert, ist 26 Jahre alt und wird von seinen Freunden »Dommel« genannt. Das habe ich mitbekommen, als sie ihn vorhin bei uns abgeliefert haben.
Eine gemütliche Runde im privaten Rahmen sei ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, erzählte die junge Dame, die das Vergnügen hatte, Herrn Schubert in die Klinik zu fahren. Von einigen sei ziemlich viel Whisky konsumiert worden, und ihr Bekannter habe sich dazu wohl noch die eine oder andere Line Koks gegönnt. Das hätten sie erst bemerkt, als er plötzlich stark schwitzend auf der Couch saß und über Herzrasen klagte.
Der Spitzname »Dommel« klingt nicht besonders Furcht einflößend. Eher gutmütig und vielleicht ein bisschen tollpatschig. Die große, breitschultrige Gestalt des Mannes verstärkt diesen Eindruck. Die wohl durch den Drogenkonsum bedingte Erweiterung seiner Pupillen – unter Fachleuten Mydriasis genannt – war nicht zu übersehen. Während der Überprüfung seiner Vitalwerte und der ersten Untersuchungen zeigte er sich zwar gelegentlich etwas konfus, aber keineswegs aggressiv. Doch dann verwandelte er sich plötzlich in Mister Hyde.
Ich weiß nicht, ob es Bernds Ankündigung eines Blut- und eines Urintests war, die Herrn Schuberts seelisches Gleichgewicht kippen ließ. Wahrscheinlicher ist, dass der Kokainrausch von seiner ersten, meist durch Euphorisierung des Konsumenten geprägten Phase in die zweite übergegangen ist, die gelegentlich von Wahnvorstellungen begleitet wird.
Dazu kommt der Mischkonsum. Alkohol fördert bei vielen Menschen die Aggressivität. Das wird normalerweise durch die kurz darauf einsetzende, ebenfalls alkoholbedingte Erschöpfung abgemildert – was das aufputschende Kokain jedoch verhindert. In der Tat eine teuflische Kombination.
Alkohol- und Drogeneinfluss sind häufige Ursachen für Gewalt durch Patientinnen oder Patienten gegen das Personal der Notaufnahme. Doch sie sind bei Weitem nicht die einzigen. Eine 2019 veröffentlichte Studie bekräftigt, dass »Notaufnahmen als Hochrisikobereich für Gewalt am Arbeitsplatz« gelten. Die Aggression muss sich nicht immer durch körperliche Gewalt Bahn brechen, oft kommt es »nur« zu verbalen Entgleisungen. Beschimpfungen und Drohungen sind fast an der Tagesordnung, gelegentlich werden wir auch angespuckt oder mit dem nächstbesten Gegenstand beworfen. Vor allem das weibliche Personal muss sich zudem mit sexuellen Übergriffen auseinandersetzen, hier reicht die Bandbreite von anzüglichen Bemerkungen bis zum hemmungslosen Begrapschen.
Auslöser können bereits Kleinigkeiten sein. Ich habe schon erlebt, dass eine Sichtungskraft als »Nazischlampe« bezeichnet wurde, weil sie ihrer Aufgabe, den Zutritt zum Behandlungsbereich zu regulieren, nachgekommen ist. Eine Ärztin, die sich bei einem etwa sechzigjährigen Patienten danach erkundigte, ob seine Frau seine Versicherungskarte mitbringen könne, musste sich die Frage gefallen lassen, ob das hier ein Krankenhaus oder die Stasizentrale sei.
Meiner persönlichen Erfahrung nach hat die Gewaltbereitschaft gegenüber dem Personal der Notaufnahme in den vergangenen Jahrzehnten definitiv zugenommen. Wenn ich die Nachrichten verfolge, sehe ich mich in dieser Empfindung bestätigt: Nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch bei den Rettungsdiensten und Feuerwehren waren Auseinandersetzungen mit aggressiven Patienten, Angehörigen oder Schaulustigen in den vergangenen Jahren immer häufiger ein Thema. Medien und Politik prangern diese Tatsache inzwischen gleichermaßen an – doch welche Ursachen dem Anstieg der Gewalt gegen Helfende zugrunde liegen, ist schwer zu benennen. So bleibt uns kaum etwas anderes übrig, als uns bestmöglich auf derartige Situationen vorzubereiten.
Seit einiger Zeit bietet unsere Klinik für ihr Personal Kurse zur Gewaltprävention und Deeskalationstraining an. Außerdem gibt es Handlungsanweisungen zum Umgang mit aggressiven Patienten. An der Sichtung – einem Brennpunkt, den meist nur eine Pflegekraft betreut – wurde zusätzlich zu einer Kamera und einer Panzerglasbarriere ein Notschalter installiert, der im Behandlungsbereich einen Alarm auslöst. Wird er betätigt, sind wenige Sekunden später alle verfügbaren Kollegen vor Ort. Solche Vorkehrungen beruhigen. Und sie haben sich bereits bewährt – besonders während des großen Volksfestes im Herbst, wenn der Zustrom teils heftig betrunkener Patienten zwei Wochen lang kaum abreißt.
Bei alldem darf man nicht vergessen, dass wir als Personal keineswegs immer das erste und eigentliche Ziel der Gewalt sind. Manchmal entsteht die Aggression auch unter den Patienten oder den Wartenden. Viele Menschen auf engem Raum, Anspannung wegen des Notfalls, der sie hergebracht hat – die Gemengelage im Wartebereich oder im Großraum des Behandlungsbereiches kann sich durchaus leicht entzünden.
Besonders kritisch wird es, wenn beide Parteien einer körperlichen Auseinandersetzung zugleich behandelt werden müssen. Im besten Fall sorgt bereits die Leitstelle dafür, dass das in verschiedenen Kliniken geschieht. Doch oft bleibt die Brisanz der Situation zunächst unbemerkt, oder ein Transport in unterschiedliche Notaufnahmen ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.
Natürlich werden die beiden Kontrahenten bei uns räumlich getrennt. Aber als zuständige Pflegekraft muss ich weiterhin den Überblick behalten. Schließlich sollte ein betreffender Patient, auch wenn er etwas später vom Unfallchirurgen zum Röntgen geschickt wird, dort nicht auf denjenigen treffen, dem er die Jochbeinprellung oder seinen angeknacksten Kiefer zu verdanken hat. Manchmal kann Gewaltprävention tatsächlich so einfach sein.
Glücklicherweise haben wir einen guten Draht zur örtlichen Polizeidienststelle. Die Streifenbeamten kommen ohnehin fast täglich zu uns. Mal liefern sie behandlungsbedürftige Personen ab, die sie aufgegriffen oder in Gewahrsam genommen haben, mal wird eine Polizistin oder ein Polizist im Dienst verletzt, mal müssen wir die Beamten rufen, weil eine Patientin oder ein Patient sich selbst oder andere gefährdet. So wie heute. Den etwa dreißigjährigen Beamten in Uniform, der in diesem Moment neben mir auftaucht, habe ich tatsächlich schon häufig gesehen.
»Servus miteinander«, grüßt er lässig, während er mit ernstem Blick blitzschnell die Lage beurteilt. Ihm folgt eine etwas jüngere, mir noch unbekannte Kollegin, im Hintergrund registriere ich zwei weitere Uniformierte. Das Auftreten zu viert hat Methode, oft wirkt bereits die unübersehbare Präsenz der Polizei deeskalierend.
Christoph und ich erwidern den Gruß ein wenig gequält. Unser Patient reißt immer noch mit voller Kraft an der Tür, und wir stemmen uns immer noch gemeinsam dagegen.
Der Beamte zieht sich Lederhandschuhe über und erkundigt sich leise nach dem Namen des Patienten. Mehr muss ich ihm nicht erklären, denn Bernd hat die Umstände bereits am Telefon geschildert: 26-jähriger Mann, sehr wahrscheinlich unter Drogeneinfluss, zunächst kooperativ, dann aggressiv, randaliert und gefährdet damit sich selbst und die Personen in seinem Umfeld.
»Herr Schubert, hier ist die Polizei.« Der Beamte spricht laut und deutlich. »Wir kommen jetzt rein.«
Er nickt Christoph und mir zu. Wir sollen den Griff loslassen. Als wir das tun und beide vorsorglich einen Schritt zurücktreten, geschieht nichts. Die Tür bleibt geschlossen, und plötzlich hat auch das Schimpfen und Poltern, das bis eben noch unaufhörlich aus dem Behandlungsraum drang, ein Ende. Der Polizist öffnet vorsichtig die Schiebetür, seine Kollegin hat sich neben ihm postiert und ist bereit, nötigenfalls sofort einzugreifen.
»Herr Schubert?«
Er wirft einen Blick in den Behandlungsraum und macht dann einen Schritt hinein. Ich stelle mich neben seine Kollegin, um mit eigenen Augen zu sehen, in welchem Zustand das Zimmer ist und was darin vorgeht.
Es herrscht ziemliche Unordnung, aber die Schäden dürften sich glücklicherweise in Grenzen halten. Die Bildschirme und der Computer scheinen jedenfalls unversehrt. Ein blauer Müllbehälter wurde umgeworfen, auch der Infusionsständer liegt auf dem Boden. Die Patientenliege, die vorhin noch als Rammbock verwendet wurde, steht nun schräg mitten im Raum. Dominik Schubert sitzt in gebeugter Haltung darauf, Schweißperlen auf der Stirn, eine Hand auf der Brust. Seine tiefen Atemzüge deuten an, wie sehr er sich in den vergangenen Minuten verausgabt hat.
Mister Hyde ist verschwunden, so plötzlich, wie er vorhin aufgetaucht war. Zurück bleibt nur der große und kräftige junge Mann, den seine Freunde »Dommel« nennen und der den Beamten in der dunkelblauen Uniform ängstlich ansieht.
»Mein Herz«, sagt er. »Es schlägt so schnell. Viel zu schnell.«