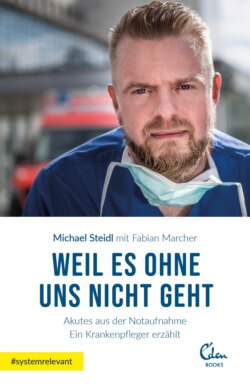Читать книгу Weil es ohne uns nicht geht - Fabian Marcher - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hoffentlich verbock ich das nicht Schläfer, Wiederkommer und ein abgesägter Finger
Оглавление»Und, wie gehts dir hier bei uns?«, fragt mich Alina, während sie die Werte ihres aktuellen Patienten am Bildschirm neben seinem Behandlungsplatz in die Dokumentation einträgt.
Es ist ein strahlend schöner Tag im Juli 2019. Meine erste Schicht in der Zentralen Notaufnahme, momentan befinden wir uns im Großraum. Alina hat mir die Standardprozedur gezeigt, die das Pflegepersonal bei fast jedem neuen Patienten auf der internistischen Seite vornimmt, noch bevor ein Arzt oder eine Ärztin kommt: EKG anlegen, Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und Temperatur messen, die Ergebnisse dokumentieren.
Bei dem untersetzten Italiener, der momentan seitlich auf der durch beigefarbene Vorhänge von den angrenzenden Bereichen abgetrennten Liege sitzt, kommt noch eine Blut- und eine Urinprobe dazu. Er klagt über heftige Bauchschmerzen, möglicherweise ist sein Blinddarm entzündet.
»Na ja, das ist schon alles sehr neu für mich«, antworte ich.
»Kann ich mir denken. Ich weiß noch, wie ich mich an meinem ersten Tag in der Notaufnahme gefühlt habe. Ich hatte richtig Schiss und dachte: Jeden Moment kann ein total krasser Fall reinkommen, hoffentlich verbock ich das nicht!«
Alina wendet sich vom Bildschirm ab und beginnt, die Blutentnahme vorzubereiten.
»Ich war dann erst mal mit Martina an der Sichtung«, erzählt sie weiter. »Sie hat mir alles gezeigt, und irgendwann ist sie kurz einen Kaffee holen gegangen. Kaum war sie weg, kam ein neuer Patient, ein Mann um die fünfzig. Ich hab zuerst gar nichts Außergewöhnliches bemerkt. Nur ein bisschen blass kam er mir vor, und seine linke Hand war eingewickelt. Ich wollte gerade den Mund aufmachen, da sagte er: ›Junge Frau, ich habe mir mit der Kreissäge den Zeigefinger abgeschnitten. Hier ist das gute Stück.‹ Und damit hielt er mir den blutverkrusteten Finger vor die Nase. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte! Ich wusste nicht mal, ob ich das Ding jetzt einfach so in die Hand nehmen darf. Andererseits hatte ich sowieso genug damit zu tun, nicht auf der Stelle ohnmächtig zu werden.«
Alina hat das erste transparente Röhrchen mit dem Blut ihres Patienten gefüllt und greift nach dem nächsten. Ein wenig verunsichert verlasse ich den Großraum, um nach Mike zu sehen.
Er hat OT-Dienst, das heißt: Er verteilt die Patienten auf die Behandlungsräume, organisiert Verlegungen, nimmt Anrufe entgegen, kümmert sich um die Bürokratie. Bei Bedarf versorgt er auch Patienten, doch meist sitzt er am Computerarbeitsplatz der Pflegekräfte in der mit vielen Bildschirmen ausgestatteten, durch einen Tresen vom umlaufenden Flur getrennten Organisationsinsel. Sie liegt zentral zwischen dem internistischen und dem unfallchirurgischen Bereich und direkt gegenüber der Röntgenabteilung. Ein kurzer Korridor führt von hier zum Computertomografen und zu den beiden Schockräumen, die für die Versorgung besonders schwerer Fälle eingerichtet sind. Der Begriff »Schock« wird hier nicht im Sinne eines psychischen Schockzustands verwendet, sondern er bezeichnet die körperliche Reaktion auf ein schweres Trauma, unter anderem eine starke Verminderung der Blutzirkulation bis hin zum Kreislaufkollaps.
Mike telefoniert gerade, also gehe ich an der Organisationsinsel und den internistischen Behandlungsräumen vorbei, drücke auf den Schalter, der die Tür zum Wartebereich öffnet, begebe mich zur Sichtung und setze mich dort auf den freien Bürostuhl neben Martina. Ich spüre die Blicke, die mich von der anderen Seite der Glasscheibe taxieren. Die Leute denken, ich wüsste vielleicht etwas über ihre Angehörigen, die drinnen in Behandlung sind. Oder sie hoffen darauf, dass ich sie gleich hereinrufen werde.
Es ist noch nicht lange her, dass ich selbst da draußen saß. Im Gegensatz zu den anderen Wartenden fehlte mir ein Handy, mit dem ich mir die Zeit hätte vertreiben können. Die wenigen, ziemlich abgegriffenen Zeitschriften, die auf einem Tischchen bereitlagen, überzeugten mich nicht, für die Bilderbücher und Bauklötze war ich eindeutig zu alt. Also beschränkte ich mich aufs Beobachten. Hin und wieder fuhr ein Rettungswagen vor, und kurz darauf schoben die Sanitäter Transportliegen vorbei, auf denen meist teilnahmslose ältere Menschen lagen. Unweit von mir saß ein leger gekleideter Mann, den ich auf etwa 45 Jahre schätzte. Sein linker Arm hing in einer Schlinge vor seinem Bauch.
Die Zeit verging zäh. In meiner Verzweiflung las ich bereits zum dritten Mal das Infoplakat, das über dem Tisch mit den Zeitschriften hing. Anhand vieler bunter Grafiken sollte es die Leistungsfähigkeit der hiesigen Notaufnahme veranschaulichen. Im vergangenen Jahr seien 46.000 Patienten versorgt worden, hieß es da.
Zwischendurch wechselte mein Blick immer wieder auf den an die gegenüberliegende Wand montierten Flachbildschirm. Der zeigte den Grundriss der Notaufnahme, in dem blinkende, mit verschiedenfarbigen Dreiecken markierte Kästchen verteilt waren, die ab und an ihren Standort wechselten. Manche verschwanden plötzlich, gelegentlich kam ein neues hinzu. Ich vermutete, dass die Kästchen für die gerade in Behandlung befindlichen Patienten standen. Welches davon wohl Julia war? Keines von denen mit einem roten Dreieck, hoffte ich. Lieber blau oder grün. Gelb ginge zur Not auch noch. Aber ein rotes Dreieck, das konnte nichts Gutes bedeuten.
Ich wäre damals nicht im Traum auf den Gedanken gekommen, dass ich selbst bald auf der anderen Seite der Glasscheibe sitzen und die Kleidung des Pflegepersonals tragen würde. Als ich vorhin neben Mike in der Garderobe stand und die weiße Stoffhose und das weit geschnittene hellblaue Oberteil mit den kurzen Ärmeln und dem V-Ausschnitt anzog, fühlte sich das an, als würde ich eine Verkleidung anlegen. In den zwei Stunden, die seitdem vergangen sind, hat sich daran wenig geändert.
Die automatische Tür, die vom Warteraum nach draußen zur Zufahrt für die Rettungs- und Notarztfahrzeuge führt, öffnet sich. Zwei Sanitäter schieben eine Trage hindurch. Der ältere Herr, den sie transportieren, sitzt aufrecht. Man kann den Verband um seine Stirn und das bereits getrocknete Blut auf seiner Nase und an seiner rechten Schläfe gut erkennen.
»Guten Morgen. Wir haben hier einen Sturz. Herr …« – der ältere der beiden Sanitäter, ein hagerer Mann mit Halbglatze, blickt stirnrunzelnd auf das Versicherungskärtchen, bevor er es durch den Spalt schiebt – »… Lauer ist über einen Badezimmerteppich gestolpert, mit dem Kopf auf dem Badewannenrand aufgeschlagen und hat sich dabei eine Platzwunde zugezogen.«
Martina steckt das Kärtchen in das in die Tastatur integrierte Lesegerät, wendet sich ihrem Bildschirm zu und klickt sich durch ein Menü, während sie redet.
»Schuld war nur der Teppich? Kein Schwindel oder so?«
»Nichts dergleichen.«
Klick.
»War er bewusstlos?«
»Nein. Seine Frau war sofort nach dem Sturz bei ihm und sagt, er sei jederzeit ansprechbar gewesen.«
Klick.
Frage.
Klick.
Frage.
Klick.
Noch ein paar Details werden geklärt: Sind Vorerkrankungen des Patienten bekannt? Nimmt er regelmäßig Medikamente? Hat sich seit dem letzten Klinikbesuch von Herrn Lauer sein Hausarzt geändert? Stimmen Adresse und Telefonnummer aus der Datenbank noch? Braucht der Rettungsdienst einen Transportschein für die Abrechnung mit der Krankenkasse? Das alles dauert kaum mehr als eine Minute, dann heißt es: »Okay, ihr könnt ihn reinbringen.«
Der jüngere Sanitäter drückt auf den Türöffner, und schon verschwindet das Trio aus unserem Sichtfeld in Richtung Behandlungsbereich. Über Martinas Schulter hinweg sehe ich zu, wie sie noch ein paar Felder in der Maske ihres Computerprogramms ausfüllt. Schließlich erscheint auf dem Bildschirm der Grundriss der Notaufnahme. Es ist genau die gleiche Grafik, wie sie der Bildschirm im Wartebereich zeigt. Nur dass hier die Kästchen mit den farbigen Dreiecken nicht anonym sind, sondern Namenskürzel enthalten. Herr Eberhard Lauer, 82 Jahre alt, wird zu Lau, Eb. Sein Dreieck ist gelb.
Das mit den bunten Dreiecken hat mir Martina am Morgen als Erstes erklärt. Die Farbe zeigt an, welcher Kategorie der Patient im Rahmen der Triage zugeordnet wurde – und damit, wie viel Zeit höchstens bis zu seinem ersten Kontakt mit dem ärztlichen Personal vergehen sollte.
Das Triagieren der Neuankömmlinge ist Martinas Hauptaufgabe an der Sichtung. Man sei hier außerdem Lotse, Pförtner und Seelsorger zugleich, sagt sie, und in vielerlei Hinsicht gefordert.
»Eine schnelle Auffassungsgabe ist nötig, oft auch Fingerspitzengefühl. Und hin und wieder braucht jemand eine klare Ansage, da darf man dann wiederum nicht zu zimperlich sein.«
Nicht nur mit Patienten, auch mit Angehörigen komme es gelegentlich zu Diskussionen und Konflikten.
»Dass wir sie in der Regel nicht mit in den Behandlungsbereich lassen, verstehen nicht alle. Wenn wir es täten, wäre es da drin schlicht zu voll. Deswegen dürfen Angehörige nur bei Kindern mit rein. Oder bei dementen Patienten. Vertraute Bezugspersonen können da das Personal sogar entlasten.«
Seit vor etwas mehr als zehn Jahren die bis dahin nach Fachbereichen getrennten Notaufnahmen zu einer Zentralen Notaufnahme zusammengelegt wurden, habe außerdem der Anteil der Bagatellfälle stark zugenommen.
»Manche Leute nutzen ganz bewusst aus, dass wir niemanden wegschicken dürfen. Die denken sich: In der Notaufnahme ist alles vor Ort. Wenn ich mich da durchchecken lasse, muss ich nicht lange auf Folgetermine oder Laborergebnisse warten. Dass sie Kapazitäten für echte Notfälle blockieren, ist denen anscheinend egal. Andere wissen einfach nicht, dass es den Kassenärztlichen Notdienst gibt, den man anrufen kann, wenn die Arztpraxen geschlossen sind.«
Als erfahrene Sichtungskraft kennt Martina aber auch den Patiententyp, der eigentlich viel eher hätte kommen sollen.
»Neulich erschien hier eine Frau mit ihrem 76-jährigen Mann, den bereits seit vier Tagen Sprachstörungen und Lähmungserscheinungen plagten. Eindeutige Schlaganfallsymptome. Sie meinte, es hätte ja auch einfach nur Flüssigkeitsmangel sein können. Da würde ich wiederum sagen: Lieber einmal zu oft in die Notaufnahme fahren.«
Jetzt sprechen wir über die Tücken, die die Arbeit an der Sichtung mit sich bringt. Da sind zum Beispiel die sogenannten Schläfer: Patienten, die ein noch unerkanntes, schweres Leiden mit sich herumtragen, aber mit harmlos erscheinenden Symptomen auftauchen.
»Jemand wurde grün triagiert und bricht kurz darauf im Wartebereich mit einer Hirnblutung zusammen. Ist alles schon vorgekommen. Ein Albtraum für jede Sichtungskraft.«
Eine ähnliche Herausforderung stellen die sogenannten Wiederkommer dar. Sie sind dem Team der Notaufnahme bereits bekannt, weil sie regelmäßig mit denselben, meist harmlosen Beschwerden vorstellig werden.
»Spätestens beim dritten oder vierten Mal ist die Versuchung groß, ihnen keine besondere Aufmerksamkeit mehr zu schenken. Dann können plötzlich Symptome übersehen werden, die uns normalerweise alarmieren würden.«
Wieder beobachte ich, frage gelegentlich nach und notiere alles in mein Heft. Ich hatte geahnt, dass ich in der Notaufnahme viel Neues lernen würde, dabei aber hauptsächlich an Ausnahmesituationen gedacht: die Konfrontation mit schweren Krankheiten und Verletzungen, Patienten, die mit dem Tod ringen.
Und nun ist es die tägliche, unspektakuläre Kleinarbeit, die die ersten Seiten meines Notizhefts füllt: der Ablauf an der Sichtung, die Übernahme der Patienten durch das Team im Behandlungsbereich, Organisation und Dokumentation, das andauernde Desinfizieren der Hände. Dinge, die einfach sind und für den reibungslosen Betrieb trotzdem unerlässlich. Langsam wird mir klar: Wer die Notaufnahme verstehen will, muss vor allem ihre Routine verinnerlichen.
»So, jetzt hole ich mir erst mal einen Kaffee«, unterbricht Martina meine Gedanken. Im nächsten Augenblick ist sie schon auf den Beinen. »Ich bin in einer Minute wieder da.«
»Moment!«
Martina hält inne und sieht mich fragend an.
»Ähm …«
Was soll ich sagen? Dass vor meinem inneren Auge gerade ein blutiger, abgesägter Finger erscheint? Hier ist das gute Stück.
»Das … Das kann ich doch erledigen.« Ich springe auf. »So mache ich mich wenigstens nützlich. Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz? Mit Milch und Zucker?«
Briefing: Triage
In der Notfallmedizin können die Fälle nicht in der Reihenfolge ihres Eintreffens bearbeitet werden – es wäre fahrlässig, einen potenziellen Herzinfarkt warten zu lassen, weil ein verstauchter Knöchel früher da war. Deshalb werden die Patienten im Rahmen der Triage in Kategorien unterschiedlicher Dringlichkeit eingeteilt. Das in diesem Buch beschriebene Manchester-Triage-System (MTS) kennt fünf Kategorien, denen die Patienten anhand ihrer Symptome zugeordnet werden. Für jede Kategorie gilt ein verbindlicher Zeitrahmen, innerhalb dessen der erste ärztliche Kontakt erfolgen muss.
Blau: nicht dringend. Maximale Wartezeit: 120 Minuten.
Grün: normal. Maximale Wartezeit: 90 Minuten.
Gelb: dringend. Maximale Wartezeit: 30 Minuten.
Orange: sehr dringend. Maximale Wartezeit: 10 Minuten.
Rot: sofort. Es besteht akute Lebensgefahr.
Als Alternative zum MTS wird in deutschen Notaufnahmen bei der Triage der sogenannte Emergency Severity Index (ESI) verwendet. Dieser nimmt die Einteilung nicht symptom-, sondern ressourcenbasiert vor. MTS und ESI unterscheiden sich im Ergebnis für den Patienten jedoch kaum.
Ist man über die Vorgehensweise bei der Triage informiert, wird man sich über ein wenig Wartezeit in der Notaufnahme kaum noch ärgern. Denn eines steht fest: Wer bei vollem Wartebereich unverzüglich drankommt, hat wahrscheinlich ein sehr ernstes Problem.