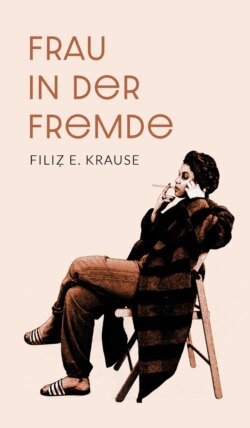Читать книгу Frau in der Fremde - Filiz E. Krause - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4. Große Pläne – kleine Schritte
Ich hatte die erste Woche im Obdachlosenheim hinter mir. Pfarrer Webber machte seine Androhung war und besuchte mich am Sonntag, um den Glauben an Gott in mir wach zu rütteln. Während er mir von seiner bevorstehenden Predigt erzählte, inspizierte er mein Zimmer, das ich mittlerweile gut in Schuss hielt. Selbst die Küchenschaben ließen sich tagsüber nicht mehr blicken. Webbers langgliedrige Hände schaufelten tastend, seine Worte stützend, durch die stickige Luft des Zimmers. Er zog seinen Besuch durch zahllose, unnötige Einschübe und häufiges Räuspern in die Länge. Ich hatte mich im unteren Stockbett verschanzt, das im Schatten lag, und vermied nach Möglichkeit den Blickkontakt mit meinem Bekehrer. Dabei lebte die Angst in mir, er könne zu mir in das untere Stockbett kriechen, denn wohin wären Baby-Gail und ich dann vor seinen eindringlichen, die Ungläubigen verdammenden grünen Augen geflüchtet? Er redete in dieser stockenden ausholenden Art so lange auf meinen Schatten im Stockbett ein, dass ich keinen anderen Ausweg sah, als zu versprechen, dass ich zur Messe käme. Und tatsächlich verließ der Pfarrer daraufhin eilig das Zimmer, mit den Worten, er habe für die Messe noch so viel vorzubereiten.
Ich überlegte einige Zeit, ob ich wirklich an seiner Messe teilnehmen sollte - ein Sonntag war für so viel anderes gut. Doch dann siegte der Anstand.
Als Frau in der Fremde formte man die Vorurteile der Einheimischen. Würden die Deutschen zu ihrem Wort stehen oder waren sie unzuverlässige und verlogene Halunken, die nur die selbstlose Unterstützung der amerikanischen Kirche suchten und im Gegenzug nichts geben wollten? Nicht einmal Anstand? Nein, das waren sie nicht, beschloss ich und machte mich fertig.
Ich spielte mit dem Gedanken, kurz vorbeizuschauen und mich dann unter irgendeinem Vorwand wieder aus der Kapelle zu stehlen. Als ich mir ein Kleid anzog, kam mir kurz der Gedanke, dass ein Mann wie Webber den Pfarrerberuf womöglich deshalb gewählt hatte, weil er dann ein Haus voller Frauen, die sich allein um seinetwillen herausputzten, für sich haben konnte. Das ist billig und gemein, aber welches andere Motiv hätte sonst einen Mann, dem es an menschlicher Wärme und Nähe fehlte, in den Dienst der Menschheit treiben können?
Die Kapelle war ein gewöhnlicher Raum mit zwei Reihen einfacher, ungemütlicher Holzbänke und einem kleinen Standpult am hinteren Ende. Doch die Bänke waren voll mit Kirchgängern. Ich fand nur noch einen Stehplatz am Eingang. Pfarrer Webber war bereits mit vollem Tempo in seiner Predigt unterwegs und zeichnete nun ein ganz anderes Bild. Er strahlte Charisma aus, donnerte mit voller Stimme Allgemeinplätze, gute einfache Wahrheiten und Weisheiten in den Raum und impfte uns mit seinem tiefen Bass Glaubwürdigkeit in die Herzen. Auch ich war sofort im Bann seiner Rede, nicht um der frommen Worte willen, sondern weil es gut tat, in Zeiten der Ungewissheit einem Überzeugten zu lauschen. Die Einschübe fehlten, er musste sich nicht räuspern. Lediglich die Arme, die eine Spannweite von zwei Metern hatten, sägten durch die Luft, jedoch rhythmisch; das Schaufeln wirkte nun symbolhaft, bedeutungsvoll. Ganz vorne in der ersten Reihe erspähte ich Wonda und ihre Kinder. Mein Traum schoss mir durch den Kopf und das Gewissen nagte an mir, obwohl ich nicht wusste, warum. Was hatte ich mit ihrem Prüfergebnis zu tun? Vielleicht spürte sie mein schlechtes Gewissen oder wenigstens meine Augen, die sich ihr in das krause Haar auf dem Hinterkopf bohrten. Jedenfalls drehte sie sich kurz um, schielte suchend nach hinten. Sie lächelte mir zu, als sie mich und Baby-Gail in der Kirche, „ihrer Kirche“, wie sie mir später bedeutete, stehen sah.
In Tampa, Florida hatte endlich die Trockenperiode eingesetzt. Seit einigen Tagen schon hatte es nicht mehr geregnet und die dauernden Hochtemperaturen saugten nach und nach die Feuchtigkeit aus der Luft. Mit jedem Tag wurden die Temperaturen ein wenig erträglicher. Endlich konnten sich die Bewohner aus ihren kleinen Zimmern nach draußen wagen. Mit unseren Kindern hielten wir uns nun täglich von 15 Uhr bis zum Zapfenstreich um 20 Uhr abends im Hof des Heims auf, der mit Gartenstühlen, einer Tischtennisplatte - die für alles Mögliche, vor allem das Kartenspiel, zweckentfremdet wurde - und einigen kleinen Kaffeetischen ausgestattet war. Die Kinder rannten herum und veranstalteten typischen Kinderlärm. An diesem Sonntag konnte ich mir ebenfalls einen Gartenstuhl ergattern und in Ruhe das Treiben um mich herum verfolgen. Baby-Gail schlief brav in meinen Armen. Es hatten sich einige weiße Familien im Hof versammelt. Die auffälligste Gemeinsamkeit unter ihnen war die Verwahrlosung: die verlausten struppigen Haare, das schlechte und lückenhafte Gebiss, die zerlumpten Kleider, die verbogenen und verbauten Körper. Sie sahen wie alte Puppen aus, die man aus der Mottenkiste auf dem Speicher hervorgezogen hatte. Vereinzelt stolzierten lateinamerikanische Mütter mit ihrem Nachwuchs durch den Hof. Auch sie waren arm, doch trotz aller äußerlichen Bescheidenheit attraktiv. Wenn man ihren Blicken begegnete, was ihnen offenkundig zuwider war, blitzten ihre Augen vor Unmut über ihre verzwickte Lage und man konnte förmlich spüren, wie sie nach einem Schuldigen suchten. Sie hatten sich mit ihrem Schicksal noch nicht abgefunden; sie waren nach wie vor empört, verletzt, bereit einen Krieg anzuzetteln.
Mich interessierten vor allem die schwarzen Frauen in diesem Heim, nicht zuletzt, weil ich unter ihnen Gail suchte, die Gail, die mir eine so gute Schwiegermutter gewesen war, die Freundin, über deren Verlust ich einfach nicht hinwegkommen konnte.
In diesem Heim wohnten viele schwarze Frauen. Frauen jeder Statur, jeden Alters, jeden Farbtons und jeder Haltung. Ihnen gemein war, dass sie das Leben im Obdachlosenheim nicht lähmte. Sie schienen es als selbstverständlich hinzunehmen, dass sie hier gelandet waren. Als wäre es eine natürliche Entwicklung in ihrem Leben. Vom ersten Tag an organisierten sie mit fester Stimme den Alltag, loteten ihre Möglichkeiten aus und schmiedeten Freundschaften und Feindschaften. Sie waren wie Wölfinnen, die schnell die Hackordnung herstellten und in diesem Hickhack rasch die Oberhand gewannen.
Bisher hatte ich mich meist in meinem Zimmer verschanzt und war kaum wahrgenommen worden. Nun, da ich mich erneut zum Leben bekannt hatte und mit Wonda meine Runden durch das Heim zog, wurde ich argwöhnisch beäugt. Dass ich mit einigen schwarzen Frauen tatsächlich in Kontakt kam, ist meiner Naivität zu verdanken. Ich bildete mir tatsächlich ein, irgendwie zu ihnen zu gehören, weil ich ein braunes Baby in den Armen hielt, weil ich – noch – mit einem schwarzen Mann verheiratet war. So befreundete ich mich beispielsweise mit einer Frau namens Oray, die mit ihren drei Söhnen kurz nach mir in das Heim gezogen war. Ihre drei Jungen hörten auf die französisch klingende Namen, Leòn, Marquise und Jacques und wurden von der Mutter mit harter Hand geführt. Oray war ausnehmend hübsch; sie wirkte oberflächlich, mangelhaft gebildet und fokussiert auf das Thema Beziehungen. Ich wagte ihr auch in den banalsten Dingen kaum zu widersprechen, da sie mich mit der strengen Erziehung ihrer Kinder einschüchterte.
Weiter lernte ich Louise kennen, eine schwarze Frau von fast zwei Metern Größe mit einem beachtlichen Körperumfang. Sie hatte insgesamt sechs Kinder bei sich, die ich niemals unterscheiden lernte. Sie schwirrten wie Elektronen auf der äußeren Schale um den massiven Kern, die Mutter, herum ohne je greifbar zu werden. Und doch hatte Louise genügend Einfluss auf ihre Zöglinge, um sie im entscheidenden Moment zu sich zurückzupfeifen, wenn Gefahr in Verzug war. Die schwarze Frau bestätigte das Bild der großen gemütlichen Riesin, die sich im Bewusstsein ihrer wahren Kräfte eine großherzigere Einstellung gegenüber den Menschen leisten konnte, als dies der Durchschnitt der Menschheit tat. Louise war unglaublich gutmütig und sorgte häufig dafür, dass die sich laufend anbahnenden Streitigkeiten zwischen den Frauen eingedämmt wurden.
Erstaunlicherweise suchte die schwarze Wonda im Gegensatz zu mir keinen Kontakt zu den anderen schwarzen Frauen. Es schien ihr sogar unangenehm, wenn ich mich in der Nähe anderer schwarzer Frauen aufhielt. In gewisser Weise hatte sie, bedingt durch die Ehe mit ihrem Kokainhändler, der ein großes Tier unter den Kokainhändlern sein musste, einen höheren Status als die anderen Bewohnerinnen - was sich auch in ihrer Sprache und ihrem Benehmen gegenüber den anderen Frauen ausdrückte. Es war aber nicht nur die Arroganz, über den anderen zu stehen, die sie von ihnen fernhielt, sondern auch eine grundsätzliche Andersartigkeit an Wonda, die sich schlecht in Worte fassen ließ. Ich kapierte zumindest damals schon, dass ich schwarze Frauen eigentlich nicht verstand. Auch Wonda verstand ich nicht, aber ich akzeptierte sie so, wie sie sich mir gegenüber verhielt.
Neben dem Talent, auch im Elend Oberwasser zu gewinnen, gab es unter den schwarzen Frauen noch eine andere erwähnenswerte Gemeinsamkeit, und Wonda stand hier den anderen in nichts nach. Es handelte sich um die beinahe sexuelle Beziehung zu einem weißen Gott. Auch wenn wiederholt versucht wurde, diesem Gott ein anderes Gesicht zu verleihen, so blieb er doch auch in den Herzen dieser schwarzen Frauen ein weißer Mann. Diese vor religiösem Hintergrund stattfindende Liebesbeziehung, die keinen Verrat, keinen Seitensprung kannte, faszinierte und verwirrte mich stets aufs Neue. Die religiöse Beziehung der schwarzen Frau zu ihrem Gott beschränkte sich nicht auf einen sonntäglichen Gospeltanz in der Kirche. Sie war allgegenwärtig spürbar, in der Erziehung ihrer Kinder, in ihren Ansichten über Freundschaft und Liebe, in ihren beruflichen Bestrebungen. Der intensive Dialog zwischen der schwarzen Frau und Gott entnervte den schwarzen Mann an ihrer Seite und entmannte ihn nicht selten. Er mochte sie nötigen, missbrauchen, schlagen und ihr eine Reihe hungriger Kinder anhängen; auf ihren Pakt mit Gott hatte er keinen Zugriff. Der weiße Mann im Himmel war das letzte Bollwerk gegen die Angriffe auf das wehrloseste Glied in einer rassenorientierten Gesellschaft und das war die schwarze Frau – Gail oder eine andere.
Wie gesagt stand Wonda den anderen in nichts nach, wenn es um den Glauben ging. Da wir in diesen Julitagen - Wochen vor dem Schulbeginn – viel Zeit totzuschlagen hatten, diskutierten wir natürlich häufig über ihren Gott. Sie hatte meiner Meinung nach eine intellektuelle, um nicht zu sagen, weiße Anschauung von ihm. Sie sprach von Leitlinien, die man brauchte, um sich im Leben zurechtzufinden, von Gott als Lebenshilfe. Sie sprach nicht von einer Vaterfigur, sie personifizierte ihn nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Glaube sie sexuell stimulierte oder sonst mit ihrem praktischen Leben zu tun hatte, wie das eben bei ihren schwarzen Mitbewohnerinnen üblich war. Und dies war auch der Grund, warum ich Wondas Glauben anfänglich kaum als störend wahrnahm. Ich konnte mich allerdings auch nicht kritisch mit ihr darüber auseinandersetzen, denn sie lehnte Zweifel an ihren Theorien ab. Dies hatte zufolge, dass ich mich beim Spazierengehen, im Park oder im Hof von ihren theologischen Ausführungen berieseln ließ, so wie man dem angenehmen Gurgeln eines flachen Flussbettes lauschte, und im Übrigen meinen eigenen Gedanken nachhing.
Und selbstverständlich hatte ich über einiges nachzudenken, meine nahe Zukunft zum Beispiel, denn ich musste ja schauen, dass ich aus dem Obdachlosenheim herauskam, und Religion stand einfach nicht auf meinem Lebensplan. Und dann war da ja der bestandene College-Test. Mit der Aussicht auf eine Ausbildung am College konnte ich mir plötzlich wieder vorstellen, in diesem fremden Land heimisch zu werden. Nach meinem schlimmen Brandunfall im Haus von Gail hatte ich nur noch die Möglichkeit gesehen, nach Deutschland zurückzukehren, sobald ich das Geld für ein Ticket zusammenhätte. Dabei zog mich gar nichts in meine Heimat zurück. Sicher, ich vermisste manchmal den Schnee und träumte ab und zu von Lebensmitteln, die es in Amerika nicht zu kaufen gab. Aber die ausschlaggebenden Faktoren für ordentliches Heimweh, eine Familie, ein Job, ein Mann fehlten mir. Daher freute ich mich jetzt, mein Vorhaben von vor einem Jahr, in diesem Amerika Fuß zu fassen, noch einmal anpacken zu können. Und ich war stolz darauf, dass ich es unabhängig von Erin versuchen konnte.
Wonda und ich hatten nicht nur vereinbart, uns um eine bessere Ausbildung zu kümmern, sondern wollten auch gemeinsam auf Jobsuche gehen. Ich versuchte daher häufig, das Thema auf die Frage zu lenken, wie wir es angehen könnten, an einen Job zu gelangen. Wonda schien anfangs begeistert, als ich die Berufsaussichten für uns beide ausmalte. Wann immer ich aber auf Taten drängte, wich sie mir aus. Es blieb eine Weile dabei, dass wir gemeinsam auf unseren Spaziergängen theoretisierten, worauf wir uns beide sehr gut verstanden. Insgeheim wurde mir jedoch zunehmend klarer, dass ich mein Schicksal im Alleingang in die Hand nehmen müsste. Im Gegensatz zu Wonda genügten mir bloße Träumereien nicht. Im Gegensatz zur Ihr glaubte ich einfach daran, dass ich einen Job bekommen würde, sogar einen, den ich mir selbst aussuchte und der mir Spaß machte. Ich glaubte an das erarbeitete Glück, nicht an das überirdische.
Eines Tages las ich im Vorbeigehen die Reklame einer Berufsschule, die Interessenten gegen eine Gebühr von einem Dollar zur Prüfung für den Beruf der Krankenschwesternhelferin zuließ. Wenn ein Mensch keinen Berufswunsch hat, glaubt er entweder, dass er für gar keine Tätigkeit oder für jede Tätigkeit geeignet sei. Ich gehörte zu den Letzteren. Die Schule war nicht gerade um die Ecke, aber da ich seit einiger Zeit glaubte, dass Jeff in mich verliebt war, konnte ich mir diesen Umstand ja zum Vorteil machen und mich herumkutschieren lassen.
Tatsächlich willigte er sofort ein, und wieder verhielt ich mich kindisch und dumm, fiel ihm – sogar im Beisein von Wonda – um den Hals und wollte ihn abküssen. Er ließ sich aber nicht von mir küssen, sodass ich etwa fünf peinliche Sekunden an seinem Hals hing, während er sein Gesicht abwandte. Schließlich schaffte er es, sich von mir loszumachen und in einem Telefonat mit seiner Chefin zu klären, ob er sich vom Büro freinehmen und mich für die Prüfung zur Schule fahren könne. Wonda bot sich an, zwischenzeitlich auf Baby-Gail aufzupassen. Durch die peinlichen fünf Sekunden konnte ich mich nicht überwinden, Jeff auch noch um einen Dollar anzubetteln, obgleich mir heute klar ist, dass er mir auch 100 Dollar geliehen hätte. Meine verletzte Eitelkeit trieb mich tatsächlich zu Pfarrer Webber, der mir zwar mit Freuden den Dollar lieh, mich aber dafür einer halbstündigen Moralpredigt über puritanisches Wettbewerbsverhalten unterzog, in der es um meine deutschen Wurzeln ging, die mir den nötigen Fleiß und Eifer mitgegeben hätten, um jetzt zu derartiger Selbstständigkeit befähigt zu sein. Und dass es ein Jammer wäre, dass den Menschen im Heim dieser notwendige Antrieb fehle. Ich lauschte schweigend, vermied die grünen Augen, sah ihm dafür viel zu häufig auf die Genitalien, da er vor mir stand, während ich mir meinen Dollar verdiente. Am nächsten Tag fuhr mich Jeff in die Berufsschule.
Nach dieser Prüfung kam ich zu dem Schluss, dass es in Amerika keine echten schweißtreibenden Prüfungen geben konnte. Ich hatte das Diplom einer ‚geprüften Krankenschwesternhelferin’ einer ‚Certified Nurses Aid’, oder kurz ‚CNA’ in der Tasche und war auf dem Weg zu einer Arbeitsvermittlungsagentur, was Jeff selbst vorgeschlagen hatte. Das Baby war ja bei Wonda versorgt. Der Gesundheitssektor war ein völlig neuer Berufszweig für mich. Ich brachte keinerlei Erfahrung mit und dürfte die Prüfung auch nur knapp bestanden haben. Bis heute weiß ich nicht, wie man einen Puls misst oder die Herzschlagzahl errechnet. Da alles plötzlich wie geschnurrt lief, war ich zuversichtlich, dass ich mich in dieser Branche profilieren würde und alles, was mir jetzt an Wissen fehlte, später am Arbeitsplatz oder wie die Amerikaner zu sagen pflegen ‚on the job’ lernen könnte.
In der Agentur kam mir mein rhetorisches Talent zugute. Die nette Dame zweifelte keinen Moment an meinem beruflichen Können und stellte mich fest bei sich ein. Ich sollte mich bei ihr anderntags wieder melden, bis dahin hätte sie für mich eine Arbeitsstelle. In Hochstimmung ließ ich mich von Jeff ins Heim zurückfahren und vergaß dabei ganz, dass Jeff, der eigentlich in mich verliebt sein und keine Küsse von mir ausschlagen sollte, neben mir saß und keinerlei Erklärung abgab, die sein ablehnendes Verhalten begründet hätte.
Wonda und ich saßen in Feierlaune bis Mitternacht zusammen. Wir rauchten eine Zigarette nach der anderen vor meinem Zimmer auf dem Gang, dessen steinerne Balustrade den Blick auf das Hofareal freigab. Wonda lebte meine Begeisterung voll und ganz mit. Zumindest bildete ich mir das ein. Ich dachte, dass die Sterne am Himmel für mich schienen und die Nacht so bezaubernd schön kobaltblau war, weil ich lebte. Wir hatten uns in eine ziemliche Vertraulichkeit geredet, und die aufkommenden Emotionen führten dazu, dass ich auch meine geheimen Vermutungen über Jeff und mich preisgab. Wonda musste lachen.
„Dass du das glaubst, finde ich lustig.“
Ich war einigermaßen verwirrt. „Wieso? Das ist doch normal, oder? Was ist denn so schlimm, wenn man mal ein bisschen Selbstbewusstsein zeigt?“
Wonda sah mich so ernst an, wie man mit einem Silberblick ernst schauen kann. „Entschuldige. Das kannst du natürlich nicht wissen. Aber ist dir denn an ihm nichts aufgefallen?“
„Was meinst du, was soll mir auffallen?“ Ich war beleidigt und erschrocken. Auf mich hatte Jeff ganz normal gewirkt. Aber was wusste ich schon von normal? Instinktiv bezog ich Stellung für Jeff, der anscheinend ohne mein Wissen nicht „normal“ war.
„Jeff ist schwul.“
„Nein. Das glaub ich nicht.“
„Doch, Schätzchen. Schwuler kann ein Mann gar nicht sein.“ Sie lachte. Es war für sie so einfach, dass ER schwul war und nicht zum Beispiel ihr Ehemann.
„Aber… Ich meine. Das hätte man doch…“
Wonda schnippte ihren Zigarettenstummel über das Geländer in den Hof hinunter. Sie war nicht schadenfroh. Sie machte lediglich mit einem Wesenszug an mir Bekanntschaft, der ihr eine Überlegenheit verschaffte. Ich war eingebildet.
„Mach dir nichts draus. Jeff ist nicht der einzige Fisch im Wasser. In Amerika gibt es Tausende solcher Typen.“
„Oh, Mann. Aber warum ist er denn dann allein? Hat er keinen Freund?“
„Sein Liebhaber liegt im Krankenhaus auf Davis Island.“
„Im Krankenhaus? Warum? Woher weißt du das? Bist du dir ganz sicher?“
„Früher hat ihn sein Freund immer hier im Heim besucht, in der Nachtschicht. Aber das letzte Mal war er vielleicht vor gut einem Jahr hier.“
„Mein Gott! Ich hätte Jeff niemals für schwul gehalten. Obwohl….“ Ich versuchte meine weibliche Ehre zu retten. Es wirkte einfach jämmerlich, als Frau keinen Riecher für einen Schwulen zu haben.
Plötzlich waren seine Hilfsbereitschaft, seine wunderbare Offenheit und Sanftmütigkeit nicht mehr männlich. Ich schämte mich später für jedes ausgesprochene Wort über Jeff in dieser Nacht. Nachdem ich ausgiebig über ihn herzogen hatte, siegte meine Neugier wieder und ich wollte von Wonda wissen, ob ich den Freund auch mal zu Gesicht bekommen würde. Wonda schüttelte nur traurig den Kopf. Harry, der Freund von Jeff, liege im Sterben, dort im Krankenhaus auf Davis Island, und er würde wohl kein Jahr mehr überleben.
Bevor wir uns trennten, erwähnte Wonda noch etwas, das ich damals noch nicht zu deuten wusste.
„Weißt du, Jeffs Freund Harry, der ist auch schwarz. Wie ich.“