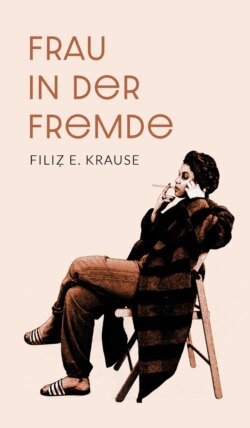Читать книгу Frau in der Fremde - Filiz E. Krause - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5. Gescheiterte Gehversuche
Oray, die Mutter mit den drei Söhnen, kam eines Tages zu mir und bat mich, auf ihre Kinder aufzupassen. Sie hatte sich mit einem Verehrer zu einem Rendezvous verabredet. Ich sagte ihr zu, da ich Zeit hatte und mich mit ihr gutstellen wollte, denn sie war neben Wonda eine der wenigen schwarzen Frauen, die sich mit mir abgaben. Als Dankeschön lud mich Oray bei ihrer Rückkehr im Supermarkt gegenüber auf eine kalte Cola ein. Ich hätte zwar lieber einen Kaffee gehabt, da ich kohlensäurehaltige Getränke nicht besonders gut vertrug, freute mich aber über die Einladung und wagte nicht, sie um einen Kaffee zu bitten. Oray war wie viele schwarze Amerikaner keine Kaffeetrinkerin und hätte es mit Sicherheit nicht geduldet, dass ich von ihrem Geld etwas anderes kaufte als das, was sie bestimmte. Sie war eine dieser Frauen, die irgendwie immer zu ihrem Recht kamen und dies mit einer mir ganz fremden Geschicklichkeit. In Amerika gibt es dafür einen Begriff, die ‚Street Smartness’, und die Definition des Begriffes beschrieb in vollem Umfang diese Frau. Sie konnte nicht einmal ihren Namen richtig schreiben, aber sie wusste auf die Sekunde genau, wann sie ihre körperlichen Reize einzusetzen hatte und haute im richtigen Moment so auf den Tisch, dass jede Autorität vor ihr in die Knie ging. Sie beeindruckte durch schlichte Lebensweisheiten und hielt sich konsequent an eine Handvoll Regeln. In gewissem Sinn war das Heim für sie kein Auffangbecken in der Not, sondern eine in ihrem Lebensplan nüchtern einkalkulierte Zwischenstation.
Wir tranken unsere Cola und redeten von Dingen, die wir beide verstanden. Hauptsächlich von Männern. Wobei ich nur so tat, als ob ich sie verstehen würde. Spätestens nach dem Outing von Jeff war klar, dass ich von Männern keine Ahnung hatte. Nun ja. So kamen wir auf Pfarrer Webber zu sprechen. Oray erzählte mir, dass sie ihre zwei älteren Jungs immer zu Ausflügen mitschickte, die der Pfarrer organisierte. Für sie waren diese Ausflüge eine willkommene Gelegenheit, die zwei Bengel, die sechs und sieben Jahre alt waren, für ein paar Stunden loszuwerden. Ich fragte sie, warum sie nicht alle drei losschickte, dann hätte sie doch absolut freie Hand. Doch Oray lehnte heftig ab. Ihr Jüngster, Marquise, war allem Anschein nach ihr Liebling und musste ihn ständig in ihrer Nähe haben. Auch während unseres Gesprächs schwirrte der Vierjährige wie ein Insekt um uns herum. Er war es gewohnt die Geduld von Oray (und jedem, der in ihrer Nähe war) zu strapazieren, ohne dass dies Folgen für ihn nach sich zog, während die beiden anderen Jungs stets vorsorglich außerhalb der Reichweite von Orays schönen, schlagkräftigen Händen blieben. Ihre Begründung, den kleinen Marquise nicht mitzugeben, war jedoch eine ganz andere.
„Weißt du, dieser Webber ist ein komischer Vogel. Ich kenne mich mit Männern aus.“ Oray wedelte mit einem schlanken Finger vor meinem Gesicht herum und hörte erst damit auf, als ich ihr heftig nickend zustimmte. Sicher war, dass Oray eine Menge von Männern verstand. Sicher war auch, dass ich, wenn sie auch weniger von Männern verstanden hätte, Oray dennoch zugestimmt hätte. Warum die Illusion einer anderen Frau zerstören?
„Dieser Webber“, fuhr sie fort. „Mit dem stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nur nicht was. Er ist mir einfach unsympathisch, weiß der Teufel warum. Ich wünschte ich könnte sagen, es liegt an seinem Körpergeruch, an seinem Rasierwasser oder weil er gelbe lange Zähne hat. Aber so einfach kann ich den Finger nicht drauflegen, was genau mich stört. Vielleicht ist er schwul oder so was. Jedenfalls trau ich dem Kerl nicht. Als Pfarrer ist er spitze, ohne Zweifel. Seine Predigten rocken, er tut viel für dieses verlauste Heim, und die Bewohner dürfen, weiß Gott, nichts Nachteiliges über ihn sagen. Dass er kostenlose Ausflüge für diese Versager organisiert, halte ich für ziemlich christlich. Ich meine, ich kann mich auch täuschen. Jedenfalls sind Jacques und Leòn alt genug, um auf sich selbst Acht zu geben. Aber der Kurze da“, sie deutete auf den heftig in der Nase bohrenden Marquise und haute ihm, noch bevor ich sein Bohren richtig bemerkt hatte, mit einer Hand den Finger vom Nasenloch. Die Tränen flossen. „Der Kleine kann sich noch nicht richtig wehren. Ich meine nicht nur mit Fäusten. Ihm fehlt es auch da oben noch.“ Oray machte eine bedeutsame Geste mit dem Finger an ihren Kopf. Ich nickte, bezweifelte aber, dass der Jüngste, der seiner Mutter am nächsten kam, weniger Selbstbewusstsein und Stehvermögen hatte als seine älteren Brüder.
Wir tranken aus und trudelten heimwärts. Ich versicherte Oray, dass ich jederzeit gerne wieder auf ihre Jungen aufpassen würde, wenn es sich einrichten ließ.
Die Agentur, bei der ich mich für einen Job als CNA beworben hatte, meldete sich wenig später im Büro des Obdachlosenheims. Sie boten mir eine Stelle in einem Altersheim an, das nur wenige Schritte vom Obdachlosenheim gelegen war. Ich konnte also zu Fuß zwischen Arbeitsstätte und Unterbringung pendeln. Da ich schon am nächsten Morgen loslegen sollte, vereinbarte ich mit Wonda, dass sie während meiner Abwesenheit auf Baby-Gail aufpasste. Ich würde sie für die Zeit entschädigen, sobald ich Geld hätte.
Meine Arbeit begann mit einer Nachtschicht. Als ich morgens gegen sieben Uhr zurück ins Heim kroch, verstand ich zum ersten Mal, warum Wonda es vorzog auf mein Baby aufzupassen, anstatt sich Arbeit zu suchen. Schon nach wenigen Schichten war klar, dass ich mich für diesen sozialen Beruf nicht eignete. Alte Menschen, die mich bis dato zwar nicht besonders interessiert, aber auch nicht gestört hatten, wurden für mich zum Inbegriff des Schreckens. Die Hilflosigkeit der Greise in diesem Altenheim der unteren Preisklasse, ihre Abhängigkeit von dilettantischem Personal wie mir (und ich war beileibe kein Einzelfall), ihre ganze Verlassenheit und Gebrechlichkeit; all diese Eindrücke rückten die Unwiderruflichkeit des eigenen Altwerdens bedrohlich nahe in mein Bewusstsein. Plötzlich hatte ich Angst, auch nur einen Tag älter zu werden. Vorstellungen von Ruhestand und Lebensabend – einst vergnügliche Fantasien für die ferne Zukunft – unterdrückte ich zähneknirschend. Vor allem aber hoffte ich, niemals in einem Altenheim enden zu müssen.
Schnell reihte sich eine Schicht an die andere und im Handumdrehen fand ich mich im Arbeitsschlauch gefangen. Ich hasste den Job von Nachtschicht zu Nachtschicht mehr. Oft fragte ich mich, ob dies vielleicht auch an der Arbeitszeit lag. Doch als mir die Agentur auf meine Bitte hin in einem anderen Heim Tag- und Spätschichten organisierte, merkte ich, dass dies nicht der Punkt war. Ich fand es genauso wenig reizvoll, die alten Damen und Herren tagsüber zu füttern, sie an- und auszukleiden und zu waschen oder sie ihm Rollstuhl durch den Park zu kurven, wie nachts ihren Puls zu messen, den ich ohnehin nicht fand oder sie auf die Toilette zu hieven und ihren nächtlichen Geschäften beizuwohnen, die mit viel Stöhnen und Selbstaufgabe vollführt wurden. Ich hielt mich für grausam und herzlos und schonungslos nüchtern. Als Krankenschwester taugte ich nichts.
Leider zog ich die Konsequenzen aus dieser Einsicht erst, als ich bereits so enerviert mit meinen Pfleglingen war, dass ich die eine oder den anderen boshaft in die Wangen gekniffen hatte, wenn diese nicht parierten. Die überwiegende Mehrzahl wehrte sich, wenn auch oft passiv, gegen jede Form von Aktivität. Aus heutiger Sicht völlig verständlich, da sie ja in ihrer Gebrechlichkeit uns Schwestern gnadenlos ausgeliefert waren und das einzige Mittel zum Protest, das ihnen noch blieb, dieser stumme Widerstand war. Beim An- und Auskleiden versteiften sie sich entweder oder ließen sich so gehen, dass man als Schwester das Gefühl hatte, man müsse einem leeren Schlauch ein Hemd oder eine Hose anziehen. Gerne machten sie sich schwer, wenn es darum ging, sie in ihre Rollstühle zu verfrachten oder sie aus diesen wieder heraus zu manövrieren. Ich spreche hier von waschechten Amerikanern mit einer durchschnittlich 70jährigen Hamburger- und Steak-Vergangenheit. Es war demnach kein Wunder, dass ich ordentlich Lust hatte, diese Widersacher zu kneifen, wenn sie ihr 120-Kilo-Lebendgewicht völlig der Schwerkraft überließen. Auch beim Essen fanden die sonst so ergebenen und besiegten Kreaturen Mittel und Wege, die bemühte Schwester in Rage zu bringen. Wer gefüttert werden musste, wartete nur darauf, das gesamte in den Mund geschobene Essen umgehend wieder auszuspucken. Morgens flog also Spucke mit Rühreikrümel in alle Windrichtungen und blieb in den Haaren, an den Kleidern und Möbeln, natürlich auch im Gesicht der Schwester kleben. Mittags und abends kamen vielleicht noch Spinat oder Kartoffelbrei und Götterspeise dazu.
Nachdem ich mit einem armen alten 200 Kilo schweren Mann eines Nachts auf den Boden gefallen war und er mich unter seinen bemitleidenswerten Massen begraben hatte, sah ich ein, dass es Zeit war, den Job zu kündigen.