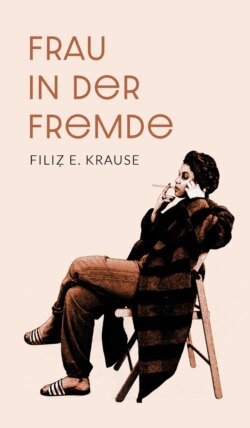Читать книгу Frau in der Fremde - Filiz E. Krause - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Arkaden aus Stein
Der Regen trommelte auf das Dach des Familienwagens, als Gail mich zum Abschied küsste. Sie küsste auch das Baby, das Mädchen, das ihren Namen trug, einen alten Sklavennamen. Vielleicht flossen daher meine Tränen, weil ich das schlafende Mädchen sah und die alte Frau, die alles von uns beiden bekommen hatte, auch ihren Willen, das Mädchen solle Abigail heißen, nicht anders. Und nun drückte sie einen Abschiedskuss auf die zarte Stirn des Kindes. Ich spürte, dies war der letzte Kuss von Gail an Gail und ich behielt Recht.
Der Regen hörte nicht auf zu prasseln, wie sollte er auch. Er prasselte schon beinahe vier Wochen vom Himmel, wie aus einem Fass ohne Boden, ein nicht versiegender Quell der Nässe. Weil sich daran auch an diesem Tag in absehbarer Zeit nichts ändern würde, stieg ich mit meinem Kind auf dem Arm aus dem Wagen, Regen hin oder her. Es war erst vormittags, ich aber hatte das Gefühl, in der Zeitlosigkeit versunken zu sein; graues Zwielicht war alles was ich sah - und die Tore des Obdachlosenheims. Davor andere Bittsteller. Ich zählte, ich war die vierte. Die Welt um mich herum stank nach verwesender Trostlosigkeit. Trotzdem sog ich die Luft ein, den Strom meiner nie versiegenden Tränen zurückdrängend, ein bemitleidenswerter Anblick. Gail wollte losfahren, irgendwie konnten wir uns jetzt nicht einmal mehr die Hand reichen, sie und ich. Vorher die besten Freundinnen, durch dick und dünn gehende, gemeinsam pferdestehlende Freundinnen, grundsätzlich nur küssend, an die Grenze des Platonischen küssend, Gail und ich. Wir waren ein Traumpaar gewesen von Schwiegertochter und Schwiegermutter. Manchmal glaube ich, ich habe sie tiefer geliebt als Erin.
Gail fuhr dann tatsächlich schnell davon, gerade noch die zwei Taschen stellte sie neben mich, die eine mit den Babyutensilien, eine andere mit Kleidung; meine ganze Habe. Mit den Taschen und dem Kind eilte ich unter die schützenden Arkaden des Obdachlosenheimes, vor dessen Gittern die anderen entweder auf das Ende des Regens oder den Einlass in das Heim warteten. Eine schwarze Frau mit fünf Kindern, die sich alle um sie drängten, schaffte Platz für mich auf einer der Bänke, die unter den steinernen Arkaden für die Bittsteller errichtet waren. Ich dankte ihr verheult und stellte mich auf ein langes Warten ein. Meine kleine Gail schlief trotz lärmenden Regens, trotz Obdachlosigkeit, trotz des ganzen Unglücks, das ihr und mir widerfahren war, ruhig in meinen Armen weiter. Ich hatte Zeit zu rekapitulieren.
Vor einem Jahr und drei Monaten war ich Erin aus meiner Heimat, Deutschland, in seine Heimat, Tampa Florida, gefolgt. Wir waren glücklich und närrisch ineinander verliebt. Jung eben, und was in jenem Augenblick unter den weinenden Arkaden eine nicht unwesentliche Rolle für mich spielte: wir waren in meinem Land gewesen. Kaum hatte ich nämlich den Boden seines Landes betreten, hatte sich Erin auf unangenehme Weise verändert. Es ist schwer auszumachen, im Nachhinein, woran es lag, ob es die Mutter, meine geliebte alte Gail, war, die Luft, der ewige Regen, die ewige Sonne, die Sitten, das Essen oder ganz einfach nur Erin selbst. Tatsache war: er, mein Freund und späterer Ehemann, jetzt bald Ex-Ehemann, transformierte vom verständigen, pflichtbewussten, fleißigen Partner zu einem triebhaften, dabei antriebslosen und machohaften Rabenvater und Frauenschänder. Eine sehr subjektive Personenschilderung, ich gebe es zu, aber eine ehrliche, und obendrein unerlässlich als Entschuldigung für meine Tat, die mich heute vor dem Obdachlosenheim sitzen ließ.
Ich hatte nicht wirklich vorgehabt, das schöne Haus von Gail in Brand zu setzen. Wir hatten uns immer blendend verstanden, trotz der merkwürdigen Metamorphose ihres Sohnes oder vielleicht gerade deswegen. Dass Gail große Stücke auf ihr Häuschen hielt, das sie kurz vor unserer Ankunft aus billigen Militärnachlässen erstanden hatte, war einzusehen, auch für mich, die Deutsche, nur in Wohnung und Miete Denkende. Dass ich es niederbrannte, passierte, wie so vieles, im Affekt, in der Wut, die schon Monate gärte, vielleicht Jahre. Diese Wut, die sich verselbstständigte und dann ihr eigenes Szenario suchte, ungeachtet rationeller Erwägungen und den Konsequenzen. Meine Wut - lange angestaut, häufig unterdrückt, da wir unter fremdem Dach hausten mit der geliebten Schwiegermutter und den geliebten Schwippschwagern nebenan - suchte sich einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt aus, um sich Luft zu verschaffen. Sie zwang mich, eine brennende Kerze mitten auf das Ehebett zu schleudern, alles Weitere erklärt sich von selbst.
Ich möchte nicht sagen, dass allein der Brand mich von Haus und Familie getrennt hatte. Es war nur der Auslöser für eine sich bereits lange anbahnende Isolierung von Erins Verwandten, die verständlicherweise auf seiner Seite standen. Wir hatten Fronten zueinander aufgebaut, Erin und ich. Seine Mutter, seine Leute, die mussten sich entscheiden, und sie entschieden sich für ihn. Ich war die Fremde, er war hier zuhause.
All das ging mir durch den Kopf, während ich dicht gedrängt und schwitzend neben der schwarzen Mama saß und auf die Gitter starrte. Bisher war noch niemand aufgenommen worden. Die Kinder der Bittsteller verharrten apathisch, eingehüllt in das Gedröhn des Frühlingsregens, der sich bald, in einer Woche vielleicht, in heißen trockenen Wüstenwind verwandeln würde. Sie kannten die Prozedur, das Warten, den Regen, den Gestank in der Luft. Das hier war ihre Heimat, Tampa, Industriestadt im sonnigen Florida, einst Domizil der Piraten. Nicht meine.
Gegen drei Uhr nachmittags watschelte eine andere schwarze Frau zu den Gittern, an deren Stäben die Kinder klebten. Sie war Pförtnerin und zuständig für den Einlass. Jeder der Erwachsenen erhielt einen Fragebogen, den wir eiligst ausfüllten, denn die kalte Regenfeuchte kroch uns in die Glieder. Dann wurden wir reingelassen. Plötzlich stand ich jenseits der Arkaden, und eine andere Pförtnerin, eine kleine Weiße, führte mich und Baby-Gail in ‚mein Zimmer’, in ein dunkles langes Loch mit zwei Stockbetten auf der einen Seite, einem Tisch, einem Stuhl, einem Kinderbett auf der anderen. Um 6 Uhr abends gäbe es Essen, eine Stunde vorher sei Materialausgabe, wenn ich was bräuchte, klärte mich die Pförtnerin auf. „Alles, alles brauche ich.“ Allein in diesem dunklen fremden Loch liefen mir erneut die Tränen die Wangen herunter. Die Pförtnerin kannte das und verschwand schleunigst aus dem Zimmer. Bei durchschnittlich vier bis fünf Aufnahmen pro Tag und so mancher Heulsuse darunter züchtete man sich ein dickeres Fell an.
Mein Baby schlief immer noch friedlich in meinen Armen. „Das hast du dir also angetan“, dachte ich und musste mich, widerwillig zwar, auf den einzigen Stuhl setzen. Das Baby wurde schwer.
Ich ging nicht nach unten in den Speisesaal zum Abendessen, obgleich das Einnehmen der Mahlzeiten Pflicht im Heim war. Auch zur Materialausgabe unten im Hof erschien ich nicht, obgleich ich doch alles gebraucht hätte. Einfach alles. Ich fühlte mich so obdachlos und arm wie noch nie vorher und später in meinem Leben. Leer und ohne weiteren Verwendungszweck, wie eine Flasche ohne Pfand. Das Grauen über meine Situation hatte mich auf diesen einen Stuhl festgefroren, sodass ich stundenlang bewegungslos darauf verharrte, und nur in diese längliche Höhle von einem Zimmer starrte, bis ich schließlich einschlief.
Aus wirren Träumen sowie einer sehr ungesunden Körperhaltung schreckten mich gegen 11 Uhr abends Babykakerlaken, die an meinen Armen nach oben stürmten. Mit einem gellenden Schrei fegte ich die kleinen Eroberer herunter und fing erneut an, zu weinen. Als das Baby in das Heulkonzert mit einstimmte, war ich versucht hysterisch zu werden, entschied mich dann aber für die Vernunft, eine Tugend, die man als Europäer im Blut hat und die im Notfall lebensrettend sein kann. Ich riss mich also am Riemen, wie man bei uns in Deutschland sagt, und beruhigte das Baby und mich selbst. Dann verließ ich das Zimmer und organisierte mir ‚Material’, also Bade- und Hygieneartikel, außerhalb der Ausgabezeit. Ich glaube, ich hatte Glück, denn genau in dieser Nacht war Jeff der Nachtpförtner, ein Mann, der später noch häufiger für mich eine Ausnahme machen würde.