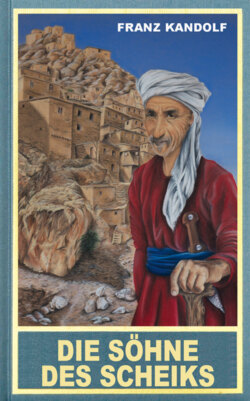Читать книгу Die Söhne des Scheiks - Franz Kandolf - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Durch die Schluchten des Dschelo Dagh
Оглавление„Sihdi, meinst du nicht, dass es viel bequemer gewesen wäre, wenn wir für unseren Ritt nach der persischen Grenze eine mehr südliche Richtung gewählt hätten?“
„Warum, Halef?“
„Wenn wir den Zab hinunter und einen seiner Nebenflüsse, entweder den Begirdi oder den Barazgin, aufwärts gegangen wären, würden wir unser Ziel viel rascher und müheloser erreichen.“
„Müheloser? Das gebe ich ohne Weiteres zu. Aber auch rascher? Du weißt, warum ich mich für diesen Weg entschieden habe. Am Ufer des Zab und des Begirdi wohnen die Schirwani-Kurden in Menge, die wir als Leute kennen, denen man besser aus dem Weg geht. Unser jetziger Weg dagegen führt gerade über das Gebirge und es ist anzunehmen, dass wir dabei manche Begegnung vermeiden, die unsere Reise sehr unliebsam verzögern würde. Freilich müssen wir dabei etwas mehr Anstrengungen in Kauf nehmen.“
„Anstrengungen? Wenn es nur das wäre! Aber ich habe in den beiden letzten Nächten vor Kälte kaum schlafen können. Trotz meiner warmen Decke habe ich gezittert wie die Troddeln am Sattel eines dahinrasenden Kamels. Allâh bjarif – Allah weiß es!“
Das glaubte ich dem Kleinen freilich aufs Wort. Der Bewohner der Dschesireh ist gegen die Kälte viel empfindlicher als der Kurde. Unser Ritt fiel, wie schon einmal erwähnt, in den Spätsommer, und diese Jahreszeit machte sich in den Hochtälern, durch die unser Ritt führte, während der Nacht sehr unangenehm bemerkbar.
Wir befanden uns im unwirtlichsten und wildesten Teil Kurdistans, wo Berge bis 4.000 Meter und darüber keine Seltenheit sind. Hinter uns und zur Linken lagen die mit ewigem Schnee bedeckten Gipfel des Dschelo Dagh und zur Rechten begleitete uns schon seit Stunden die gewaltige Wand des Ser Sati, dessen in den tiefblauen Himmel hineinragenden Spitzen noch von keinem Menschenfuß betreten wurden. Und vor uns, allerdings noch in weiter Entfernung, schien der Rücken des Ispiraisi Dagh uns den Weg verlegen zu wollen.
Unser Ritt war bis jetzt vollkommen glatt verlaufen. Nedschir Bei, der Rais von Schohrd, hatte uns durch den meist von Nestorianern bewohnten Distrikt von Tkhoma geleitet. Am Abend des ersten Reisetags blieben wir in Gundukta, um am nächsten Morgen die steile Passhöhe zu gewinnen, die zwischen dem Gara Dagh und Tschub Dagh die Grenze von Baz bildet. Der Aufstieg war mühsam und beschwerlich gewesen, besonders für unsere des Kletterns ungewohnten Tiere. Und ich beglückwünschte mich im Stillen, dass ich mich nicht, wie ich zuerst im Sinn gehabt hatte, für den hochedlen Syrr entschieden hatte. Dass ich schließlich nicht diesen, sondern Assil genommen hatte, war eigentlich weniger Überlegung als Gefühlssache gewesen. Assil hatte mich auf der ganzen langen Reise nach Mekka und zurück zu den Weidegründen der Haddedihn getreulich auf seinem Rücken getragen, und nun, da die Reise glücklich zu Ende geführt war, wollte ich ihm die Freude nicht nehmen, mich auch noch auf dem, wie ich glaubte, kurzen Endritt zu tragen.
Und es war gut so. Denn Syrr war ein Pferd der weiten, unendlichen Flächen, und ihn, wenn auch unabsichtlich, den holprigen Klettersteigen Kurdistans auszusetzen, hätte ich als eine schwere Versündigung an der hochedlen Natur Syrrs angesehen.
Am Nachmittag des zweiten Tags hatten wir den Bergsattel erreicht.
Hier hieß es abermals Abschied nehmen; Nedschir Bei und seine zehn Begleiter kehrten zurück.
Auch diesmal war es wieder ein Abschied fürs ganze Leben gewesen.
Um die Pferde zu schonen, ritten wir am selben Tag nicht mehr weiter, sondern schlugen unser Lager auf der Sattelhöhe zwischen einigen Felsbrocken auf. Einen anderen Schutz gegen den Wind hatten wir nicht, denn es bedarf kaum der Erwähnung, dass wir die Baumgrenze unter uns zurückgelassen hatten.
Der Abstieg am nächsten Morgen gestaltete sich leichter als der Aufstieg, weil die Berghänge nicht steil, sondern sanft abfielen. Bereits am Mittag erreichten wir den Schin, der ungefähr 50 Kilometer weiter südlich sein Wasser in den Begirdi ergießt. Wir durchritten ihn an einer geeigneten Stelle und dann ging es wieder langsam, aber stetig an einem schmalen Seitenarm, der nur wenig Wasser führte, aufwärts.
Von einem gebahnten Weg war natürlich keine Rede. Wir konnten nur dann und wann Spuren bemerken, aus denen zu schließen war, dass jemand hier gegangen oder geritten sei. Überhaupt zeigte es sich, dass ich wohl daran getan hatte, gerade diesen Weg einzuschlagen. Wir begegneten keiner Menschenseele, die Lust gehabt hätte, mit uns anzubinden. Und wenn wir wirklich einmal an einer menschlichen Behausung vorüberkamen, an einer roh aus Baumstämmen gezimmerten Hütte oder an einem aus lose aufeinandergelegten Steinen aufgeführten ‚Haus‘, dann zogen sich die ungewaschenen und ungekämmten Insassen jedes Mal furchtsam in den hintersten Winkel zurück.
Über die einzuschlagende Richtung war ich keinen Augenblick im Zweifel. Ich hatte mir in Mossul vor unserem Aufbruch eine Karte des in Frage kommenden Gebiets zwischen dem Urmia-See und dem Wan-See gekauft. Wenn ich auch nicht damit rechnen durfte, dass sie in allen Einzelheiten stimmte, so zeigte sie doch die Gebirgszüge in ihren Hauptlinien, und das genügte mir. Außerdem besaß ich ja meinen Kompass, der mich noch nie im Stich gelassen hatte.
Die letzte Nacht hatten wir wieder in einem Satteleinschnitt zugebracht, leider abermals in einer Höhenlage, in der es nicht einen einzigen schützenden Raum, nicht einmal einen Busch oder Strauch gab. In dieser Nacht war es wieder sehr kalt. Aber solange die Witterung nicht umschlug, konnten wir immer noch von Glück reden. Wirklich unangenehm würde es erst dann werden, wenn es zum Regen kam.
Von der kalten Höhenluft abgesehen hatten wir uns über nichts zu beklagen. Wir waren in Lizân mit Lebensmitteln so reich versehen worden, dass wir bis jetzt noch keine Not zu leiden hatten. Und wenn die Vorräte zu Ende gingen, war es auch nicht schlimm. Jagdbares Getier gab es genug, ja, einmal glaubte ich sogar die Fährte eines Bären in dem Geröll des Ufers auszumachen. Jedenfalls würden wir nicht Hungers sterben.
Mit Dojan hatten wir uns gut angefreundet. Er lief meistens neben meinem Tier einher und richtete dann und wann seine klugen Augen mit einem Ausdruck auf mich, als ob er mich fragen wolle, ob ich mit ihm zufrieden sei. Die Nähe einer menschlichen Behausung hatte er jedes Mal angemeldet, nicht laut, sondern durch Zeichen. Wie er sich freilich in Augenblicken wirklicher Gefahr verhalten würde, das musste sich erst zeigen. Bis jetzt hatte ich noch keine Gelegenheit gehabt, ihn daraufhin zu prüfen.
Als ich mit Halef das zu Beginn dieses Kapitels erwähnte Gespräch führte, war der Abend nicht mehr fern. Den ganzen Tag hindurch waren wir über ein breites, mit Geröllschutt bedecktes Hochtal geritten. Die Entfernung, die wir seit unserer Abreise von Lizân bis jetzt zurückgelegt hatten, mochte vielleicht nicht mehr als 80 Kilometer Luftlinie betragen. In Wirklichkeit durften wir aber sicher 120 rechnen, was bei dem unwegsamen Gelände eine bedeutende Leistung für unsere Pferde darstellte. Wenn uns das Glück wie bisher treu blieb, konnten wir nach drei Tagen die persische Grenze hinter uns haben.
Bis zum Anbruch der Dämmerung konnten wir noch gut eine Stunde reiten, und obgleich ich der Tiere wegen gerne früher Halt gemacht hätte, entschloss ich mich doch dazu, weiterzureiten.
Halef überließ sich nach seinem letzten Herzenserguss seinen trüben Betrachtungen, und auch wir schwiegen. Die Einförmigkeit der Natur ringsum hatte uns einsilbig gemacht, sodass wir nur das Allernotwendigste miteinander sprachen.
Da wurde mein Auge von einer schwarzen Stelle im Erdreich gefangen, die einen matt schimmernden Glanz ausstrahlte. Ich zügelte mein Tier und nahm die Stelle in Augenschein. Es war ein großer Stein von jener Färbung, wie sie bei uns zu Hause die Steine aufweisen, mit denen die Straßen geschottert werden. Aber ich erkannte sofort, dass ich hier keinen gewöhnlichen Schotterstein vor mir hatte. Ich ließ mein Auge prüfend über die nächste Umgebung streifen. Wir ritten eben an einem Ausläufer entlang, den der Berg bis ganz nah an unseren Weg heranschickte. Und in einer Gesteinsfalte bemerkte ich das Gesuchte: eine ziemlich breite, schwarz schimmernde Bruchstelle.
Ich war nicht eigentlich erstaunt. Dass es in Kurdistan Steinkohle gab, wusste ich bereits. Der Reisende Otto Blau hatte hoch oben zwischen dem Urmia- und dem Wan-See Kohleadern angetroffen, die ganz offen zu Tage lagen. Man brauchte die Bruchsteine nur vom Boden aufzuheben und für ein prächtiges Lagerfeuer war gesorgt. Unbekannt war mir nur, dass sich das Kohlevorkommen so weit nach Süden erstreckte.
Noch weniger wunderte ich mich darüber, dass dieses Vorkommen noch von niemandem ausgenützt zu werden schien. Der Reisende Blau erzählt, wie er sich bemüht habe, den Nomaden Kurdistans begreiflich zu machen, dass ihnen bei dem völligen Mangel an Brennholz gar kein besserer Heizstoff beschert sein könne als die Kohle. Aber er erreichte dabei so gut wie gar nichts. Die Macht der süßen Gewohnheit, kraft deren die komplette weibliche Bevölkerung den ganzen Sommer hindurch nichts Nützlicheres zu tun weiß, als aus dem Dung der Herden Fladen zur Speisung ihrer Kamine und Feuerlöcher zu backen, war stärker als das Wort der Vernunft.
Das war zwar vor Jahrzehnten, aber im Orient ändert sich bekanntlich in hundert Jahren weniger als bei uns in zehn, und wenn nicht ein Europäer die Sache in die Hand nimmt, dann ist es in weiteren hundert Jahren noch um kein Haar anders.
Meine Begleiter hatten ihre Tiere ebenfalls gezügelt und Halef fragte:
„Was hast du, Sihdi? Und warum schaust du dich so forschend um?“
„Halef, ich kann dir eine erfreuliche Mitteilung machen. Du wirst heute Nacht nicht zu frieren brauchen.“
„Das klingt allerdings lieblich in meinen Ohren. Aber wie kommst du auf diesen Gedanken?“
„Es liegt hier Brennstoff in Menge. Du brauchst ihn nur aufzuheben.“
„Maschallâh! Ich bemerke keinen Grashalm, noch viel weniger den kleinsten dürren Holzspan.“
„Hier ist Besseres als Holz vorhanden und mehr als du brauchst, um die ganze Nacht hindurch ein Lagerfeuer zu unterhalten.“
Halef blickte mich verständnislos an und auch Kara und Omar wussten nicht, was sie sagen sollten. Ich stieg ohne ein Wort der Erklärung ab und hob eine faustgroße Kohle vom Boden auf.
„Dieses Stück Kohle genügt, um einen Topf Wasser zum Sieden zu bringen.“
„Kohle? Das soll Kohle sein?“, rief Halef ungläubig. „Du irrst. Ich kenne die Kohlen genau. Sie werden aus Holz gemacht und dienen dazu, um den Tschibuk in Brand zu setzen.“
„Nicht ich, sondern du bist im Irrtum. Dieses Stück Kohle ist viel besser als deine Holzkohle. Und sie braucht nicht erst hergestellt zu werden, sondern kommt in der Natur, und zwar in den Bergen, in Millionen von Kamelladungen vor.“
Halef sah mich mit offenem Mund an.
„Allâh akbâr! Das soll ich glauben! Ich habe noch nie gehört, dass man Steine zum Feuermachen verwenden kann.“
„Das ist kein Stein wie andere, Halef“, belehrte ich ihn. „Mit diesem Stoff werden bei uns die Lokomotiven geheizt, die die schweren Eisenbahnen zu ziehen haben, und die großen Dampfer, die auf dem Meer schwimmen.“
„Du bindest uns kein Märchen auf?“
„Fällt mir nicht ein. Ich rate dir nur, so viele von diesen ‚Steinen‘ zu sammeln, wie eine halbe Pferdelast ausmacht. Das Weitere wirst du dann sehen, wenn wir Lager machen.“
„Ist es dann nicht besser, wenn wir gleich so viele dieser kostbaren Steine sammeln, wie die Pferde tragen können?“
„Nein, wir dürfen die Tiere nicht überlasten. Wenn mich übrigens nicht alles täuscht, wird es uns in den nächsten Tagen an Brennstoff nicht fehlen.“
Eine Pferdedecke wurde abgeschnallt und auf der Erde ausgebreitet, und es dauerte nicht lange, so hatten wir einen Vorrat beisammen, der für heute und morgen ausreichte. Jetzt, nachdem die Entdeckung einmal gemacht war, war es gar nicht schwer, in dem Geröll so viel losgesprengte Kohletrümmer zu finden, dass uns das Suchen wenig Zeit und Mühe kostete.
Dann setzten wir unseren Weg fort. In der nächsten Stunde hatte ich genug zu tun, um die Wissbegierde meiner Begleiter zu stillen, die alles und jedes über das Entstehen und die Verwendung der Kohle erfahren wollten. Die hereinbrechende Dämmerung setzte dem Gespräch ein Ende. Es galt jetzt einen Lagerplatz für die Nacht zu suchen.
Hinter einem Felsvorsprung, der gegen den Wind Schutz bot, wurde angehalten. Die Tiere erhielten einige Handvoll getrockneter Datteln. Dann wurde Feuer gemacht. Unter unserem Gepäck befand sich eine Kiste, in der unsere Lebensmittel verpackt waren. Ich schnitzelte von dem Deckel einige Späne ab und bald flackerte ein lustiges Feuer auf. Nachdem wir unsere Decken neben der Glut ausgebreitet hatten, ließen wir uns mit einem wirklichen Behagen darauf nieder.
Nach dem Essen überließen wir uns dem traulichen Geplauder, wie es unter Kameraden, die sich verstehen, ganz von selbst an einem warmen Lagefeuer entsteht.
„Sihdi“, bemerkte Halef im Lauf der Unterhaltung, „mir kommt es vor, als ob wir noch nie eine so gemütliche Lagerstelle gehabt hätten.“
„Das scheint nur so, weil du ein paar Tage lang die Wohltat der Wärme entbehren musstest.“
„Daran bist nur du schuld! Hättest du deine Augen besser aufgemacht! Dann hättest du diese Steine, diese unbezahlbaren Spender der Behaglichkeit, sicher schon längst gefunden.“
„Ajjuha – oho!“, tat ich beleidigt. „Ich konnte doch nicht wissen, dass hierherum so etwas zu finden sei. Übrigens hast du dieselben Augen wie ich. Warum…“
„Ich weiß schon, was du sagen willst“, unterbrach mich Halef beschwichtigend. „Ich meine es auch gar nicht so schlimm. Sage mir lieber, ob wir auch auf unserem ferneren Weg Kohlen finden werden.“
Ich wurde einer Antwort enthoben, denn Dojan, der neben mir lag, stieß mich mit der Schnauze an. Als ich zu ihm herniederblickte, bemerkte ich, dass seine glühenden Augen nach der Felsenecke gerichtet waren, hinter der wir lagen. Es war klar – wir wurden von jemandem belauscht.
„Dojan, sert – fass!“, rief ich, sowie ich diese Beobachtung gemacht hatte. Im selben Augenblick warf ich mich platt auf meine Decke nieder, um von einer Kugel nicht so leicht getroffen werden zu können. Meine Begleiter waren sofort meinem Beispiel gefolgt.
Diese Vorsichtsmaßregel erwies sich indes als überflüssig. Dojan war wie ein Schatten hinter dem Felsvorsprung verschwunden. Ein unterdrückter Schrei und das Anschlagen des Hundes sagten mir, dass er den Lauscher gefasst hatte. Ich sprang auf und eilte hinter die Ecke. Dort lag, im Schein der Sterne deutlich erkennbar, der Hund auf einem bewegungslosen menschlichen Körper.
„Dojan, geri – zurück!“
Auf diesen Befehl ließ der Hund den Gefangenen los. Dieser erhob sich und nun konnte ich ihn genauer betrachten.
Der Mann sah sehr heruntergekommen aus. Die Bekleidung ließ zu wünschen übrig und war obendrein an mehreren Stellen zerrissen. Seine Wangen waren eingefallen und seine ganze Haltung ließ auf einen Zustand völliger Erschöpfung schließen. Waffen besaß er keine, nicht einmal ein Messer, eine große Seltenheit hier zu Lande, wo die männliche Bevölkerung es liebt, sich bis an die Zähne bewaffnet zu zeigen.
„Kie bi tu – wer bist du?“, fragte ich in der Kurmangdschi-Mundart, indem ich ihn scharf ins Auge fasste.
„Chodih, ich bin ein Dumbeli-Kurde.“
„Ein Dumbeli-Kurde? Du lügst! Die Dumbeli haben ihre Weideplätze weit im Süden von hier an den Ufern des Sirwan.“
„Du hast Recht. Aber ich habe dich trotzdem nicht belogen. Ich bin wirklich ein Dumbeli, habe aber meinen Stamm schon seit Langem verlassen.“
„Wie kommst du dann in diese Gegend, noch dazu allein?“
„Chodih, ich war bis gestern Abend nicht allein. Ich hatte zwei Fremde zu führen und wir wurden gestern in unserem Nachtlager von einer Abteilung der Schirwani-Kurden überfallen.“
„Das sieht diesen Leuten gleich. Aber was suchen sie in dieser Gegend?“
„Sie kehrten von einem Beutezug zurück, den sie gegen die Deri-Kurden unternommen haben.“
„Die Deri? Wohnt dieser Stamm nicht an der Grenze gegen Persien hin?“
„Du bist gut unterrichtet.“
„Man sagt ihnen nach, dass sie arge Schmuggler seien.“
„O Chodih, wer ist in diesen Bergen kein Schmuggler? Die Deri freilich treiben es am schlimmsten. Darum sind sie auch weit und breit die Wohlhabendsten.“
„Ah, ich verstehe. Dieser Umstand wird wohl die Schirwani zu ihrem Beutezug veranlasst haben. Doch erzähle weiter! Was geschah nach dem Überfall?“
„Die beiden Fremden wurden gefesselt. Mir aber nahm der Scheik meine Waffen ab und jagte mich fort.“
„Seltsam! Ich nehme an, dass es die Räuber nur auf ein Lösegeld abgesehen haben.“
„Das ist auch meine Meinung.“
„Dann verstehe ich nicht, warum sie dich freigelassen haben. Du hättest doch als Dolmetscher gute Dienste leisten können, denn ich bezweifle, dass die Fremden Kurdisch verstehen.“
„Das allerdings nicht. Aber sie sprechen Arabisch und können sich mit dem Scheik in dieser Sprache verständigen.“
„Ah! Dann war deine Hilfe allerdings überflüssig. Fahre fort!“
„Ich machte mich sofort auf den Weg und bin die ganze Nacht und den ganzen Tag mit nur kurzen Unterbrechungen gelaufen.“
„Wem bist du begegnet?“
„Niemand.“
„Und was hast du gegessen?“
„Ne partscha nan – keinen Bissen Brot. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Katera peghamber – um des Propheten willen, gib mir zu essen!“
„Ez be te descha-u-utim – ich bedaure dich. Du sollst bei uns nicht Hungers sterben.“
„Az khorbane ta, Chodih – ich bin dein Eigen, Herr!“
„Sage mir aber vorher, wer die beiden Fremden sind, die du geführt hast.“
„Es sind ein Engländer und ein Perser.“
„Ein Engländer! Also ein Franke! Kennst du seinen Namen?“
Ich stellte diese Frage eigentlich nur der Vollständigkeit halber, ohne jede Nebenabsicht. Denn ich war diesmal entschlossen, die beiden Gefangenen ihrem Schicksal zu überlassen. Das mag vielleicht grausam und meinem sonstigen Wesen fremd erscheinen, aber ich hatte eine dringende Aufgabe zu erfüllen, bei der alle anderen Rücksichten zurückzutreten hatten.
So glaubte ich. Aber mein, wie ich überzeugt war, unerschütterlicher Vorsatz wurde sofort über den Haufen geworfen, auf eine Weise, an die ich nicht im Traum gedacht hätte.
„Der Engländer scheint sehr reich zu sein und heißt Linseh“, beantwortete der Kurde meine Frage.
Ich war für den Augenblick vor Erstaunen keines Wortes fähig. Meine lebhafteren Begleiter dagegen ließen die verschiedensten Ausführungen der Freude und des Schreckens hören. Aber vielleicht war das Ganze ein Missverständnis und es handelte sich um jemand anderen.
„Kennst du vielleicht auch den anderen Namen deines bisherigen Herrn?“
„Ich kenne ihn. Er lautet David.“
Also wirklich! Es konnte kein Zweifel sein, es handelte sich um unseren guten Master Fowling-bull. Oder war es am Ende eine Falle, in die wir gelockt werden sollten?
„Beschreibe mir deinen Herrn!“
Nein, es war keine Falle. Denn der Kurde lieferte von Lindsay einen so genauen ‚Steckbrief‘, dass ich alle Bedenken fallen ließ. Es konnte nur unser alter Freund und Bekannter, der veritable Englishman sein.
Doch davon abgesehen, blieb immerhin noch genug Grund zum Staunen. Sir David Lindsay in Kurdistan! Und zwar im wildesten Teil dieses wilden Landes! Was suchte er hier? War es eine seiner Schrullen, die ihn hierher lockte, oder wurde er von einer bestimmten Absicht geleitet?
Es hatte keinen Zweck, sich darüber in Mutmaßungen zu ergehen. Das Rätsel würde noch früh genug gelöst werden, wenn wir erst Lindsay aus der Klemme geholt hatten, in der er sich befand. Denn dass wir ihn nicht darin stecken ließen, verstand sich von selbst.
Ich hatte ihn seit einer Reihe von Jahren nicht mehr gesehen. Das Letzte, was ich von ihm erfuhr, war ein schriftlicher Bericht über eine Durchquerung Australiens gewesen, die er auf meinen Rat unternommen hatte. Und nun stolperten wir so unversehens und ungeahnt im wilden Kurdistan übereinander.
Zunächst galt es freilich, den halbverhungerten Kurden zu füttern. Füttern ist wirklich das rechte Wort, denn er aß, als ob er seit zehn Tagen gefastet hätte. Dann aber musste er von Lindsay erzählen.
Er wusste nicht allzu viel, aber das wenige gab mir zu denken. In Bagdad war es gewesen, wo der Kurde Lindsay in einer Kaffeebude getroffen hatte. Lindsay beherrschte ja inzwischen das Arabische,30 und da auch der Kurde Arabisch verstand, waren beide miteinander ins Gespräch gekommen. Der Engländer forschte den anderen aus, wie weit er Kurdistan kenne. Das Ergebnis schien befriedigend gewesen zu sein, denn Lindsay mietete ihn als Führer zu einer Reise ins Innere des Landes auf unbestimmte Zeit.
Vor einem Monat waren sie auf einem Dampfboot den Tigris hinauf bis Eski Kuschaf gefahren, das an der Mündung des großen Zab gelegen ist. Von dort aus wollten sie an diesem Fluss aufwärtsreiten. Ein Ziel hatte Lindsay nicht angegeben.
In Eski Kuschaf schloss sich ihnen ein junger Perser an, der ebenfalls im Begriff stand, eine Reise nach Kurdistan zu unternehmen, und von der Absicht des Engländers auf irgendeine Weise Kenntnis erhalten hatte. Er bat ihn um die Erlaubnis, sich ihm anschließen zu dürfen, und der Engländer sagte ohne Weiteres zu.
„Wie heißt der Perser?“, unterbrach ich den Kurden.
„Er nennt sich Mirza Birdschar.“
„Dem Namen nach scheint er so etwas wie ein Gelehrter zu sein.“
„Du hast recht. Er ist Naturforscher und bereist Kurdistan, um seltene Pflanzen und Steine zu sammeln.“
Hm! Ein Perser, der Pflanzen- und Gesteinskunde trieb! Das kam mir eigenartig vor. Aber es war schließlich nicht unmöglich.
„Erzähle weiter!“
Der Perser führte, ebenso wie Lindsay, ein Packtier bei sich. Von Eski Kuschaf ritt die kleine Karawane den Zab aufwärts bis zu den Dörfern der Zibari-Kurden an der großen Biegung des Flusses. Von dort aus folgten sie dem Lauf des Zab nicht mehr weiter, sondern bogen in das Tal des Barazgin ein. Einen Tag ging es geradeaus, dann schwenkten sie nordwärts in die Berge ein.
Lindsay schien es nicht eilig zu haben. Es wurde oft Halt gemacht und dann nahm er seine Hacke und entfernte sich von seinen Begleitern, um an verschiedenen Stellen den Boden aufzugraben.
Ich war im höchsten Maß erstaunt. Ich kannte ja seine Leidenschaft von ehedem, babylonische Altertümer auszugraben, aber ich glaubte ihn von dieser Krankheit geheilt. Und nun trieb er es noch ärger und, wenn es sich wirklich um Altertümer handelte, hoffnungsloser. Denn wenn er früher an Stellen herumgestochert hatte, wo unter Umständen etwas zu finden gewesen wäre, hatte er sich jetzt die unwahrscheinlichste Gegend ausgesucht.
„Es ist klar: Dein Herr sucht etwas. Aber was?“
„Nezanim – ich weiß es nicht.“
„Hast du ihn nie gefragt?“
„Das wohl. Aber er gab mir keine Antwort, sondern schüttelte nur den Kopf.“
„Hm! Hatten seine Grabungen Erfolg?“
„Nein. Wenigstens sah ich ihn nie etwas zurückbringen, seine Hacke ausgenommen.“
„So wird wenigstens der Perser glücklicher gewesen sein. Er wird sicher eine Menge Pflanzen und Steine für seine Sammlung gefunden haben.“
„Er hat bis jetzt nichts gesammelt.“
„Nicht?“
„Nein. Er sagte, diese Reise habe nicht den Zweck, Sammlungen anzulegen, sondern erst einmal einen Überblick zu erhalten. Auf einer folgenden Reise könne er dann planmäßig vorgehen und werde eine reiche Ausbeute gewinnen.“
Wenn mich das, was ich über Lindsay gehört hatte, befremdete, so machte mich die Sache mit dem Perser direkt bedenklich. Ein Sammler, der einen Fund liegen lässt mit der Ausrede, er werde ein andermal wiederkommen – – einen solchen Sammler gibt es nicht. Das ist überhaupt kein Sammler, viel weniger ein Naturforscher.
Aber warum gab sich der Perser für einen solchen aus? Welchen Zweck verfolgte er damit? Führte er gegen Lindsay etwas im Schilde? Oder wählte er diesen Deckmantel nur, um leichter und ohne Verdacht zu erregen im Land reisen zu können?
Das Übrige ist bald gesagt. Sie hatten in kleinen Tagesmärschen ihre Reise fortgesetzt, waren über den Begirdi gegangen und dann, immer in nördlicher Richtung, in die wilden Schluchten des Ser Sati vorgedrungen. Jenseits des Kamms, also auf unserer Seite der Gebirgskette, waren sie von den Kurden überrascht und gefangen genommen worden, ohne dass sie sich hatten wehren können. Der Überfall war, wenn man den Worten des Kurden glauben konnte, ungefähr anderthalb Tagesritte nördlich von uns geschehen.
„Weißt du vielleicht, wie der Führer der Schirwani heißt?“, erkundigte ich mich, als er geendet hatte.
„Ja, es ist Demal Khan, der Scheik jener Abteilung, die am Unterlauf des Begirdi ihre Weideplätze hat. Ich habe ihn einmal in Bagdad gesehen, wohin er gegangen war, um die Galläpfelernte eines Jahres zu verkaufen.“
„Und wie groß ist die Abteilung, die er anführt?“
„Ich schätze sie auf 150 Mann.“
Hm! Da war mit Gewalt nichts zu machen. Das sah sogar Halef ein, der am liebsten mitten unter die Kurden hineingeritten wäre, um den Lord herauszuhauen. Hier konnte nur, wie schon so oft, List zum Ziel führen.
Ich zog die Karte zu Rate. Wenn ich erwog, dass die Schirwani mit Beute beladen, also in ihren Bewegungen behindert waren, so konnte ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit den Weg bestimmen, den die Räuber heimwärts einschlagen würden. Nach meiner Karte kam nur ein einziges Tal in Frage, das in vielen Windungen, aber gerade dadurch bequem zum Kamm des Ser Sati emporführte. Dieser Taleinschnitt lag, von uns aus gerechnet, einen schwachen Tagesritt entfernt in östlicher Richtung, und wenn ich von unserem Standpunkt eine gerade Linie nach Osten zog, so musste diese das Tal an einem Punkt treffen, der von der Stelle des Überfalls nicht mehr als zwei Tagesritte entfernt war.
Zwar konnte ich mich täuschen. Die Räuber mussten sich ja denken, dass sie von den Beraubten verfolgt wurden, und wählten deswegen vielleicht den beschwerlicheren, aber dafür kürzeren Weg. Mit dieser Möglichkeit musste ich also rechnen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Es war mir selbstverständlich nicht möglich, sämtliche Zugänge des Gebirges zu überwachen, und da wählte ich eben jenes Tal, das die meiste Wahrscheinlichkeit für sich hatte, das gesuchte zu sein.
Als ich den Gefährten meine Gedanken vortrug, gaben sie mir in allen Punkten Recht. Anders der Kurde. Er war froh, von den Räubern leichten Kaufs losgekommen zu sein, und hatte nicht die geringste Lust, seinen Kopf ein zweites Mal in die Schlinge zu stecken. Er schilderte uns die Kurden und die Gefahren, denen wir uns aussetzen wollten, in einer Weise, dass uns ein Gruseln hätte ankommen müssen, wenn wir für dieses Gefühl empfänglich gewesen wären. Seine Befürchtungen und Einwände gingen schließlich Halef auf die Nerven.
„Sus ol – sei still!“, unterbrach er ihn, indem er mit beiden Beinen zugleich aufsprang. „Bist du wirklich ein tapferer Dumbeli oder gehörst du vielleicht zu den verachteten Soran-Kurden, von denen man sagt, dass sie einen Feind erst dann mit dem Messer angreifen, wenn sie sich überzeugt haben, dass er bereits von einem anderen totgestochen worden ist?“
„Nabim – nein, ich bin nicht feige“, rief der Kurde, erschrocken über diese unerwartete Anrede. „Aber ihr wagt euch in die Höhle des Löwen, und das Sprichwort sagt: Ei ku zi te qawitere, be wira mekeve – mit einem Stärkeren als du kämpfe nicht!“
„Ez be via keniam – darüber muss ich lachen. Woher weißt du denn, dass diese armseligen Kurden stärker sind als wir? Kennst du uns denn überhaupt? Ich sage dir, keiner von uns würde mit der Wimper zucken, selbst wenn tausend Löwen auf ihn losgelassen würden. Was sollen da diese hundertfünfzig Schirwani-Kurden gegen uns bedeuten!“
Das war wieder ganz – Halef.
Der Kurde wusste hierauf nichts zu erwidern. Vor solcher Größe musste er verstummen.
„Lauf nur, wohin dich deine Beine tragen“, fuhr Halef fort, „wenn dir so wenig an dem Bakschisch liegt, das du zu erwarten hast.“
„Bakschisch?“, dehnte der Kurde zweifelnd. „Von wem hätte ich ein solches zu erwarten?“
„Kannst du noch fragen? Hast du nicht selber gesagt, dass dein bisheriger Herr sehr reich ist? Wenn es uns gelingt, unseren Freund zu befreien, so haben wir doch nur durch deine Mitteilung die Gelegenheit dazu gehabt. Und der Engländer hat also seine Freiheit nicht bloß uns, sondern auch dir zu verdanken.“
Halef hatte Recht. Zwar lag mir nichts an der Begleitung des Kurden, aber er tat mir leid. Er war durch die Räuber um all das Seinige gekommen und stand vollständig mittellos da. Außerdem hatten wir ihm für seine Nachricht wirklich dankbar zu sein.
Der Dumbeli blickte eine Weile unentschlossen vor sich nieder. Dann richtete er seine Augen auf mich und fragte:
„Was hätte ich denn zu tun, wenn ich mit euch ginge?“
„Nichts. Höchstens würden wir von dir verlangen, dass du in unserer Abwesenheit auf unsere Pferde Acht gibst. Wenn wir unseren Freund befreit haben, kannst du gehen, wohin du willst.“
Der Kurde atmete erleichtert auf. „Sonst verlangt ihr wirklich nichts von mir?“
„Nein.“
„Dann will ich gern mit euch gehen. Dschan dedim – ich gebe meine Seele für euch hin. Chodeh scogholeta rast init – Gott stehe dir bei in deinem Vorhaben!“
Damit war für heute alles gesagt, was zu sagen war. Es hatte einstweilen keinen Wert, über die Einzelheiten unseres Plans zu sprechen, denn wir hatten uns nach den Umständen zu richten, die uns jetzt noch unbekannt waren.
Der Kurde streckte sich, als er sah, dass wir keine Auskunft mehr von ihm wollten, ohne Weiteres auf der Stelle nieder, wo er gesessen hatte, und war im nächsten Augenblick eingeschlafen. Und auch wir vier wickelten uns in unsere Decken ein, nachdem wir die Wache bestimmt hatten. Das war notwendig, weniger unserer Sicherheit wegen, denn wir konnten uns auf Dojan verlassen, wie er uns heute bewiesen hatte. Aber die Kälte war groß und das Kohlefeuer musste daher die ganze Nacht unterhalten werden.
Ich hatte die letzte Wache. Noch vor Tagesanbruch weckte ich die anderen. Es wurde rasch gegessen und dann sofort aufgebrochen. Meine Absicht war, das Ziel des heutigen Tags zeitig genug zu erreichen, um einen Überblick über die Örtlichkeit zu gewinnen, bevor die Ankunft der Kurden zu erwarten war.
Unser Weg zeigte sich heute weniger rau als in den letzten Tagen. Er führte uns nach und nach in tiefere Gegenden hinab, über sanfte, abwechselnd mit dürftigem Gras und mit verkrüppeltem Lärchengestrüpp bestandene Hänge. Um die Mittagszeit ritten wir bereits durch ein Wäldchen von schwarzen Maulbeerbäumen, und es mochte die zweite Nachmittagsstunde sein, als wir unter uns das Ziel unseres Ritts erblickten, ein mit immergrünen Myrtensträuchern bestandenes, vielfach gewundenes Tal.
Wir lenkten unsere Tiere den mäßig steilen Abhang hinunter in die Sohle des Tals, über die ein munterer Bach in lustigen Sprüngen seinen Weg von Stein zu Stein suchte. Es herrschte die Ruhe ungestörter Einsamkeit um uns. Hier auf dieser Seite des Bachs waren, wie ich leicht erkennen konnte, die Kurden nicht vorübergekommen, und Kara, den ich aufs andere Ufer geschickt hatte, brachte mir nach kurzer Zeit die gleiche Meldung.
Es fragte sich jetzt nur, ob wir mit unserer Mutmaßung, dass die Kurden ihren Weg durch dieses Tal einschlagen würden, Recht behielten. In diesem Fall hatten wir ihr Kommen in den nächsten Stunden zu erwarten. Vorher mussten wir indes zu erfahren suchen, wo die Erwarteten voraussichtlich ihr Lager für die Nacht aufschlagen würden. Ich wandte mich mit einer diesbezüglichen Frage an Halef.
„Sihdi, das kann kein Mensch wissen“, behauptete der Gefragte.
„Nicht so schnell! Ich hoffe, du wirst mir innerhalb von fünf Minuten das Gewünschte sagen.“
„Was fällt dir ein, Sihdi! Du verlangst zu viel von mir!“
„Wollen sehen! Glaubst du, dass die Kurden bei Nacht über den Kamm des Gebirges reiten werden?“
„Natürlich nicht! Sie werden zweifelsohne in diesem Tal lagern.“
„Werden sie das weiter oben oder weiter unten besorgen?“
Halef blickte forschend das Tal hinauf. „Hm! Die Höhen, die das Tal einschließen, treten rasch näher zusammen. Die Kurden brauchen aber viel Platz zum Lagern, und diesen scheint es da oben nicht zu geben.“
„Tajjib – gut! Es ist ferner zu bedenken, dass sie ihr Lager wohl innerhalb der Baumgrenze aufschlagen wollen und nicht zwischen dem nackten Gestein. Wir haben also nicht aufwärts, sondern abwärts zu suchen.“
„La schakk – darüber besteht kein Zweifel.“
„Weiter! Du bist wohl auch der Meinung, dass die Kurden dieses Tal ganz genau kennen. Werden sie da an irgendeiner beliebigen Stelle Halt machen, die ihren Wünschen entspricht?“
„Nein. Sie werden vielmehr die letzte passende Stelle taleinwärts wählen, damit sie morgen beizeiten über den Kamm des Gebirges kommen.“
„Ausgezeichnet! Wir brauchen also nur so weit talabwärts zu reiten, bis wir eine Stelle finden, die groß genug ist, und wir haben den gesuchten Lagerplatz vor uns. Habe ich Recht oder nicht?“
„Allâh kerim – Gott ist gnädig! Du hast Recht, Sihdi!“
„Siehst du? Die fünf Minuten sind noch nicht vorüber und trotzdem habe ich bereits mit Zuhilfenahme deines Scharfsinns erfahren, was ich wissen wollte“, scherzte ich.
Immerhin war ich meiner Sache nicht ganz sicher. Der obere Teil des Tals war von unserem Standpunkt aus nicht ganz zu übersehen, und es war ganz gut möglich, dass da oben, von uns ungesehen, ein Seitental abzweigte, das selbst für eine größere Menge genug Platz zum Lagern bot. Zur Vorsicht schickte ich daher Omar Ben Sadek hinauf, um nachzusehen.
Meine Sorge war unbegründet. Nach einer Stunde kam Omar zurückgeritten. Er war bis knapp an die Baumgrenze hinaufgekommen und hatte nirgends zwischen dem Bach und der Talseite eine Stelle gefunden, die auch nur zwanzig Personen Platz geboten hätte. Wir konnten also, in dieser Beziehung beruhigt, unseren Forschungsritt talabwärts beginnen. Um möglichst wenig Spuren zu verursachen, hielten wir uns nicht nahe am Bach, sondern in einiger Höhe zwischen den Myrtenbüschen. Wir mochten ungefähr eine halbe Stunde geritten sein, da traten die Höhen zu unserer Linken zurück. Vor uns lag eine kesselartige Ausbuchtung, die einerseits von den bewaldeten Höhen, andererseits vom Bach begrenzt wurde, hinter dem der Hang sofort wieder, und wie es schien, ziemlich steil in die Höhe führte.
Der Talkessel bot einen geradezu vollendeten Lagerplatz. Er wurde von einer weiten Wiesenfläche gebildet, die den Kurden sowohl als Futterplatz für die Pferde als auch als Teppich für die ermüdeten Glieder erwünscht sein musste. Wenn sie wirklich dieses Tal heraufkamen, so war es diese Stelle und keine andere, wo sie Halt machen würden.
Zunächst galt es, für uns selber eine Lagerstelle ausfindig zu machen. Die Schirwani hatten alles, was sie für die Nacht brauchten, in der Nähe, und ich konnte also annehmen, dass sie dem anderen Bachufer keine Aufmerksamkeit schenken würden. Dort drüben waren wir also wohl am besten aufgehoben. Wir ritten auf der eigenen Spur einige hundert Meter zurück und gingen dann durch den Bach, wobei wir uns bemühten, möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Am jenseitigen Ufer angekommen stiegen wir ab und klommen, die Pferde am Zügel, den steilen Abhang empor.
Wir fanden bald, wonach wir suchten, eine grasbewachsene, von Büschen umsäumte Lichtung, groß genug für uns und unsere Tiere. Die Stelle bot außerdem den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass von hier aus der bewusste Talkessel zu überblicken war. Bei Tageslicht waren wir in der Lage, alle Vorgänge zu verfolgen, die sich dort unten abspielten.
Da die Kurden den Talkessel sicher kannten, ging ich wohl nicht fehl, wenn ich annahm, dass sie nicht eher kamen, als bis es an der Zeit war, nämlich bei Anbruch der Dämmerung. Wir hatten also bis dahin noch genug Zeit, um der Ruhe zu pflegen, die wir nach den Anstrengungen der letzten Tage wohl verdient hatten. Aber noch mehr als wir hatten unsere Tiere die Erholung nötig, deren Kräfte durch den tagelangen Ritt über das Gebirge fast über Gebühr in Anspruch genommen worden waren.
Es mochten noch zwei Stunden bis zur Dämmerung fehlen, da schickte ich Kara und Omar Ben Sadek fort, den Bach hinunter, um die Ankunft der Kurden zu beobachten. Sie sollten sich auf unserer Seite, also auf dem rechten Bachufer halten und möglichst wenig Spuren zurücklassen. Sobald sie der Erwarteten ansichtig wurden, sollten sie zurückkehren. Zur größeren Sicherheit gab ich ihnen Dojan als Begleitung mit.
Halef und ich schafften unterdessen, unterstützt von dem Kurden, die Tiere zum Bach hinunter und ließen sie nach Belieben trinken. Dann saßen wir ruhig in unserem Versteck, der Dinge harrend, die da kommen sollten. Mir war nicht ganz wohl zu Mute. Denn wenn meine Berechnung nicht stimmte, dann war ein großer Zeitverlust unvermeidlich. Bis wir die Spuren der Kurden aufgefunden, sie verfolgt und Lindsay befreit hatten, mussten Tage vergehen. Und wir hatten doch keine Zeit zu verlieren!
Unsere Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Aber sie wurde auch dementsprechend belohnt. Eine halbe Stunde vor Einbruch der Dämmerung teilten sich die Büsche vor uns und Kara erschien, gefolgt von dem Hund.
„Sie kommen!“
Gott sei Dank! Mir fiel ein Stein vom Herzen und auch Halef atmete erleichtert auf. Der Kurde dagegen rief erstaunt: „Ser babe men – beim Haupt meines Vaters! Sie haben es erraten, wirklich erraten!“
Dabei machte er ein Gesicht, als ob er soeben das größte Weltwunder erlebt habe.
„Sus ol – sei still!“, fuhr ihn Halef an. „Was redest du da von Erraten? Wir haben unseren ganzen erlauchten Scharfsinn zusammennehmen müssen, um diesen Erfolg zu erzielen, und da sprichst du von Erraten! Was weißt du denn überhaupt von unserer unvergleichlichen Erhabenheit und von unserer erhabenen Unvergleichlichkeit? Kennst du auch nur den Namen des Mannes, der neben dir sitzt und dem Allah so viele Vorzüge gegeben hat, dass der Topf deines Gedächtnisses überfließen würde, wenn du sie alle behalten wolltest?“
„Sein Name wurde bis jetzt nicht genannt“, entschuldigte sich der Kurde.
„So beuge dein Haupt in Demut vor dem Namen Kara Ben Nemsi, der als der berühmteste Held des Morgen- und Abendlands bekannt ist!“
„Ich habe diesen Namen noch nie vernommen“, erwiderte der Dumbeli kleinlaut.
„Ez be te tescha-u-utim – ich bedaure dich! So hast du wohl auch meinen Namen noch nicht gehört? Wisse, ich bin Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah, der Scheik der Haddedihn vom Stamm der Schammar und zugleich der Oberscheik aller Stämme der Beni Arab von Arabistan, Farsistan, Turkestan und Belutschistan.“
„Auch diesen Namen habe ich noch nie gehört.“
„Chodeh t’aveschket – Gott erhalte dich und deinen Verstand!“
Damit wandte Halef dem Kurden verachtungsvoll den Rücken. Gut, dass dieser nicht begriff, welch blühenden Unsinn der Kleine soeben wieder verzapft hatte!
Unterdessen war auch Omar Ben Sadek nachgekommen und wir richteten nunmehr unsere Blicke erwartungsvoll den Bach hinunter. Und richtig! Es war genau so, wie ich vermutet hatte. Die Sonne tauchte eben über die Spitzen des Dschelo Dagh im Westen hinunter, da erschienen sie. Es war ein langer Zug von Reitern, von denen jeder einen schweren Packen hinter sich auf dem Pferd führte.
Ich nahm mein Glas zur Hilfe und bemerkte mitten im Zug zwei Männer, die auf dem Pferd festgebunden waren. Ihre Gesichtszüge konnte ich freilich nicht erkennen, dazu war die Entfernung zu weit. Aber es konnten doch wohl nur die beiden sein, denen alle unsere Gedanken seit dem gestrigen Tag gehörten.
Im Talkessel angekommen zerstreuten sich die Kurden nach allen Richtungen. Die Pferde wurden abgeladen und abgesattelt. Nachdem sie an den Bach zur Tränke geführt worden waren, wurden sie nach dem Hintergrund der Ausbuchtung gebracht und dort sich selber überlassen. Und dann entwickelte sich vor unseren Augen ein lebhaftes Lagertreiben, dem ich heute weniger als sonst Beachtung schenkte, denn meine Aufmerksamkeit wurde von den Gefangenen in Anspruch genommen.
Da die Kurden auf Beute ausgezogen waren, hatten sie keine Zelte mitgenommen, die sie nur unnötig behindert hätten. Nur ein einziges Zelt bemerkte ich, das wahrscheinlich für den Scheik bestimmt war. Es wurde an den Rand des Gehölzes getragen, leider auf der uns abgewandten, also unsichtbaren Seite.
Auch die Gefangenen wurden, nachdem sie von den Pferden gehoben worden waren, in dieser Richtung fortgeschafft.
Unterdessen war die kurze Dämmerung in das Dunkel der Nacht übergegangen und bald blinkten eine Menge Lagerfeuer von unten zu uns herauf.