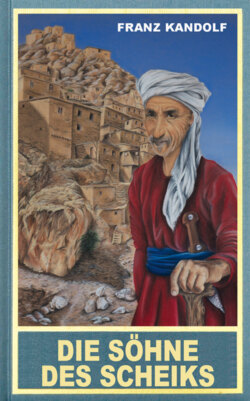Читать книгу Die Söhne des Scheiks - Franz Kandolf - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Das Amulett
ОглавлениеWie die Verhältnisse augenblicklich lagen, konnte ich noch keinen bestimmten Plan zur Befreiung der Gefangenen fassen. Ich wusste nicht, wohin sie gebracht worden waren, und ebenso wenig, wo das Zelt des Scheiks stand, auf den ich es so halb und halb abgesehen hatte. Bevor ich mich zum Handeln entschloss, musste ich also im Bilde sein und dazu war ein Kundschaftergang unerlässlich.
Ich wartete, bis das Gehen und Laufen im Kurdenlager aufgehört hatte. Jetzt konnte ich annehmen, dass sich die Leute mit dem Abendessen beschäftigten, und ich machte mich auf den Weg. Ich nahm nur Dojan mit mir, der mich sicher auf die Nähe eines Menschen aufmerksam machen würde. Nachdem ich den Bach durchwatet hatte, drang ich in den Wald ein und bewegte mich langsam und vorsichtig talabwärts. Ich nahm an, dass die Kurden der Gegend aufwärts weniger Aufmerksamkeit schenken würden, weil ein Überfall durch die Beraubten nur von unten her zu fürchten war. Trotzdem wich ich, bevor ich den Waldrand erreicht hatte, aus Vorsicht noch tiefer seitwärts zwischen die Bäume, um nicht mit einem Posten zusammenzustoßen, der möglicherweise an den oberen Ausgang des Talkessels gelegt worden war. Unhörbar schlich ich mich am Rand der Ausbuchtung hin. Zwischen den Myrtensträuchern hindurch hoben sich die Lagerfeuer der Kurden ziemlich scharf gegen den Himmel ab. Die Männer saßen tatsächlich beim Essen und das Ganze bot ein Bild des tiefsten Friedens.
Da fühlte ich, wie sich die Schnauze des Hundes in meine Hand schob; er hatte die Nähe eines Menschen gewittert. Vorsichtig schlich ich weiter und gewahrte nach wenigen Schritten einen schwarzen Gegenstand, der in verschwommenen Umrissen zwischen Wald und Wiesenplan lag. Meine Vorsicht verdoppelnd schlich ich näher; die Umrisse des Schattens wurden deutlicher und ich erkannte ein kleines Zelt, das man hier aufgeschlagen hatte. Diese Ahnung wurde sofort zur Gewissheit, denn gerade in diesem Augenblick löste sich eine Gestalt von einem der Feuer und näherte sich dem Zelt.
„Tschi heje tschi tun’e – was gibt’s?“, fragte die Stimme eines Mannes, den ich nicht sehen konnte. Offenbar saß er vor dem Eingang des Zeltes.
„Der Inglis gibt keine Ruhe. Er schimpft in einem fort und verlangt losgemacht zu werden.“
„Wenn er nicht still ist, so stopfe ihm das Maul!“, lautete die bündige Antwort. „Was macht der andere?“
„Der? Oh, der verursacht uns nicht halb so viel Scherereien. Er scheint sich in sein Schicksal ergeben zu haben.“
„Nun, dann ist es gut. Bewacht sie immerhin scharf, denn man kann diesen fremden Hunden nicht trauen. Im Übrigen wünsche ich in der Nacht nicht gestört zu werden, außer im Notfall.“
„Tu tschi firman kir – wie du befiehlst, Herr. Ivari’l kher – gute Nacht.“
Der Scheik brummte etwas Unverständliches in den Bart und der Mann entfernte sich.
Ich beglückwünschte mich im Stillen, denn die Verhältnisse hätten sich gar nicht günstiger gestalten können. Mein Plan stand im Augenblick fest: Ich musste den Scheik in meine Gewalt bringen. Aber nicht jetzt, sondern erst später, wenn sich die Kurden zur Ruhe begeben hatten. Vorher war die Möglichkeit vorhanden, dass der Scheik aus irgendeinem Grund im Zelt aufgesucht wurde, und dann wäre sein Verschwinden eher entdeckt worden, als mir lieb sein konnte.
Da es von Vorteil für mich sein konnte, wenn ich auch die weitere Umgebung des Scheikzelts kennenlernte, ging ich weiter in der Richtung nach dem Hintergrund der Ausbuchtung. An keiner Stelle traten die Lagerfeuer bis an die Bäume heran, was mir später zustattenkommen würde, weil ich dann eine Überraschung von rückwärts her weniger zu fürchten brauchte. Dann hörten die Lagerfeuer auf und eine kleine Strecke weiter belehrte mich ein Schnauben zu meiner Rechten, dass ich die Pferde vor mir hatte.
Ich konnte nun getrost zu meinen Gefährten zurückkehren. Vorerst wollte ich mich indes vergewissern, ob der obere Ausgang des Talkessels von einem Posten bewacht wurde oder nicht. Am Zelt des Scheiks vorbei näherte ich mich der Ecke, wo der Wald an den Bach stieß. Unter den letzten Bäumen angekommen legte ich mich nieder und kroch unhörbar weiter.
Richtig! Ich bemerkte eine Gestalt, die sich ein Dutzend Schritte vor mir gegen den helleren Himmel vom Dunkel abhob. Sie saß regungslos am Bachufer auf einem großen Stein und hielt die lange Flinte zwischen den Knien. So waren die Kurden also doch vorsichtiger gewesen, als ich ihnen zugetraut hatte. Nun, wenn auf dieser Seite des Tals nicht mehr Posten standen als dieser eine hier – – der konnte mich in meinem Vorhaben sicher nicht hindern.
Auf demselben Weg, auf dem ich gekommen war, kehrte ich zu den Gefährten zurück, die meinem Bericht mit Spannung entgegensahen. Ich entwickelte nun meinen Plan, der begeisterte Zustimmung fand, ausgenommen natürlich bei dem Kurden, der bei allem nur stumm den Kopf schüttelte. Der hitzige Hadschi fasste dies als Zeichen der Ablehnung auf, denn er fuhr ihn auf einmal erbost an: „Warum schüttelst du beständig den Kopf, als ob er ein angefaulter Apfel wäre, der im nächsten Augenblick auf den Boden fallen muss? Bist du vielleicht anderer Meinung als wir?“
„Verzeih, o Scheik, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich halte euren Plan, Demal Khan in eure Gewalt zu bekommen, für tollkühn und unausführbar.“
„Tu kadischt nezani – was du nicht weißt! Vielleicht ist deine erlauchte Einsicht so gnädig, uns einen besseren Plan vorzulegen! Sollen wir am Ende warten, bis der Scheik der Kurden von selber anspaziert kommt, sich vor uns hinstellt und sagt: ‚Ihr habt mich gewünscht, hier habt ihr mich!‘“
Der Kurde wusste nicht, was er darauf erwidern sollte, und schwieg. Nun erhob sich ein kleiner Wettstreit unter meinen drei Gefährten. Jeder wollte mit mir gehen, ich konnte aber nur einen Einzigen gebrauchen. Einer mehr hätte die Sache nur erschwert.
Ich bestimmte Kara zu meiner Begleitung. Halef gab sich rasch mit meiner Entscheidung zufrieden, da es doch wenigstens sein Sohn war, der „den Ruhm der neuen Heldentat ernten“ durfte. Und auch Omar Ben Sadek beruhigte sich, als ich anmerkte, dass sich ihm während dieser Reise noch oft genug Gelegenheit bieten werde, seinen Mut zu beweisen.
Da es noch zu früh war, um unseren Gang anzutreten, konnten wir nichts Besseres tun als schlafen. Ich ging zu meinem Rappen, schmiegte mich an seine Seite und flüsterte ihm die gewohnte Sure ins Ohr. Ein Feuer war heute nicht notwendig, weil wir im Schutz der Bäume lagen, und außerdem auch nicht anzuraten, da der Schein unseren Standpunkt den Kurden leicht verraten konnte.
Ich schlief so ruhig, als ob ich zu Haus in meinem Bett läge, erwachte aber genau zu der vorher bestimmten Zeit. Es mochte ungefähr ein Uhr morgens sein, die beste Stunde für ein Unternehmen wie das unsere. Es war Neumond und die Sterne verbreiteten ein fahles Licht, das kaum hinreichte, um den Weg ein paar Schritte weit zu erhellen.
Die Kurden hatten die Feuer ausgehen lassen und es herrschte da unten das schwärzeste Dunkel. Nachdem ich den Gefährten eingeschärft hatte, sich für alle Fälle vollkommen ruhig zu verhalten, machten wir, nämlich Kara und ich, uns auf den Weg. Den Hund ließen wir diesmal zurück, weil er uns voraussichtlich wenig von Diensten hätte sein können. Jenseits des Bachs drangen wir sofort eine Strecke weit in den Wald ein und wanden uns dann in der Richtung auf das Zelt des Scheiks durch die Büsche. Zwar hätten wir auch den Weg das Bachufer hinunter einschlagen können, aber ich wollte für alle Fälle dem Posten da unten aus dem Weg gehen.
Das Anschleichen wurde uns dadurch sehr erleichtert, dass die Myrtenbäume und -sträucher nicht allzu dicht nebeneinander standen. Als wir nach meiner Berechnung dem Rand der Lichtung nahe waren, verdoppelten wir unsere Vorsicht. Kara hatte in meiner Schule viel gelernt, denn so sehr ich mich anstrengte, vernahm ich doch von dem hinter mir schreitenden jungen Mann keinen Laut. Ich hatte meine helle Freude an ihm.
Ich hatte die Richtung doch nicht ganz genau eingehalten, denn es zeigte sich, als wir den Rand der Ausbuchtung erreichten, dass wir von unserem Ziel etwas zu weit nach links abgekommen waren. Dieser kleine Nachteil war bald ausgeglichen und nach fünf Minuten lagen wir bereits unter den letzten Bäumen hinter dem Zelt des Scheiks.
Einige Minuten blieben wir regungslos liegen. Als sich nichts regte, kroch ich allein weiter auf die Rückwand des Zelts zu. Hier konnte ich mich, durch das Zelt gegen die Blicke etwaiger Beobachter gedeckt, ziemlich sicher fühlen. Indem ich mein Ohr an die Leinwand legte, hörte ich die regelmäßigen tiefen Atemzüge eines Schlafenden. Ob sie von einer Person oder von zweien ausgingen, war freilich nicht zu unterscheiden.
Ein leises Zischen rief Kara herbei. Mit seiner Hilfe lockerte ich an einem der Pflöcke die Zeltschnur und hob den Saum der Leinwand in die Höhe, sodass so viel Zwischenraum entstand, dass eine Person bequem hindurchschlüpfen konnte. Dann lauschten wir abermals. Ja, es war kein Zweifel, es befand sich nur eine Person im Zelt, und das konnte nur der Scheik sein. Kara brachte seinen Mund ganz nahe an mein Ohr und flüsterte:
„Sihdi, darf ich?“
„Na’am – ja“, hauchte ich zurück.
Im nächsten Augenblick war er an mir vorbei unter der Zeltplane verschwunden. Ich lockerte mein Messer, um ihm sofort beispringen zu können, aber dieser Notfall trat nicht ein. Eigentlich hätte ich die bei der mangelnden Beleuchtung nicht unschwierige Aufgabe, den Scheik zu betäuben, auf mich nehmen sollen, was ich wohl auch getan hätte, wenn Halef und nicht Kara bei mir gewesen wäre. Aber Kara war vorsichtig und geistesgegenwärtig, und es war Zeit, dass ich ihn selbstständig handeln ließ. Warum auch nicht? Als ich den ersten Indsman unter mir hatte, war ich bedeutend jünger gewesen als jetzt Kara.
Ich lauschte. Es war eine Weile still. Dann klang es zu mir herüber wie das Geräusch, das jemand verursacht, wenn er heftig mit den Beinen strampelt und dabei den Erdboden mit den Füßen bearbeitet. Dann trat wieder vollständige Ruhe ein.
„Sihdi!“, erklang es leise.
„Kara?“, fragte ich ebenso leise zurück.
„Komm herein, Sihdi! Ich habe ihn.“
Ich schlüpfte unter der Leinwand durch und zog dann das Phosphorfläschchen hervor, das mich auf all meinen Reisen begleitet hatte. Nachdem ich dem Sauerstoff der Luft durch Öffnen des Verschlusses Zutritt gewährt hatte, vermochte ich die Umgebung zu unterscheiden. An der rechten Längswand des Zeltes kniete Kara auf einem Mann, der steif und bewegungslos wie ein Toter dalag. Knebel und Fesseln führten wir bei uns und so war es das Werk einer Minute, bis der Mann vollständig wehrlos vor uns lag. Wie mir Kara später erzählte, hatte er sich Zoll um Zoll am Boden vorwärtsgeschoben, bis seine Hand den Saum einer Decke streifte. Langsam und leise waren seine Finger weitergeglitten und schließlich legten sich seine beiden Hände mit einem so blitzschnellen und durchgreifenden Druck um den Hals des Überfallenen, dass dieser es nur zu einem verzweifelten Strampeln brachte. Das liest sich zwar sehr leicht, bedarf indes einer großen Übung, die Kara freilich hinreichend gehabt hatte. Ich wusste, dass die jungen Krieger der Haddedihn den Griff um den Hals, den sie von mir hatten und bei dem es vor allem darauf ankommt, dass der Überraschte nicht im Stande ist, einen Laut von sich zu geben, untereinander buchstäblich bis zur Bewusstlosigkeit eingeübt hatten.
Der Scheik war in unserer Gewalt, und was noch vor uns lag, war eine Kleinigkeit. Aber während wir den Bewusstlosen unter der Zeltleinwand hindurch hinaus ins Freie schafften, kam mir ein Gedanke. Es war für uns vorteilhafter, wenn die Kurden gar nicht erfuhren, dass der Scheik seiner Freiheit beraubt worden war, sondern wenn die Sache so aussah, als hätte er sich aus irgendeinem Grund freiwillig entfernt. Deshalb kehrte ich, als wir den Scheik draußen hatten, ins Zelt zurück. Ich faltete die Decke so, wie sie auszusehen pflegt, wenn ein Mann sie beim Aufstehen von sich streift. Dann nahm ich ein Gefäß mit Wasser, das in Reichweite vom Lager stand, und goss es draußen über die Spuren, die beim Anschleichen nicht zu vermeiden gewesen waren. Dies und der am Morgen zu erwartende Tau würden alle Spuren des nächtlichen Besuchs verwischen. Nachdem ich noch die Leine um den Zeltpflock befestigt hatte, war alles getan, was in unserer Möglichkeit stand, und nur ein gewiegter Fährtenleser – und über einen solchen verfügten die Kurden sicherlich nicht – wäre im Stande gewesen, den wahren Sachverhalt ausfindig zu machen.
Ich nahm den immer noch bewusstlosen Scheik auf die Schulter, während Kara voranging. Das ganze Abenteuer hatte sich so einfach und reibungslos abgewickelt, als ob es vorher einstudiert worden wäre, und als wir oben bei den Gefährten ankamen, war seit unserem Aufbruch höchstens eine Stunde vergangen.
Bei unserem Erscheinen sprangen die Wartenden auf. Hier oben war es immerhin so hell, dass die Gesichtszüge jedes Einzelnen zu erkennen waren. Der Kurde warf einen forschenden Blick auf den Gefangenen und rief dann im Ton maßlosen Erstaunens aus:
„Katera peghamber – um des Propheten willen! Sie haben ihn! Sie haben ihn wirklich! Es ist nicht zu glauben, nicht zu glauben!“
„Was ist nicht zu glauben, du Sohn und Enkel der Ungläubigkeit?“, wies ihn Halef zurecht. „Wir haben dir doch gesagt, dass wir den Scheik holen würden, und zwar, wenn es hätte sein müssen, mitten aus der Dschehenna heraus. Du freilich hättest es gemacht wie jener Koch, der sich eine fette Henne aus dem Hühnerstall holen wollte, aber nur ein armseliges Küken zwischen die Finger bekam. Chodeh t’aveschket – Gott bewahre dich!“
Ich befreite den Gefesselten jetzt vom Knebel. Während wir auf sein Erwachen warteten, schilderte Kara kurz und sachlich den Verlauf unseres Unternehmens, wozu er nur den zehnten Teil der Zeit brauchte, die Halef benötigt hätte, wenn er dabei gewesen wäre. Dieser war übrigens nicht wenig stolz darauf, dass ich Kara den Löwenanteil des Ganzen, nämlich die Überwältigung des Scheiks, überlassen hatte.
Bei diesem stellten sich jetzt endlich Zeichen des wiederkehrenden Bewusstseins ein. Seine Lippen öffneten sich zu einem langen, befreienden Seufzer und seine Augen bewegten sich. Erst blickten sie starr und ohne Ausdruck geradeaus, dann aber richteten sie sich fragend auf uns. Ich setzte ihm das Messer auf die Brust und drohte:
„Kein lautes Wort, wenn dir dein Leben lieb ist!“
Erst jetzt schien er zu bemerken, dass er gefesselt war. Mit einer gewaltigen Muskelanstrengung suchte er sich zu befreien, aber die Riemen hielten fest. Ein Ausdruck des Schreckens trat in seine Züge.
„Koe ez be – wo bin ich? Und wer seid ihr?“
Plötzlich schien ihm das Unglaubliche seiner Lage aufzudämmern. Er bäumte sich in seinen Fesseln auf und stieß hervor:
„Kutikan – ihr Hunde! Ihr habt es gewagt, mich zu binden. Wisst ihr, wer ich bin?“
„Ja. Du bist ein niederträchtiger Räuber, der seine Strafe finden wird.“
„Hüte dich, mich zu beleidigen! Ich bin Demal Khan, der Scheik der Schirwani-Kurden.“
„Pah! Das wusste ich längst. Und was ist da weiter dabei? Ein Räuber, der Räubern befiehlt! Ich verlache dich!“
„Beraz! Beni lingi te dar bokutim – Schwein! Ich werde dir die Bastonade geben lassen!“
„Mach dich nicht lächerlich! Du musst wahnsinnig sein, wenn du glaubst, in deiner Lage uns drohen zu können.“
„Ich bin nicht wahnsinnig. Meine Krieger werden kommen und mich befreien. Und dann wehe dir! Ez heifi choe desti choe bigerim tera – ich werde mit eigener Hand an dir Rache nehmen.“
„Verlasse dich nicht auf deine Krieger! Sie werden dich nicht befreien, weil sie nicht wissen können, wo du dich befindest.“
„Sie werden entdecken, dass ich entführt worden bin, und mich überall suchen.“
„Du irrst. Sie werden nur auf den Gedanken kommen, dass du aus irgendeinem Grund fortgegangen bist. Dafür habe ich gesorgt.“
„Aber was willst du von mir? Ich habe dir doch nichts getan!“
„Mir nicht. Aber du hast einen Perser und einen Engländer überfallen.“
„Was geht dich das an?“
„Der Engländer ist mein Freund.“
„Das ist sehr gut. So wirst du also gern das Lösegeld für ihn bezahlen.“
Das klang so treuherzig, dass wir unwillkürlich lachen mussten.
„Du hast recht. Ich werde das Lösegeld bezahlen.“
„Hast du denn so viel bei dir?“
„Ja. Hier liegt es.“
„Wo? Ich sehe es nicht.“
„Dann bist du sehr schwer von Begriff. Du selber bist das Lösegeld und wirst deine Freiheit nur erhalten, wenn du meinen Willen tust.“
Der Scheik schwieg.
Offenbar konnte sein kurdisches Hirn meine Worte nicht so schnell verarbeiten.
„So willst du mich also gegen die zwei Gefangenen austauschen?“, fragte er endlich.
„Dein Scharfsinn hat das Richtige erraten.“
„Aber dann erhalte ich ja in Wirklichkeit gar kein Lösegeld!“
„Die Freiheit ist mehr wert als hunderttausend Medschidijeh31.“
„Suchst du mich nicht zu hintergehen? Ich bin nur einer und die Gefangenen sind zwei. Du würdest also von mir das Doppelte von dem erhalten, was ich von dir bekomme.“
„Was höre ich, o Scheik? Ich hätte gedacht, ein Khan der Kurden würde sich und seine Freiheit viel höher einschätzen als den Wert zweier Gefangener.“
Wieder versank der andere in Schweigen. Die Gedankenarbeit, die ihm heute zugemutet wurde, schien fast zu viel zu sein für sein Fassungsvermögen. Die Verhandlung war in ein beinahe gemütliches Geleis getreten. Der Mann schien der Eisenfresser gar nicht zu sein, als welchen ihn seine ersten Worte, die nicht gerade höflich gewesen waren, erscheinen ließen. Oder er verstellte sich. Dann war er freilich ein sehr geschickter Schauspieler, vor dem man sich in Acht zu nehmen hatte.
Der Scheik war mit sich ins Reine gekommen. Er ergab sich seufzend in sein Schicksal.
„Ich sehe ein, dass ich nachgeben muss. Die Gefangenen sind von jetzt an frei. Binde mich nun los!“
„Halt, nicht so schnell! Die Gefangenen erhalten natürlich ihr vollständiges Eigentum zurück?“
„Chodih, das ist zu viel! Darauf kann ich nicht eingehen.“
„Dann bleibst du auch gefangen.“
„Wohin wirst du mich bringen?“
„Es fällt mir natürlich nicht ein, dich mit uns herumzuschleppen. Ich liefere dich einfach den Deri aus, die du beraubt hast.“
„Herr“, rief er erschrocken, „woher weißt du das?“
„Von dem da.“
Dabei zeigte ich auf den Dumbeli-Kurden.
Der Scheik schenkte erst jetzt dem Genannten seine Beachtung und erkannte ihn sofort trotz des mangelhaften Lichts.
„Verdammt!“, entfuhr es ihm. „Der Dumbeli ist also an allem schuld! Hätte ich ihm doch nicht die Freiheit gegeben!“
„Ha, das hast du nicht klug angefangen“, lachte ich. „Und du musst nun einsehen, dass du vollständig in meiner Gewalt bist.“
„Aber wenn du mich an die Deri auslieferst, bleiben der Engländer und der Perser gefangen.“
„Mach dir darüber keine Sorgen! Diese zwei hole ich natürlich vorher aus dem Kurdenlager.“
Der Scheik sah mich mit offenem Mund an, als ob er etwas ganz und gar Unerhörtes vernommen habe. Da mischte sich einer in die Unterhandlung, dem ich es am wenigsten zugetraut hätte, nämlich der Dumbeli.
„Scheik, ich rate dir gut. Glaube ihm! Ich bin erst seit gestern bei diesen Männern, aber ich kenne sie so gut, als ob ich schon seit Wochen bei ihnen weilte. Ich sage dir, sie machen alles, aber auch alles möglich.“
„Auch ich rate dir, nicht zu zweifeln“, fuhr ich fort. „Habe ich dich nicht aus deinem Zelt geholt, ohne dass einer deiner Männer etwas merkte? Meinst du, ich brächte dasselbe Kunststück nicht auch ein zweites Mal fertig? Also entscheide dich!“
Der Scheik mimte abermals ein würdevolles Nachdenken, dann sagte er:
„Du sollst deinen Willen haben. Die Gefangenen sollen ihr ganzes Eigentum zurückerhalten. Aber jetzt gib mich endlich frei!“
„Ich wiederhole, nicht so schnell! Ich kann dich erst freilassen, wenn du dein Wort gehalten hast.“
„Warum nicht eher?“
„Ich traue dem Wort eines Kurdenscheiks nicht.“
„Herr“, fuhr er beleidigt auf, „mit welchem Recht sprichst du solche Worte?“
„Mit dem Recht eines Mannes, der seine Erfahrungen hat.“
„Auf das Wort eines Schirwani kannst du dich verlassen.“
„Gerade bei den Schirwani habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Kennst du Scheik Melef, den Anführer jener Abteilung, die am oberen Zab ihre Weideplätze hat?“
„Ich habe ihn gekannt. Er ist tot.“
„Welche Meinung hast du von ihm? War er in allem ein ehrenwerter Mann?“
„Hm!“
„Ich wohnte mehrere Tage unter seinem Zelt als Gastfreund, und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stellte er mir mit seinen sämtlichen Kriegern nach, um sich meines Eigentums, meines Pferdes und meiner Gewehre zu bemächtigen.“32
„Hm!“
„Begreifst du jetzt, dass ich dem Wort eines Schirwani nicht ohne Weiteres trauen kann?“
„Hm!“, brummte der Scheik zum dritten Mal.
„Ist dieses ‚hm‘ alles, was du vorzubringen weißt?“
„Nein. Weißt du nicht, dass der Gastfreund nur so lange sicher ist, als die Gastfreundschaft währt?“
„Ich weiß es, aber ich verwerfe diesen Grundsatz, denn es ist der Grundsatz von Räubern und Mördern.“
Der Scheik zuckte die Achseln. „Du übertreibst. Es ist einfach Sitte bei den Kurden.“
„Schöne Sitte ist das!“
„Herr, du bist kein Kurde?“
„Skuker Chodeh, nabim – Gott sei Dank, nein!“
„Darf ich fragen, aus welchem Land du kommst?“
„Ich bin ein Franke.“
„So bist du also ein Christ?“
„Ja.“
„Dann kannst du uns freilich nicht verstehen. Du hättest besser getan, deine Heimat nicht zu verlassen.“
Ich musste lächeln. Nun war es gar der Kurde, der mir gute Lehren erteilte.
„Gibt es in deinem Land keine Diebe und Räuber, wie du es nennst?“, fuhr der Scheik fort.
„Ich kann es nicht leugnen. Es gibt eben überall gute und böse Menschen, so wie es Engel gibt, aber auch Teufel.“
„Siehst du? Es kann nicht lauter untadelige Menschen geben. Wir Kurden sagen: Be Chodera dschennet u dschenneme tschebun – durch Gott ist beides geworden, Paradies und Hölle.“
„Damit ist aber nicht gesagt, dass die Hölle Hölle bleiben soll.“
„Warum nicht? Wenn sich der Teufel dabei wohlfühlt?“
„Mann, lästere nicht! Das ist nicht möglich! Erlaube, dass ich deinem Satz einen anderen entgegenstelle: Melak a ditir, an Scheitan a ta khwa – du sollst der Engel deines Nächsten sein, damit du dir nicht selbst zum Teufel wirst.“
Diese Worte waren mir ohne irgendeinen Nebengedanken entschlüpft. Sie waren mir unwillkürlich auf die Lippen getreten, weil sie sich folgerichtig in den Gang der Rede einfügten. Die überraschende Wirkung, die sie auslösen würden, ahnte ich nicht.
Demal Khan war bei meinen letzten Worten vor Erstaunen mit dem Oberkörper in die Höhe geschnellt, sodass er jetzt eine sitzende Stellung einnahm.
„Welche Worte gebrauchtest du da?“, rief er in höchster Überraschung. „Ich bitte dich, wiederhole sie mir, damit ich weiß, ob ich dich recht verstanden habe.“
„Gern. Ich sagte: Melak a ditir an Scheitan a ta khwa.“
„Wirklich! Es sind dieselben Worte, genau dieselben Worte! Sage mir, ob es vielleicht in deinem Vaterland ein Sprichwort gibt, das auf Kurdisch genauso heißen würde.“
„Nein. Diese Worte sind mir zuerst in Kurdistan gesagt worden.“
„Dann verzeihe, Chodih, dass ich nicht im Stande bin, mich zu erheben und dich so zu begrüßen, wie es sich gebührt. So musst du dich also mit den Worten begnügen: Az kholame ta, Hodia – ich bin dein eigen, o Gebieter!“
Nun war die Reihe des Erstaunens an mir. Denn dass das Amulett Marah Durimehs sogar unter den Schirwani-Kurden Kurswert haben würde, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Trotzdem erkundigte ich mich vorsichtig: „Du kennst also diese Worte auch?“
„Und ob ich sie kenne! Aber ich weiß nicht, ob ich offen sprechen darf.“
Ich verstand ihn wohl. Es handelte sich um ein Erkennungswort, und es konnte nicht in seiner Absicht liegen, mit Unberufenen darüber zu sprechen. Meine drei Gefährten waren zwar eingeweiht, nicht aber der Dumbeli-Kurde. Ich gab ihm daher einen Wink, sich zu entfernen, und er gehorchte ohne ein Wort der Widerrede.
„Du kannst jetzt reden. Diese Männer besitzen mein volles Vertrauen und kennen die Losung – denn um eine solche handelt es sich doch – ebenso gut wie ich.“
„So wisse, dass jeder Mensch, und sei er mein größter Feind, der mir diese Worte, die wirklich eine Losung sind, zuruft, bei mir sicher ist wie im Schoß des Propheten. Er hat zu befehlen und ich habe zu gehorchen, denn: Betschuk lazime tabe’i mezinan bebe – der Kleine muss den Großen gehorsam sein.“
Nun, solch ein Amulett konnte ich mir gefallen lassen. Marah Durimeh war doch eine herzensgute grandmother, wie Lindsay damals zu sagen pflegte, als wir sie das erste Mal kennenlernten.
„Wer hat dir diese Worte genannt?“, forschte ich weiter.
„Der gute Dschinn.“
„Wer ist das?“
„Das weiß kein Mensch. Er ist eben ein Geist, der alles sieht und hört.“
Nun, ich wenigstens glaubte das besser zu wissen, fühlte mich aber indes nicht berufen, ihn aufzuklären.
„Und wie gibt sich dieser Geist zu erkennen?“
„Herr, wir sind ein armes Volk und es gibt oft große Not in den Bergen. Wenn nun jemand ein Anliegen hat, dem mit Geld abgeholfen werden kann, so muss er in nächtlicher Stunde sein Haus verlassen und seine Bitte laut in die Nacht hineinrufen. Ist der Bittsteller wirklich arm und verdient er Berücksichtigung, so wird ihm Erhörung zuteil.“
Das war nicht viel anders als damals die Sache mit dem Ruh y Kulyan33. Nun, ich konnte mir ja denken, dass Marah Durimeh da und dort ihre Vertrauten hatte, die mit den nötigen Geldmitteln ausgerüstet waren. Somit war der ‚gute Dschinn‘ für mich kein Rätsel mehr.
„Und auf welche Weise wird der Bittsteller erhört?“
„Er findet nach einigen Tagen an der Schwelle seines Hauses ein oder mehrere Goldstücke, gerade so viel, als er notwendig braucht. Manchmal währt es auch länger, wenn nämlich der Geist nicht in der Nähe ist.“
Das glaubte ich dem Scheik gern. Es war ja anzunehmen, dass Marah Durimeh nicht in jedem Kurdendorf einen Eingeweihten hatte. Aber dadurch, dass der Hilfsbedürftige sein Anliegen laut in die Nacht hineinrufen musste, wurde es bekannt. Es sprach sich herum und erreichte schließlich das Ohr eines der Untergeister des ‚guten Dschinn‘.
„Du hast mir noch immer nicht gesagt, wie du selber zur Kenntnis des bewussten Satzes gekommen bist.“
„Ich fand eines Morgens einen Zettel vor meiner Tür, in dem ich gebeten wurde, jeden als Bruder aufzunehmen und zu behandeln, der mir die Worte sagt oder zeigt, die du genannt hast. Die Unterschrift lautete: der gute Dschinn.“
„Und du wirst dieser Weisung immer und überall gehorchen?“
„Sere men – bei meinem Haupt, ich werde es tun.“
„Auch hier und jetzt uns gegenüber?“
„Wie kannst du noch fragen? Ihr seid meine Brüder und ich bitte euch, in meinem Zelt Brot und Salz aus meiner Hand anzunehmen.“
„Wenn du wirklich unser Bruder bist, dann dürfen wir dich nicht länger als Gefangenen behandeln. Ich werde dir sofort die Fesseln lösen lassen.“
Auf einen Wink von mir nahm ihm Omar die Riemen ab. Der Scheik stand langsam auf, dehnte und streckte sich im Wohlgefühl der wiedererlangten Freiheit und setzte sich dann wieder vor uns nieder.
„Herr, ich danke dir. Und du sollst dich nicht in mir getäuscht haben. Soll ich sofort gehen und dir die Gefangenen bringen?“
„Dazu ist am Morgen noch Zeit“, beeilte ich mich zu erwidern. Ich durfte die nötige Vorsicht nicht außer Acht lassen, denn es war immerhin die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass alles bloße Verstellung war. „Erzähle mir lieber noch einiges vom guten Dschinn! Wird seine Güte niemals von Unwürdigen missbraucht?“
„Das ist früher vorgekommen, aber jetzt schon lange nicht mehr. Der Betreffende hätte nur Schande und Spott zu erwarten.“
„Wieso? Wie kann der Dschinn den Würdigen vom Unwürdigen unterscheiden?“
„Wie kannst du noch fragen? Er ist doch allwissend!“
Ja so! Das hatte ich ganz vergessen!
„Wenn jemand die Hilfe des guten Dschinn ohne hinreichenden Grund in Anspruch nimmt, dann findet er vor seiner Tür nicht die erwartete Geldsumme, sondern einen schweren Stein. Das hat sich bald herumgesprochen, und seitdem würde es niemand wagen, den Geist herauszufordern.“
Auch nicht übel! Meine gute Marah Durimeh verstand es offenbar vortrefflich, nicht bloß ihr Geheimnis zu wahren, sondern auch sich bei den halbwilden und darum abergläubischen Kurden die gewünschte Achtung zu verschaffen.
„Darf ich vielleicht fragen, wenn es dir nicht zudringlich erscheint, durch wen du in den Besitz der Losung gekommen bist?“, erkundigte sich der Scheik.
„Warum nicht? Ich mache vor dir kein Geheimnis daraus. Es war eine alte Frau, der ich einen großen Dienst erweisen konnte. Sie heißt Marah Durimeh.“
„Oh, die kenne ich sehr gut. Sie hat schon mehr als hundert Winter erlebt und kommt trotzdem alle Jahre einmal zu uns. Zwar ist sie eine Christin, steht aber trotzdem bei allen Kurdenstämmen in großem Ansehen. Niemand würde es wagen, ihr ein Leid zuzufügen.“
„Weißt du vielleicht, wo sie ihren eigentlichen Wohnsitz hat?“
„Nein. Sie kommt und geht, und niemand fragt sie nach dem Woher und Wohin. Neu ist mir nur, dass sie die Losung besitzt.“
Also auch hier war nichts Näheres über die geheimnisvolle Frau zu erfahren.
„Kommt es oft vor, dass dir jemand die Losung nennt?“
„Selten. Das letzte Mal war es vor drei Wochen. Ein junger Mann kam zu mir, der für die Nacht um Unterkunft bat. Er sagte, er hätte einen wichtigen Brief zu besorgen.“
„Sagte er dir nicht, an wen der Brief gerichtet sei?“
„Nein. Er erwähnte nur, dass er einen weiten Ritt bis zu den Stämmen der Dschesireh vor sich habe. Dort sei der Mann zu finden, für den der Brief bestimmt sei.“
Halef stieß mich an. Er hatte offenbar den gleichen Gedanken wie ich. Es konnte kein Zweifel sein, dass der Scheik den Boten Marah Durimehs gesprochen hatte. Und damit ließ ich allen Argwohn fallen. Der Mann sprach in allem die Wahrheit und meinte es ehrlich.
„Der Bote hat sein Ziel nicht erreicht“, erklärte ich ernst. „Er wurde ermordet.“
„Katera peghamber! Sagst du die Wahrheit?“
„Ich sage sie. Wir standen an der Leiche des Ermordeten.“
„Allah vernichte den Mörder! Aber woher weißt du, dass es der Bote war, den ich meine, und nicht ein anderer?“
„Wir fanden den Brief bei der Leiche. Er enthielt als Erkennungszeichen den Satz, den nur ein Eingeweihter wissen kann.“
„Was tatest du mit dem Schreiben? Sandtest du es weiter an den Mann, an den es gerichtet war?“
„Das war nicht nötig, denn der Brief war an mich selber geschrieben.“
„Gheine Chodeh kes nekane – Gott ist allmächtig! Das ist ein wunderbares Zusammentreffen. Herr, du musst ein Liebling des Propheten sein.“
„Dieser Brief ist die Veranlassung unserer Reise nach Kurdistan. Darum siehst du uns hier.“
„Alahhm d’Allâh – ich danke Gott dafür, denn dieser Umstand verschafft mir die Freude eures Anblicks.“
Das Benehmen des Scheiks war jetzt geradezu herzlich zu nennen. Ich freute mich darüber, und auch den Gefährten merkte ich die Genugtuung darüber an, dass sich unsere diplomatischen Beziehungen zu dem Beherrscher der Schirwani-Kurden ständig besserten. Wie sehr musste er dem ‚guten Dschinn‘ zum Dank verpflichtet sein, dass er es mit der Erfüllung der Weisung, die dieser ihm gegeben hatte, so ernst nahm!
Ich warf einen Blick auf den Nachthimmel. Dem Stand der Sterne nach musste in einer Stunde die Morgendämmerung anbrechen. Im Lager der Kurden herrschte noch immer vollkommene Ruhe. Nicht der geringste Laut drang zu uns herauf, ein Zeichen, dass die Abwesenheit des Scheiks noch nicht bemerkt worden war.
Demal Khan hatte uns nun alles über den ‚guten Dschinn‘ gesagt, was er selber wusste, und begann von dem Zug gegen die Deri zu erzählen. Das war kein Geheimnis mehr, von dem der Dumbeli nichts erfahren durfte, und ich rief ihn deshalb zurück.
Man durfte dem Scheik, was die Deri betraf, nicht alles glauben, was er erzählte; dafür war er zu sehr Partei. Aber selbst wenn die Hälfte von allem als Übertreibung anzusehen war, erhielten wir immer noch einen ungünstigen Eindruck von diesen Leuten. Nach der Schilderung des Scheiks waren sie die schlimmsten Räuber und Mörder weit und breit. Ein Menschenleben galt ihnen nichts, wenn ein Mord ihnen nur den geringsten Vorteil einbrachte, und ihr ganzes Sinnen und Trachten war darauf gerichtet, Geld und Geldeswert zusammenzuraffen. Ihre Wohnsitze lagen hart an der Grenze, und bei ihrer ganzen Einstellung war es selbstverständlich, dass sie den Schmuggel in großem Umfang betrieben. Die Schirwani standen mit ihnen seit Langem in Blutrache. Letztere hatten, wenn man dem Scheik glauben durfte, wiederholt und ohne jeden Grund mehrere Schirwani ermordet, die nach dem Urmia-See reisten oder von dorther kamen und dabei durch ihr Gebiet ziehen mussten.
Da hatte der Scheik sich entschlossen, gründlich Rache zu nehmen. Die Deri sollten eine Dijeh34 zahlen, durch die sie mit einem Schlag miteinander quitt wurden. Es wurde ein Raubzug ausgerüstet und es gelang den Schirwani tatsächlich, das erste Dorf der Deri in der Überrumpelung zu nehmen. Nachdem alles zusammengerafft worden war, was des Mitnehmens wert erschien, wurden die vorgefundenen Pferde erschossen, damit die Feinde nicht sofort in der Lage sein sollten, die Verfolgung aufzunehmen.
„Bist du nun zufriedengestellt?“, fragte ich, als der Scheik geendet hatte.
Demal Khan schmunzelte. „Ich bin es. Diese Hunde werden noch lange an uns denken.“
„Fürchtest du dich nicht vor einem Rachezug?“
„Sie sollen nur kommen! Eine Überraschung wird ihnen nicht gelingen, denn ich werde auf der Hut sein. Und in unseren Bergen, wo wir jeden Schritt und Tritt kennen, sind wir im Vorteil ihnen gegenüber.“
„Und spürst du gar keine Gewissensbisse darüber, dass du ein ganzes Dorf dem Elend preisgegeben hast?“
Der Scheik spreizte alle zehn Finger abwehrend aus. „Herr, tu mir den einen Gefallen und verschwende dein Mitleid nicht an diese Schurken! Sie verdienen es wirklich nicht, denn sie sind wie die jungen Katzen, die immer wieder auf ihre Pfoten zu stehen kommen, sie mögen stürzen, wie sie wollen.“
„Sind die Deri denn gar so geriebene Leute?“
„Malum – gewiss! Du ahnst gar nicht, welch ungeheure Werte da oben über die Grenze geschmuggelt werden.“
„Und die Behörden? Unternehmen die nichts dagegen?“
„Nichts.“
„Aber die Zollbeamten? Es gibt doch sicher welche da oben.“
„Natürlich! Es gibt welche, sowohl auf unserer wie auf der persischen Seite. Aber die stecken mit den Deri unter einer Decke.“
„Warum schickt denn die Regierung keine Soldaten hinauf?“
„Soldaten? Damit zeigst du, dass du die Verhältnisse nicht kennst, Soldaten würden am allerwenigsten ausrichten. Sie würden einfach nicht geduldet.“
„Warum nicht? Die Zollbeamten werden ja auch geduldet.“
„Du hast ganz richtig gesagt: Sie werden geduldet. Das ist aber auch alles. Und damit ist ihre ganze Tätigkeit ausgedrückt. Soldaten aber werden nicht da hinaufgeschickt werden, das würden die Regierungen nicht wagen, weder die türkische noch die persische. Denn sie wissen genau, dass sie dabei den Kürzeren ziehen würden. Oder muss ich dir erst sagen, dass die Deri nur dem Namen nach unter der Pforte und dem Schah-in-Schah stehen?“
„Ich habe davon gehört, dachte aber nicht, dass es gar so schlimm sei.“
„Es ist so schlimm, das darfst du mir glauben. Eine kleine Abteilung Soldaten würde da oben einfach aufgerieben werden. Es müsste schon ein starkes Heer geschickt werden, und selbst dann wäre der Ausgang zweifelhaft, denn die Deri haben in ihren Bergen eine fast unangreifbare Stellung.“
„Hm!“
„Wird dich deine Aufgabe da hinaufführen?“
„Nein. Ich gehe auf dem geraden Weg nach dem Urmia-See.“
„Heife – schade, möchte ich fast sagen, wenn es da oben nicht gar so gefährlich wäre zu reisen. Denn so etwas von Zerklüftung wirst du wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Es sieht aus, als ob der Scheitan mit den Bergmassen Fangball gespielt hätte.“
„Brrrrr!“
„Ja, Herr, es ist fürchterlich! Ich möchte keinem Menschen, auch meinem schlimmsten Feind nicht, den Rat geben, da hinaufzugehen. Der Scheitan geht um!“
„Was du nicht sagst! Und trotzdem hast du dich jetzt mit deinen Kriegern hinaufgewagt und bist heil und gesund zurückgekehrt.“
„O Herr, wir sind doch bloß über die Grenze ihres Gebiets gekommen, weiter nicht.“
„Wäre es denn später gar so gefährlich geworden?“
„Du sagst es. Hast du noch nie etwas von der Geisterschmiede von Kulub35 gehört?“
„Nie! Übrigens ein sonderbarer Name!“
„Noch sonderbarer ist, was da oben geschieht.“
„Der Name scheint anzudeuten, dass es nicht geheuer ist.“
„Ja. Ich weiß genau, dass diese Gegend von allen gemieden wird, sogar von den Deri, in deren Gebiet sie liegt. Kein Mensch hat dort seine Behausung aufgeschlagen, und trotzdem sind dort Leute gefunden worden. Natürlich tot, die Hälse auf den Rücken gekehrt.“
„Schauderhaft! Aber sprachst du nicht von einer Schmiede? Es muss also doch jemand dort oben wohnen.“
„Ja, das weiß ich auch nicht“, gestand er verlegen. „Ich kann nur sagen, was ich gehört habe, denn ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der in der Geisterschmiede gewesen und mit dem Leben davongekommen ist.“
„Aber warum der Name Kulub?“
„Das kann ich dir sagen. Die Natur hat dort mit einigen Bergen ein launisches Spiel getrieben. Sie verlaufen von der Spitze eigenartig geschweift nach abwärts und sehen von der Entfernung aus wie umgestülpte Herzen.“
„Seltsam!“
„Seltsam ist zu wenig. Sage lieber unheimlich! Die Gegend ist im ganzen Land im Verruf. Sie heißt im Volksmund Märdistan, das heißt Land, in dem nur starke Männer, oder sagen wir lieber gleich Helden, bestehen können. Auf der Karte wirst du diesen Namen freilich vergebens suchen.“
„Deine Schilderung könnte mich fast veranlassen, einen Abstecher da hinauf zu unternehmen. Aber wir haben leider keine Zeit.“
„Katera Chodeh – um Gotteswillen! Lass dir diesen Gedanken ja nicht beikommen! Er würde euer Verderben sein.“
„Wer sagt dir das?“, ließ sich da Halef vernehmen.
Ich hatte mich schon im Stillen gewundert, dass er während meiner ganzen Unterredung mit dem Scheik geschwiegen hatte. Aber seine letzte Bemerkung rief seinen ganzen Widerspruchsgeist wach.
„Glaubst du, wir fürchten deine Geister?“, fuhr er fort. „Wir haben während unseres ganzen Lebens nichts anderes getan als mit Geistern gekämpft.“
„Ihr – habt – mit – Geistern gekämpft?“, brachte der Scheik stockend hervor.
„Ja, mit den Quälgeistern, den Schwarmgeistern und sogar mit den Weingeistern, die die schlimmsten von allen sind“, lachte Halef. „Aber wir nehmen es auch noch mit allen anderen Geistern auf. Vor unseren Messern werden sie klein beigeben, und vor unseren Gewehren gar werden sie Reißaus nehmen.“
Ich gab Halef einen Wink zu schweigen. Ein Blick auf die Sterne hatte mich belehrt, dass es bis zum Anbruch des Morgens nicht mehr weit war. Es war Zeit, dass wir uns mit unserem Freund Lindsay befassten. Was gingen uns schließlich die Deri an! Und noch weniger kümmerte uns die Geisterschmiede von Kulub.