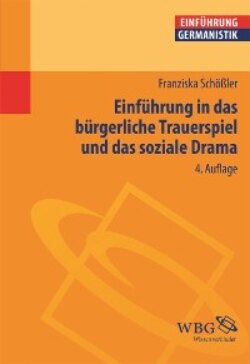Читать книгу Einführung in das bürgerliche Trauerspiel und das soziale Drama - Franziska Schößler - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kulturwissenschaftliche Ansätze
ОглавлениеDiskurspluralität
Der relativ monolithische Begriff von Gesellschaft, der den sozialgeschichtlichen Interpretationen gemeinhin zugrunde liegt, erfährt eine differenzierende Modifikation in denjenigen Ansätzen, die Gesellschaft als plurales Ensemble von Diskursen betrachten, die also, vor dem Hintergrund eines semiotischen Konzepts, auch Praktiken und kulturelle Ausdrücke, die nicht im engen Sinne als Texte zu verstehen sind (Feste z.B.), als Zeichenarrangement lesen und Tauschbeziehungen zwischen diesen Segmenten annehmen. Geschichte kann damit nicht mehr als Bewegung verstanden werden, die von Texten unabhängig ist, sondern erscheint als Raum, in dem diskontinuierliche Diskursverschiebungen stattfinden. Dieser Ansatz bringt es mit sich, dass nicht von gesellschaftlichen Tatsachen gesprochen werden kann, die ihrerseits die literarischen Texte prägen, sondern gesellschaftliche Praktiken und literarische Produkte werden gemeinsam unter dem Begriff der Kultur gebündelt, wobei sich Kultur im wesentlichen durch ihre imaginativen Konstruktionen auszeichnet.
Kultur als Imagination
Kultur produziert imaginäre Sinnzuschreibungen und bietet imaginäre Identitätskonzepte an. Vor diesem Hintergrund lässt sich das zentrale Familienkonzept der bürgerlichen Gesellschaft, das, zum Teil jedenfalls, in den bürgerlichen Trauerspielen und sozialen Dramen verhandelt wird, neu bewerten. Das Familienkonzept ist aus kulturwissenschaftlicher Perspektive nicht als „biologische Tatsache oder eine gesellschaftlich festgelegte Institution“ zu betrachten, sondern als „eine kulturelle Erfindung, die sich erst nachträglich als naturgegeben oder als gesellschaftlich notwendig ausgibt, in ihrer Konstruiertheit jedoch nicht weniger, sondern eher größere Realität gewinnt“ (Erhart 2001, 8). Ein kulturwissenschaftlicher Ansatz lässt die Geschichte des Bürgertums also als Geschichte seiner Phantasmagorien und heterogenen kulturellen Imaginationen in Erscheinung treten, die in immer neuen komplexen Prozessen ausgehandelt, etabliert und verworfen werden.
Kultur als Performanz
Denn in den kulturwissenschaftlichen Theorien wird gemeinhin davon ausgegangen, dass Kultur kein essentialistischer, statischer Begriff ist, sondern dass kulturelle Repräsentationen in permanenten Aushandlungsprozessen performativ, also durch Handlungen, bestimmt werden und in einem Feld von Machtinteressen situiert sind; kulturelle Äußerungen entstehen relational, d.h. durch Abgrenzungsmechanismen (Bourdieu). Die grundlegende Tendenz, die sich für die kulturwissenschaftlichen Positionen aus historischer Perspektive abzeichnet, führt von einer marxistisch ausgerichteten Theorie hegemonialer Kultur (Gramsci) in den 1950er Jahren (Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies) zu pluralistischen Konzepten, die ein komplexes Gewebe von Subkulturen und Kulturen annehmen und den Tauschbewegungen sowie den Hybridisierungstendenzen, d.h. den Übernahmen diverser Ausdrucksmuster, nachgehen. In diesem Zusammenhang ist das Interesse an Alterität, das in den Gender Studies und den Postcolonial Studies herrscht (Edward Said, Homi K. Bhabha), ebenso zu sehen wie das Interesse an Populärkultur, z.B. an Mainstream-Filmen (Fauser 2003, 32f.).
Foucault
Ausgangspunkt einiger kulturwissenschaftlicher Ansätze sind die Arbeiten von Foucault, der Diskurse als Medien begreift, die definieren, was als wahr/falsch und als normal/wahnsinnig gilt; Diskurse entscheiden über das Sagbare/Unsagbare. Die Genese des Bürgertums um 1800 ließe sich vor diesem Hintergrund als Machtkampf um Aussageweisen beschreiben, die ihrerseits Normalisierungs- und Normierungsprozesse in Gang setzen. Die sich verwissenschaftlichenden Diskurse wie Bildung, Medizin, Ökonomie etc. arbeiten gemeinsam an der Formierung des (bürgerlichen) Menschen, an seiner reglementierenden „Entdeckung“, und zwar jenseits eines zentralisierenden Staatsorgans. Literatur kann in diesem Kontext zum einen als Verweigerung verstanden werden, als Gegendiskurs (Geisenhanslüke 2003, 126f.), zum anderen jedoch auch als Kollaborateurin. Auch die literarischen Texte sind an der Vermessung und Etablierung von Diskursen beteiligt.
Die Konstruktion weiblicher Psychen
So arbeiten die bürgerlichen Trauerspiele an der ‘Entdeckung des Gefühls’, an der Konstruktion von kontrollierbaren emotionalen Innenwelten. Die literarischen Texte unterstützen die Grenzziehungen des Sagbaren, wie insbesondere die Debatte um den Kindsmord verdeutlicht, ein zentrales Sujet auch der bürgerlichen Trauerspiele. Vor dem Hintergrund der Diskursanalyse kann nachgewiesen werden, dass Literatur, und dazu ist insbesondere das Drama als eine Form kollektiv rezipierter Kunst zu rechnen, und Wissenschaft um 1800 gemeinsam an der kommunikativen Konstruktion einer weiblichen Psyche arbeiten, die auf das System Ehre festgelegt, mithin zugleich produziert und domestiziert wird; dem Motiv des Kindsmords, das u.a. bei Goethe (Faust I) und Wagner (Die Kindermörderin) behandelt wird, kommt in diesem Prozess eine zentrale Funktion zu (Neumeyer 2002, 62). Die Gattung des bürgerlichen Trauerspiels ist also maßgeblich an den Produktions- und Domestikationsverfahren weiblicher Psychen beteiligt. Aus diskursanalytischer Perspektive können darüber hinaus einschlägige Dramentheorien neu bewertet werden.
Theater und Subjektgenese
So lässt sich z.B. Diderots Theaterkonzept im Kontext der bürgerlichen Subjektgenese neu lesen (Lehmann 2000), indem untersucht wird, welche Funktion dem innovativen Zuschauerverständnis des französischen Aufklärers für die „Entdeckung des Menschen“ zukommt, d.h. wie Diderots Konzept des Visuellen innerhalb der Normalisierungs- und Disziplinierungsprozesse des bürgerlichen Subjekts zu verorten ist. Lehmann weist nach, dass die Vierte Wand Diderots, die den Beobachter scheinbar verschwinden lässt und damit die Unverstelltheit emotionaler Äußerungen verspricht, zugleich fremde, unzugängliche Innenräume generiert. Der omnipräsente Blick, den die Vierte Wand ermöglicht, lässt die Körper der Figuren opak und zu Zeichenträgern werden, die der Zuschauer zu dechiffrieren hat. „Erst mit der Konstruktion der Vierten Wand als Totalisierung eines anonymen, von überall her kommenden Blicks entsteht eine Schauspielweise, die den ganzen Schauspieler mit seinem Körper aufs Spiel setzt. […] Der Bühnenraum ist so bereits Ausdrucksraum, die räumlichen Positionen der Figuren und die aus ihnen fließenden Relationen werden bereits vom Beobachter als Bedeutung synthetisiert.“ (Lehmann 2000, 101f.) Die Erfindung des Zuschauers, die Diderots Theaterkonzept leistet, ist, so ließe sich die Grundaussage von Lehmanns Studie summieren, die Erfindung seiner Gespaltenheit und bringt die Konstitution eines semiotisierten (Theater-)Raumes mit sich.
New Historicism
Ein weiterer Ansatz, der auf Foucault zurückgeht und gleichzeitig die Nähe zu sozialgeschichtlichen Konzepten deutlich werden lässt, ist der New Historicism, der vor allem mit dem Namen Stephen Greenblatt verbunden ist (Geisenhanslüke 2003, 131f.). In seinen Arbeiten wird der literarische Text „auf das kulturelle Feld [zurückbezogen], das ihn hervorgebracht und auf das er sich in seiner spezifischen Form funktional bezogen hat“ (Kaes 1990, 58). Dieser Rückbezug des Textes soll „die sozialen Kräfte sichtbar machen, die durch die Überlieferung und allmähliche Isolierung des Textes von seinem Ursprung verloren gegangen waren“ (Kaes 1990, 58). Dem New Historicism ist also an einer Rekontextualisierung des literarischen Werkes gelegen, wobei, anders als in dem Text-Kontext-Konzept Isers, ein „‘Archiv’ aus komplexen und diskontinuierlichen Diskursen“ und damit „ein ganz anderes Kulturmodell als der einheitliche ‘Erwartungshorizont’“ vorausgesetzt wird, der dem Iserschen Ansatz zugrunde liegt (Baßler 1995, 22). Das literarische Werk partizipiert an diesem Archiv; es kommt zu „Verhandlungen“, zu komplexen Übernahmen und Tauschbewegungen, wobei sich der literarische Text affirmativ oder aber subversiv zu den anderen (Macht-)Diskursen verhalten kann. Der New Historicism versucht also, „literarische Werke wieder zu den historischen sozialen Bedingungen ihrer Entstehungszeit in Beziehung zu setzen“ (Wechsel 1996, 455) und liest diese grundsätzlich als Machtgeschichte.
Kontextualisierung
Für die hier in Frage stehenden Gattungen würde dieser Ansatz bedeuten, dass einzelne Themen, ja sogar einzelne Begriffe, auf den breiteren Diskurs der Zeit zurückbezogen werden, dass z.B. die Bildungsdebatte aus Lenz’ Drama Der Hofmeister in den pädagogischen Diskurs der Zeit eingebettet wird, dass die Kastration des Protagonisten vor dem Hintergrund der medizinischen Schriften der Zeit bewertet wird, wie bereits unternommen wurde (Kagel 1994, 82f.; Becker-Cantarino 1987, 53), dass der Kindsmord in den literarischen Texten auf die grassierenden juristischen wie kulturellen Debatten bezogen wird, wie sie in Preisschriften dokumentiert sind. Auch für die sozialen Dramen Hauptmanns z.B. liegt ein solcher Rückbezug auf die kulturellen wie wissenschaftlichen Archive der Zeit nahe, denn der Naturalismus versteht sich ausdrücklich als eine Kunst, die sich eng an naturwissenschaftliche Erkenntnisse anlehnt und diese rezipiert. Dazu gehört die Milieutheorie Taines und Darwins Evolutionstheorie ebenso wie die neue Wissenschaft der Physiologie und die Debatten über Vererbung und Alkoholismus. Diagnostiziert werden können komplexe Tauschbewegungen zwischen den zeitgenössischen Diskursen und den sozialen Dramen. Stehen diese „Verhandlungen“ im Vordergrund der Analyse, so wird der literarische Text ebenfalls nicht als Sozialreport verstanden, insbesondere wenn seinem affirmativen wie subversiven Bezug zu diesen Diskursen nachgegangen wird.
Subversion und Affirmation
Greenblatt ist dabei insbesondere an den scheinbar paradoxalen Überschneidungen von Subversion und Affirmation gelegen: Vielfach produziert gerade die Sicherung von Macht ihre eigene Aushöhlung. Dieser Ansatz ist für die hier zur Diskussion stehenden Gattungen in besonderem Maße ergiebig, weil Dramen, die gesellschaftlichen Minoritäten einen pathetischen Ausdrucksraum zu eröffnen versuchen, ganz wesentlich auf die gesellschaftlichen Legitimations-, Selbstbehauptungs- und Ausgrenzungsstrategien bezogen sind, die die (bürgerlichen) Diskurse auszeichnen. Und diese Dramen weisen grundsätzlich diejenige Überlagerung von Kritik und Bestätigung (von Macht) auf, die Greenblatt beschreibt. Wird der Ausschluss von Minoritäten aus kulturellen Repräsentationssystemen angeprangert und aufgehoben, so wird damit zugleich die eigene Identität (als Autor, als Klasse) konstituiert und eine Form der (Selbst-)Darstellung etabliert, die die Sprechenden an Machtsystemen partizipieren lässt. Subversive Aussprache bedeutet also zugleich Affirmation, eine Überlagerung, wie sie Greenblatt für die Physiognomie der Macht generell annimmt. So erheben die Autoren der naturalistischen Stücke zwar das Proletariat programmatisch zu ihrem Sujet, um sich von der herrschenden ästhetischen Norm abzusetzen und die Unterschicht tragikfähig zu machen. Zugleich jedoch sind ihren Texten die Berührungsängste mit eben dieser Schicht eingeschrieben, so dass die Grenzziehung zwischen den Klassen trotz dieses subversiven Programms affirmiert wird.
Kultur als Dramensujet
Die Funktion und Bedeutung von Kultur wird dabei in den vorgestellten Dramen meist auch immanent verhandelt. In den bürgerlichen Trauerspielen werden des Öfteren Figuren gezeigt, die lesen, ja dem im 18. Jahrhundert notorischen Leserausch verfallen und damit zum Opfer der Melancholie werden. Luise, Ferdinand, Evchen, sie alle sind Lesende, die durch ihre Lektüre mit den neuen Empfindsamkeitsprogrammen vertraut gemacht werden und deshalb mit der Welt zerfallen. Dem Schrifttum wird so zum einen ein immanentes Denkmal gesetzt; seine Relevanz wird im Kontext der (bürgerlichen) Identitätsbildung betont, nicht ohne dass jedoch zum anderen, ähnlich wie in den populärwissenschaftlichen Texten der Zeit, auf die Gefahren dieser Lektüre verwiesen wird. Die ideell-kulturelle Formation des Bürgertums zeigt sich also als problematische; dem Programm sind seine Labilitäten eingeschrieben.
Unternehmen kulturwissenschaftliche Studien vielfach auch Alteritätsforschung, geht es in diesen Untersuchungen u.a. um die Konstruktion von Alterität, um den Umgang mit dem Fremden, so wird diese Tendenz in den Gender Studies fortgeführt. Die Minorität, die aus dieser Perspektive in den bürgerlichen Dramen ins Zentrum rückt, ist die Gruppe der Töchter und Mütter, sind die Frauen, die in den bürgerlichen Trauerspielen geradezu einem „Massensterben“ (Weigel 1988, 141) ausgeliefert sind.