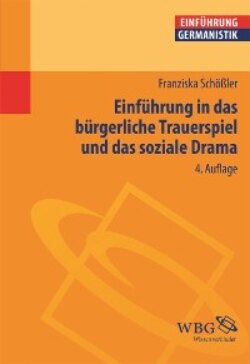Читать книгу Einführung in das bürgerliche Trauerspiel und das soziale Drama - Franziska Schößler - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Sozialgeschichtliche Ansätze
ОглавлениеWechselwirkungen
Grundlegend für diese Konzepte ist „die Annahme von Wechselwirkungen zwischen Literatur und Geschichte, zwischen (literarischem) Text und (sozialem) Kontext“ (Wechsel 1996, 447). Allerdings gibt diese Vorstellung einer „Wechselwirkung“ zwischen Kunst und Gesellschaft in theoretischer Hinsicht einige Probleme auf; zu entscheiden ist beispielsweise, welcher Begriff von Gesellschaft zugrunde gelegt wird. Meist wird Gesellschaft als institutionell verfasstes System definiert; zentral für die sozialgeschichtliche Literaturinterpretation ist die Berücksichtigung von institutionellen Bedingungen der Literatur, wie sie beispielsweise auch die empirische Literatursoziologie untersucht.
Distributions- und Produktionsbedingungen
Sozialgeschichtlich ausgerichtete Literaturgeschichten behandeln also immer auch die Produktions- und Distributionsbedingungen von literarischen Texten, weil diesen Faktoren eine grundlegende Funktion innerhalb des ästhetischen Prozesses zugeschrieben wird: Nicht zuletzt das Publikum, die Verlage sowie die Herstellungsbedingungen entscheiden darüber, was und wie geschrieben wird. Grimmingers mehrbändige Sozialgeschichte ist entsprechend zweiteilig an gelegt: „Einleitende Teile behandeln politische, ökonomische und gesellschaftliche Verhältnisse, soziale Mentalität und literarische Kultur einer Epoche in ihrem Zusammenhang. Die Institutionen der Öffentlichkeit – so der literarische Markt, die Bildungsinstitutionen und Medien – spielen dabei eine besondere Rolle. Sie sind der Literatur nicht äußerlich, sondern prägen ihre Qualität und ihren Umfang sowie die Art ihrer Rezeption in jeder Epoche entscheidend.“ (Grimminger 1980, 8; zu Toller und den neuen Medien vgl. Landgren 2013) Erst im Anschluss an diese Informationen folgen Aufsätze zu einzelnen Gattungen und Autoren. So geht den Ausführungen über das bürgerliche Trauerspiel ein Kapitel über die Geschichte der Institution Theater voraus, das den Wandel von der Wanderbühne zum Hof- und Nationaltheater beschreibt (Meyer 1980), d.h. die Aufwertung des Theaters zu einer regelmäßigen Schaubühne mit didaktischem Anspruch.
Die Institution Theater
Diese Nobilitierung des (bürgerlichen) Theaters, seine Funktion als Erziehungsinstanz sowie die Errichtung fester Bühnen stehen in engem Zusammenhang mit der Genese des bürgerlichen Dramas. Das Theater, ein ‘öffentliches’ Ritual, wird als eine Art Gegenöffentlichkeit zum höfischen Milieu verstanden und muss deshalb aufgewertet werden. Die Bühne fungiert als „Öffentlichkeitsersatz“, wie u.a. in dem Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe deutlich wird (Habermas 1962, 27). Die Institution Theater stellt also eine wesentliche Rahmenbedingung für die dramatische Produktion dar. Wird Literatur als institutionell verankerte Ausdrucksform betrachtet, so können im übertragenen Sinne auch Gattungen als „literarisch-soziale Institutionen“ gelten, die sich zwischen Institutionalisierung und Entinstitutionalisierung bewegen (Voßkamp 1977, 30).
Die Institution Gattung
Literarische Gattungen regeln diejenigen Selektionsstrukturen, die Text- und Lesererwartungen in entscheidendem Maße prägen; auch die Rezeption von Texten wird institutionell geleitet. Grimminger hält im Vorwort seiner Sozialgeschichte fest: „Gattungen sind keine ‘Naturformen’ der Literatur, sondern sozialgeschichtlich labile Konventionen literarischer Verständigung über eine problematische Lebenswirklichkeit, motiviert durch geregelte Erwartungen des Publikums an literarische Verständigungsakte und durch das Selbstbewußtsein der Autoren.“ (Grimminger 1980, 11)
Ökonomie als Fundament
Berücksichtigt die Sozialgeschichte vornehmlich die institutionellen Rahmenbedingungen von Kunst, so liegt diesem Fokus eine zentrale Prämisse zugrunde: Es wird davon ausgegangen, dass gesellschaftliche Prozesse in ganz fundamentaler Weise von ökonomischen Interessen dominiert werden; der sozialgeschichtliche Ansatz geht den komplexen Interferenzen zwischen „Marktentwicklung und Ideologiegeschichte“ nach (Schulte-Sasse 1980, 465). So wird das bürgerliche Gleichheitspostulat als ideologisches Pendant des kapitalistischen Tauschaktes verstanden, und das intime bürgerliche Leben, das sich von Marktverhältnissen unabhängig dünkt, als „tief in den Bedürfnissen des Marktes verstrickt“ (Habermas 1962, 74). Die sozialgeschichtlichen Untersuchungen zum Drama und spezifischer zum bürgerlichen Trauerspiel profilieren entsprechend die ökonomischen Aspekte dieser bürgerlichen Ausdrucksformen sowie des Begriffes „bürgerlich“ überhaupt. Schulte-Sasse liest diesen Terminus in seinen Ausführungen über die Frühaufklärung nicht nur als Bezeichnung für den dritten Stand, sondern der Begriff verweise „auf ein wirtschaftliches Interesse an der Entwicklung von Handel und Manufakturwesen“ (Schulte-Sasse 1980, 426). Die bürgerliche Forderung nach einer moralischen Erziehung, wie sie die literarischen Werke der Zeit zum Ausdruck bringen, führt Schulte-Sasse auf die „veränderten, komplexer gewordenen Marktverhältnisse“ zurück (1980, 426). Denn die Vertragsabschlüsse, das Fundament ökonomischer Transaktionen, bedürfen nicht nur ihrer juristischen Absicherung, können nicht nur zwischen rechtlich gleichgestellten Partnern abgeschlossen werden – einer der ökonomischen Aspekte des bürgerlichen Gleichheitspostulats –, sondern verlangen zusätzlich eine moralische Sicherung. Die moralischen Tugenden, die die literarischen Werke propagieren, sind zugleich ökonomische. Dieser „öffentlichen Einübung ökonomisch zweckgerichteter Tugenden dient auch die Aufführung moralischer Schauspiele“ (Schulte-Sasse 1980, 428).
Talcott Parsons
Werden die gesellschaftlichen Prozesse in sozialgeschichtlichen Darstellungen unter dem Primat des Ökonomischen bewertet, so ist der Versuch unternommen worden, dieses recht monolithische Gesellschaftskonzept zu differenzieren. Das Münchner Forschungsprojekt zur Sozialgeschichte der Literatur, das eine interdisziplinäre Vernetzung von Literatur-, Geschichts- und Sozialwissenschaften anstrebt, legt den Ansatz von Talcott Parsons zugrunde (von Heydebrand, Pfau, Schönert 1988), der Gesellschaft in diverse (Sub-)Systeme aufgliedert. Wirklichkeit bedürfe bestimmter Selektionen, um überhaupt als intersubjektive erfahrbar zu werden und gemeinsames Handeln zu ermöglichen. Diese Selektionen werden über Systeme institutionalisiert, die sich im Verlauf der Gesellschaftsentwicklung vervielfältigen und ausdifferenzieren. Parsons setzt vier Subsysteme voneinander ab, nämlich Ökonomie, Politik, gesellschaftliche Gemeinschaft und Sozialkultur. „Das Sozialsystem Literatur stellt in diesem Modell ein Subsystem des Subsystems Sozialkultur dar. Als Sozialsystem verstanden, wird Literatur nun nicht mehr auf den Text als ästhetisches Gebilde beschränkt. Dieser geht indessen aus sozialen Handlungen hervor, für die er zugleich auch Ausgangspunkt ist.“ (Wechsel 1996, 452) Die Systeme sind untereinander vernetzt und zeichnen sich durch Tauschbewegungen aus. Sozialer Wandel, der z.B. auch die Genese und Modifikation von Gattungen mit sich bringt, wird als Prozess der Ausdifferenzierung von Systemen verstanden.
Ausdifferenzierung der Systeme
Es liegt auf der Hand, dass dieses Gesellschaftskonzept insbesondere für das 18. Jahrhundert herangezogen werden kann, da in dieser historischen Phase eine stratifikatorische, in Schichten organisierte Gesellschaft einer funktional ausdifferenzierten weicht; die gesellschaftliche Umstrukturierung führt „zu deutlichen Grenzverschiebungen im semantischen Gelände, das jetzt nach Maßgabe moderner Subsysteme und Mediencodes neu vermessen und verteilt wird“ (Schwanitz 1996, 276f.). Entsprechend artikulieren die bürgerlichen Trauerspiele Friktionen zwischen den diversen ausdifferenzierten gesellschaftlichen Subsystemen, z.B. zwischen orthodoxer Religion und dem empfindsamen Familienethos wie in Schillers Kabale und Liebe und bereits in Miß Sara Sampson – hier gehen Anthropologie und Theologie eine „provokante Symbiose ein“ (Fick 2000, 127).
Kritik am Theorem der Widerspiegelung
Jenseits der Frage, wie Gesellschaft zu definieren sei, ist für den sozialgeschichtlichen Ansatz ein zweiter Aspekt zu klären, nämlich die Frage, in welchem Verhältnis Gesellschaft und Literatur stehen. Diese Relation wird, wie angedeutet, gemeinhin als Wechselwirkung, als doppelte Bewegung, beschrieben: Literatur bildet nicht nur, so die ältere Version, soziale Verhältnisse ab (im Sinne einer Widerspiegelungstheorie), sondern beeinflusst ihrerseits diese Kontexte. Allerdings wird die Annahme eines mimetischen Verhältnisses zur Wirklichkeit vielfach abgelehnt, denn Literatur sei nicht im Sinne eines planen Sozialreports mit den gesellschaftlichen Verhältnissen identisch; bereits die Selektionen, die in einem literarischen Text notwendigerweise unternommen werden, verhindern, dass der Text zu einem Abbild sozialer Zustände wird. Grimminger hält fest: „[L]iterarische Texte [sind] nie schlechterdings damit [mit den historisch bestehenden Möglichkeiten des Bewusstseins und Handelns in der Gesellschaft; Anm. v. Verf.] identisch, und gerade die ‘hohe’ Literatur weicht wegen ihrer ästhetisch und philosophisch besonderen Qualität sowohl von den Bestimmungen sozialer Praxis als auch vom Bewußtsein, das dieser zugeordnet zu sein pflegt, meist erheblich ab. […] Die Sozialgeschichte der deutschen Literatur verfolgt das Ziel, Literaturgeschichte gerade in ihrer mehrdeutigen Beziehung zur historischen Lebenspraxis zu erschließen.“ (Grimminger 1980, 7) Literatur soll trotz ihrer Bezugnahme auf gesellschaftliche Realitäten als genuines Artefakt wahrnehmbar bleiben, auch deshalb, weil allein diese Differenz das ästhetische Werk zum kritischen Instrumentarium werden lässt, um gesellschaftliche Entfremdungszusammenhänge sichtbar zu machen (Grimminger 1980, 8).
Rezeptionsästhetik
Um den problematischen Bezug zwischen literarischem Werk und gesellschaftlichen Kontexten zu präzisieren, könnte der rezeptionsästhetische Ansatz von Wolfgang Iser herangezogen werden, mit dem einige der sozialgeschichtlichen Untersuchungen operieren (Saße 1996). Iser versucht, den Konnex zwischen literarischem Text und seinem „außertextuellen“ Bezugsrahmen – ein Begriff des Prager Strukturalismus – zu klären, also das Phänomen zu beschreiben, dass sich Literatur auf außerliterarische Sachverhalte bezieht, doch die „vielen außertextuellen Bezugnahmen vom Text selbst wiederum nicht so gemeint sind, wie sie in ihrer textunabhängigen Gegebenheit erscheinen“ (Iser 1975, 280). In Akte des Fingierens. Oder: Was ist das Fiktive im fiktionalen Text? entwickelt Iser ein Transgressionssystem mit verklammernden Abstufungen, das zum einen die Differenz zwischen poetischem Werk und außerästhetischen Wirklichkeiten, Lebenswelten, wie er es nennt, erklärt, zum anderen dem Analogie-Prinzip zwischen Wirklichkeit und Poesie Rechnung trägt. Das Werk, so Iser, nehme zum einen auf außerästhetische Wirklichkeitssysteme Bezug, indem der Text „als Schnittpunkt der Schemata konstituiert [wird], die den verschiedensten Diskursen aus der Textumwelt entnommen“ sind (Iser 1983, 132). Es werden mithin Elemente einer „identifizierbare[n] soziale[n] Wirklichkeit“ (Iser 1983, 122) in das literarische Œuvre eingearbeitet. Zugleich wird der Text von den Wirklichkeitssystemen durch bestimmte Akte der Selektion, der Kombination und der „Entblößung“ abgelöst – dieser Begriff bezeichnet nach Iser den autoreferentiellen Aspekt fiktiver Texte (Iser, 1983, 136). Das literarische Werk zeichne sich durch sein Vermögen aus, Realität oder auch Diskurse scheinbar zu verdoppeln und doch zugleich Differenzen zur Ursprungssphäre, zum referenziellen Gegenstand, herzustellen, und zwar durch die Akte der Selektion und Kombination. Diese Strategien suspendieren die unmittelbare Referenzialität des Materials, führen zu einer Überschreitung der aufgenommenen Wirklichkeitselemente, zu ihrer „Dekomposition“, wie Iser es nennt. Saße, der eine sozialgeschichtliche Studie zum Drama des 18. Jahrhunderts vorlegt und sich an Isers rezeptionsästhetischem Ansatz orientiert, beschreibt diesen Vorgang als mimetische Reflexion des Kunstwerks: „Vor die Ordnungszusammenhänge der Lebenswelt schiebt sich die ästhetische Ordnung eines Werks, das mit Hilfe von Partikeln der außerästhetischen Umwelt einen Sinnzusammenhang formiert, der die Realitätsmomente durch die Einordnung in einen fiktionalen Kosmos von ihren gesellschaftlich eingespielten Bedeutungen löst und der Kritik aussetzt.
Mimetische Reflexion
[…] durch die Transformation des Historisch-Faktischen in ein Ästhetisch-Fiktionales [kann] ein Bedeutungsraum entstehen, der in seiner semantischen Differenz zu den aufgerufenen Bezugssystemen deren Problemüberhang erfahrbar macht, ohne dies diskursiv auszusprechen.“ (Saße 1996, 66) Profiliert wird also der gesellschaftliche Bezug der Literatur, ohne die Spezifik des ästhetischen Mediums zu nivellieren. In Saßes Untersuchung wird auf diese Weise deutlich gemacht, dass die problematischen Bindungen, die in den Dramen des 18. Jahrhunderts vorgeführt werden, zum einen das neu entstehende Konzept der Liebesehe dokumentieren, zugleich jedoch die Paradoxien und Brüche dieser Vorstellung sichtbar werden lassen, mithin als kritische Kommentare fungieren.
Bezüge zu gesellschaftlichen Realien
Für die sozialen Dramen, die im 19. Jahrhundert entstehen, allem voran für die naturalistischen Stücke, liegt die Bedeutung von gesellschaftlichen Realien, von sozialen Phänomenen, auf der Hand. Im Naturalismus wird das ästhetische Programm einer ‘realistischen’ Literatur entwickelt, die sich an spezifischen Milieus, an Alltagserlebnissen und Alltagssprache orientiert. „Die realistische Avantgarde will den unmittelbaren Kontakt zum Leben, zur Realität des Alltags, herstellen und Anstöße zur Gestaltung dieser Wirklichkeit geben. Im Zeichen der Einbindung der Literatur in den sozialen, soziokulturellen Kontext der Epoche erfolgt die Absage an den Kult des vom Leben losgelösten, einsamen Genies.“ (Meyer 2000, 64) Die naturalistischen Dramen werden entsprechend meist im Kontext der industriellen Revolution, der Proletarisierung von Bevölkerungsschichten, der sozialen Misere in großen Bereichen des Kleinbürgertums etc. situiert und interpretiert.