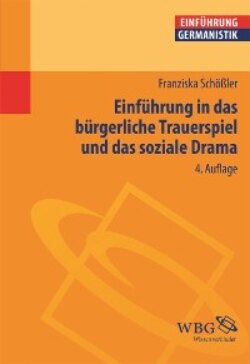Читать книгу Einführung in das bürgerliche Trauerspiel und das soziale Drama - Franziska Schößler - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Gender Studies
ОглавлениеDie Neuordnung der Geschlechter
Der feministische Ansatz (Schößler 2008, 11f.) ist für die Analyse von bürgerlichen Trauerspielen, aber auch von sozialen Familiendramen deshalb so aufschlussreich, weil er sozialhistorisches Material an die Hand gibt, das die Figurenkonstellationen in den Dramen in ein neues Licht rückt. Um 1800, so lässt eine Vielzahl von sozialgeschichtlichen und historischen Studien deutlich werden, wird die (bürgerliche) Geschlechterordnung neu formiert, und zwar in einer Weise, die bis in die Gegenwart hinein Gültigkeit besitzt. Karin Hausen hält über diese Umstrukturierung des Geschlechterdiskurses in einem einschlägigen Aufsatz fest: Seit „dem ausgehenden 18. Jahrhundert treten an die Stelle der Standesdefinitionen Charakterdefinitionen [Geschlechtscharaktere]. Damit aber wird ein partikulares durch ein universales Zuordnungsprinzip ersetzt: statt des Hausvaters und der Hausmutter wird jetzt das gesamte männliche und weibliche Geschlecht und statt der aus dem Hausstand abgeleiteten Pflichten werden jetzt allgemeine Eigenschaften der Personen angesprochen. Es liegt nahe, diesen Wechsel des Bezugssystems als historisch signifikantes Phänomen zu interpretieren, zumal der Wechsel mit einer Reihe anderer Entwicklungen korrespondiert.“ (Hausen 1976, 370f.) Ein polares Definitionsprinzip des (bürgerlichen) Menschen, nämlich Weiblichkeit und Männlichkeit, tritt an die Stelle des Schichtsystems der Gesellschaft.
Geschlechtscharaktere
Diese Binarisierung, die sich daraus ergibt, dass Männlichkeit und Weiblichkeit als fundamentale Wesensmerkmale etabliert werden, ist ganz wesentlich mit der Biologisierung von Geschlecht verbunden. Geschlecht ergibt sich nicht aus sozialem Handeln, wird nicht als gesellschaftliche Rolle bestimmt, sondern wird durch die psychische wie physische Ausstattung des Menschen festgelegt; Anatomie wird, um mit Freud zu sprechen, zum Schicksal.
Biologie als Schicksal
Um 1800 wird das Ein-Geschlecht-Modell, das seit der Antike Gültigkeit besitzt, durch ein Zwei-Geschlechter-Modell abgelöst. Thomas Laqueur weist in seiner Untersuchung entsprechend auf die Historizität dieses Zwei-Geschlechter-Modells hin und damit auf die Konstruktions- wie Selektionsaspekte der Anthropologie, die um 1800 die unhintergehbare Naturalisierung der Geschlechtscharaktere vorantreibt und das bis dahin propagierte Ein-Geschlecht-Modell verabschiedet (1992). Die Konsequenzen dieser Wissenschaft untersucht auch Claudia Honegger; sie geht in ihrer Studie Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaft vom Menschen und das Weib 1750–1850 (1991) davon aus, dass die „Entdeckung des Menschen“ seit Mitte des 18. Jahrhunderts, d.h. seine Konstitution durch Wissenschaften wie Anthropologie und Medizin, aber auch Literatur und Bildung, auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird. Denn der Kollektivsingular „der Mensch“, den das Aufklärungsethos im Zuge des Gleichheitspostulats entwickelt, meint ausschließlich den Mann; Frauen hingegen werden über die sich gleichzeitig vollziehende Biologisierung, d.h. Ontologisierung der Geschlechterdifferenz, aus der Sphäre des ‘Menschen’ ausgegrenzt.
Vereinnahmungen des Weiblichen
Mit dieser Biologisierung und Universalisierung der Kategorien Männlichkeit und Weiblichkeit, die die Ständehierarchie ablösen, geht eine Vereinnahmung des Weiblichen einher, wie die zahlreichen Männerphantasien über Frauen in literarischen und wissenschaftlichen Texten um 1800 deutlich werden lassen (Weigel 1990, 50f.). Allerdings zeigt sich diese Projektionsstruktur bereits in früheren Texten, auch z.B. in den bürgerlichen Dramen der Aufklärung. So wird in Emilia Galotti eine unschuldig-reine junge Frau ins Zentrum gestellt, die den bloßen Gedanken an Verführung nicht überlebt und von Beginn des Dramas an buchstäblich als Bild, als screen, als Projektionsfläche männlicher Wünsche fungiert. Emilia ist die unbefleckte Jungfrau, die jedoch immer schon auf die Kehrseite dieses Weiblichkeitsentwurfes bezogen ist, auf die Hure; diesem Schicksal glaubt sie nur durch ihren Tod entgehen zu können. Darüber hinaus wird die Mutter in den bürgerlichen Trauerspielen meist im Sinne der vetula-Tradition, die die ältere Frau als degoutante Vettel darstellt, als unmoralische, unzuverlässige Kupplerin gezeichnet, die ihre Pflichten als Hausmutter versäumt und das intime Spiel zwischen Vater und Tochter stört. Die grundsätzliche Vereinnahmung des Weiblichen, von der Weigel spricht, lässt sich an diesen (stereotypen) Zuschreibungen ablesen, die die literarischen Weiblichkeitsrepräsentationen prägen; sie zeigt sich an den verbindlichen Frauenbildern, die mit großer Systematik in Szene gesetzt werden und so ihren phantasmatischen Charakter preisgeben.
Projektionsverfahren
Allerdings wird in den heutigen Gender Studies die Frauenbildforschung, für die in Deutschland u.a. die Studie von Silvia Bovenschen einschlägig ist (1979), nicht mehr in gleichem Maße betrieben wie in den 1970er Jahren; die Diagnose binär organisierter Weiblichkeitsrepräsentationen (Hure/Heilige, Mutter/Prostituierte) hat sich erschöpft. In den Gender Studies geht es hingegen um die Konstruktionsmechanismen von Geschlecht selbst, um die Analyse von komplexen Projektions- und Konstruktionsverfahren, die Weiblichkeit und Männlichkeit herstellen. Ein zentrales Untersuchungsfeld sind z.B. die Ausgrenzungsverfahren des Unheimlichen aus dem männlichen Identitätsdiskurs. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Frauen gemeinhin aus sozialgesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen sind; dieser ‘Unsichtbarkeit’ steht jedoch eine Fülle von Weiblichkeitsrepräsentationen gegenüber, die in kulturellen Produkten beschworen werden (Klinger 1985). Weiblichkeit erscheint damit als Fiktion; die Ansätze, die bestimmten Weiblichkeitsmustern nachgehen, beschäftigen sich also „immer schon mit ästhetischen Theorien über das Fiktive und Imaginäre, über die Funktion und Macht von Diskursen sowie über die Differenz zwischen Ästhetik und Lebenswelt“ (Erhart, Herrmann 1996, 502). Für das Abspaltungs- und Transformationsverfahren, das diese imaginäre Kulturarbeit auszeichnet, ist vor allem das Motiv der ‘schönen Leiche’ zentral, das auch für das bürgerliche Trauerspiel von großer Wichtigkeit ist.
Das Motiv der schönen Leiche
Denn meist ist es eine junge Frau, die auf dem Kampfplatz der Tragödie zurückbleibt; für sie entpuppen sich die gesellschaftlichen Antagonismen als tödlich, und an ihr, so legt die Theorie nahe, lässt sich eine der fundamentalen Störungen der gesellschaftlichen Ordnung, der Tod, verhandeln. Denn der Mechanismus, der das Motiv der schönen Leiche so attraktiv werden lässt, ist folgendermaßen vorzustellen: Die männliche Sterblichkeit wird auf das Andere, auf die Frau, projiziert, die damit zur todbringenden femme fatale wird, wie Christa Rohde-Dachser in ihrer einschlägigen Studie Expedition in den dunklen Kontinent. Weiblichkeit im Diskurs der Psychoanalyse beschreibt (1991). Das Zufällige der kreatürlichen Existenz, Geburt und Tod, wird auf das Weibliche verschoben und damit aus der symbolischen Ordnung ausgegrenzt. Die Frau repräsentiert diejenigen Erfahrungen, über die der Mann nicht verfügt, also Geburt und Tod; als ausgegrenzte Phänomene, als Stigma der Frau, lassen sich diese gleichwohl betrachten, jedoch als Anderes, als Fremdes. Elisabeth Bronfen führt in ihrer Untersuchung Nur über ihre Leiche, die diese kulturstiftende Bewegung an einer Vielzahl von Kunstwerken nachweist, aus: Das „weibliche Andere als ‘Schoß-Grab-Heimat’ ist auf ambivalente Weise ein Ort des Todes. Es ist jener Ort, aus dem Leben als Antithese zum Tod hervorgeht, wie es auch jener Ort ist, der die tödliche Einschrift des Körpers bei der Geburt erzeugt: das Mal des Nabels“ (Bronfen 1994, 94).
Abspaltungen
Entsprechend „fungieren Mutter und Geliebte als Allegorie für die Sterblichkeit des Mannes, als feststehendes Bild menschlichen Schicksals“ (Bronfen 1994, 101). Die kreatürliche Angst des Mannes wird auf das Weibliche verschoben, abgespalten und zugleich ästhetisiert. Das eigentliche Thema der Kunst sei, so Bronfen, der tote Frauenkörper oder auch die schöne Frau, denn Schönheit könne als Deckbild des Todes fungieren; die schöne Frau repräsentiere die Tote. Über das Motiv der schönen Leiche, wie es auch in den bürgerlichen Trauerspielen Legion ist, kann also das Enigma des Todes verhandelt werden, d.h. die fundamentale Störung der symbolischen Ordnung. Weil der patriarchalen Kultur „der weibliche Körper als Inbegriff des Andersseins, als Synonym für Störung und Spaltung gilt, benutzt sie die Kunst, um den Tod der schönen Frau zu träumen. Sie kann damit, (nur) über ihre Leiche, das Wissen um den Tod verdrängen und zugleich artikulieren, sie kann ‘Ordnung schaffen’ und sich dennoch ganz der Faszination des Beunruhigenden hingeben.“ (Bronfen 1994, 10) Dieses psychoanalytisch grundierte Modell gibt ein Interpretationsverfahren an die Hand, das den grassierenden Tod von weiblichen Figuren in bürgerlichen Trauerspielen und sozialen Dramen beschreibbar macht, in Büchners Stück eines Armen, Woyzeck, ebenso wie in Horváths Totentanz Glaube Liebe Hoffnung.
Männlichkeitskonstruktionen
Neben diesen komplexen Ausgrenzungsbewegungen lassen sich die Männlichkeitskonstruktionen der hier behandelten Gattungen in den Blick nehmen, ein Thema, das von der Forschung lange Zeit ignoriert wurde, und zwar deshalb, weil die männliche Position gemeinhin als neutrale, als allgemeinmenschliche, proklamiert wird und damit in Hinblick auf ihre geschlechtliche Codierung nicht in Erscheinung tritt. Generiert sich (bürgerliche) Männlichkeit darüber hinaus vor allem im Kontext der Familie, so lässt auch die strikte Sphärentrennung von (männlich semantisierter) Öffentlichkeit und (weiblich semantisierter) Intimität, von der in der Forschung grundsätzlich ausgegangen wird, die Entstehung und Formierung von Männlichkeit unsichtbar werden. Doch: „Die moderne Familie spielt zunächst (seit dem 18. Jahrhundert) eine neue und ganz entscheidende Schlüsselrolle am Ursprung der männlichen Subjektivität, und sie prägt darüber hinaus auch die Art und Weise, wie sich Männer in modernen Gesellschaften selbst verstehen, behaupten und konstruieren: als Familienmänner, die zuerst überwiegend von Müttern erzogen und später als Söhne und als Väter ihren Mann zu stehen haben“ (Erhart 2001, 8). Die Geschichte der Moderne ließe sich mithin auch als Geschichte von instabilen Männlichkeitskonstruktionen beschreiben, als Ensemble von performances und heterogenen Narrationen, die Männlichkeit herstellen, jedoch zugleich auf ihr Ausgegrenztes bezogen bleiben.
Männlichkeit als labile Narration
Erhart geht davon aus, dass das Andere, das scheinbar Ausgegrenzte, das auf die Frau projiziert wird, zugleich in das eigene (männliche) Selbst einwandert (Erhart 2001, 16). Literarische Texte lassen kenntlich werden, dass das Ausgegrenzte auch Bestandteil der männlichen Identität ist. Das bürgerliche Trauerspiel und das soziale Drama, zwei Gattungen, die ganz fundamental auf die bürgerlichen Phantasien von Familie bezogen sind, erscheinen vor diesem Hintergrund als taugliches Sujet, um moderne Männlichkeitskonstruktionen zu beschreiben. So ist allein schon die Tatsache bedeutsam, dass das bürgerliche Trauerspiel den Vater-Sohn-Konflikt eher ausspart als zu fokussieren. Diese Leerstelle gibt Aufschluss darüber, dass die Genese von Männlichkeit im Moment ihrer narrativen Herstellung in der Familie aus dem Blick gerückt wird, dass der bürgerliche Privatraum als weiblich codierter generiert wird. Darüber hinaus wäre die Position des Vaters (vgl. zu Lessing Wittkowski 2013), der vielfach zwischen Autorität und Empfindsamkeit steht, vor dem Hintergrund der Gender Studies neu zu beschreiben. In den letzten Jahren mehren sich die gendersensiblen Untersuchungen zu Männlichkeit und dem Geschlechterkonflikt im bürgerlichen Trauerspiel und sozialen Drama (Willms 2013; zu Lessing Düsing 2008; Dörr 2012; zu Wagner Künzel 2013; zu Schiller Boyken 2014; zu Büchner Patrut 2012; Graczyk 2013; zu Hebbel Hindinger 2009; zu Horváth Güngörmüs 2009).
Ausschlussverfahren
Was aus der Perspektive der feministischen Theorie wie der Gender Studies insgesamt als problematisch erscheint, ist der Ausschluss von Dramenautorinnen aus dem geltenden Kanon des bürgerlichen Trauerspiels und des sozialen Dramas; allein Marieluise Fleißer stellt für letztere Gattung eine Ausnahme dar. Erst im Kontext der Gegenwartsdramen, die allerdings dem selektiven Kanonisierungsprozess noch nicht unterworfen sind, zeichnet sich eine größere Präsenz von Autorinnen ab. Auf diese Ausschlussverfahren durch Archivierung und Tradierung, die die Literatur von Minoritäten in Vergessenheit geraten lassen, ist des öfteren hingewiesen worden (Assmann 1998); Lexika versuchen diesem Defizit abzuhelfen (Loster-Schneider, Pailer 2006). Auch im Bereich des bürgerlichen Trauerspiels und des sozialen Dramas läge es nahe, Produktionen von Autorinnen stärker zu berücksichtigen, um das Bild der Genres zu ergänzen und zu differenzieren (Kord 1992; Fleig 1999; vgl. zu Fleißer Bühler-Dietrich 2003; Schüller 2005). Ein Beispiel unter vielen wäre die im 18. Jahrhundert erfolgreiche Autorin Friederike Sophie Hensel. In ihrem recht populären Drama Die Familie auf dem Lande. Ein Drama in fünf Aufzügen (1770) wird, den Vorlieben der zeitgenössischen Dramenproduktion entsprechend, die Ehethematik des bürgerlichen Familienstückes und das beliebte Sujet der verführten Unschuld verklammert. Ein Novum ist in Hensels Drama jedoch die zentrale Stellung der Hausmutter – Hensel teilt die Vorliebe des bürgerlichen Trauerspiels für Vater-Tochter-Beziehungen nicht und lässt den Ausschluss der Mutter als (männlich bestimmte) Gattungskonvention erscheinen. Zudem wird, zumindest in der zweiten Fassung des Dramas, das aufklärerische Familienmodell in Frage gestellt, indem die Einsicht in das tugendhafte Verhalten des Gegenübers nicht fraglos Liebe und Ehe nach sich zieht. Und bei aller Verbindlichkeit wird doch die Rigidität des Tugendethos kenntlich: Die Hausmutter Lady Danby verstößt ihre möglicherweise lasterhafte Tochter lieber als ihr zu verzeihen – eine Umkehrung desjenigen Verhaltens, das der zärtliche Vater in Lessings Miß Sara Sampson an den Tag legt. Die Berücksichtigung von Dramatikerinnen würde also das kulturelle Wunsch- und Projektionspotenzial der Figurenkonstellationen im bürgerlichen Trauerspiel von Autoren kenntlich werden und ein verändertes Panorama der favorisierten Themen und Motive entstehen lassen. Zwar orientiert sich die vorliegende Untersuchung aufgrund von pragmatischen Erwägungen an dem gängigen Kanon; es werden gleichwohl die Erkenntnisse der Gender Studies für die Lektüren genutzt.