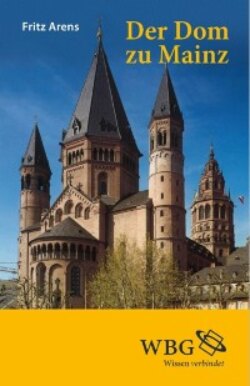Читать книгу Der Dom zu Mainz - Fritz Arens - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der erste Bauabschnitt in romanischer Zeit um 1000
ОглавлениеErzbischof Willigis begann bald nach dem Antritt seines Amtes, 975, den Bau eines neuen Domes östlich des alten Domes, der jetzigen Johanniskirche. Die von seinen Vorgängern und von ihm inzwischen errungene führende Stellung im Reich und in der deutschen Kirche wird allein schon einen größeren und reicheren Bau gefordert haben. Der Neubau brannte allerdings am Tag der Weihe, 29. oder 30. Aug. 1009, oder unmittelbar davor ab. (Alte Quellen siehe bei Kautsch 1927, S. 16 – 26.) Die Nachfolger auf dem Erzbischofsstuhl scheinen alsbald mit der Wiederherstellung begonnen zu haben. Erzbischof Aribo (1021 – 1031) bestellte bereits bei dem Domscholaster Ekkehard (IV.) Verse für die künftige Ausmalung und wurde im Westchor vor dem Hochaltar beigesetzt. Erst dem dritten Nachfolger, Bardo (1031 – 1051), war es beschieden, den Dom mit einem Dach zu versehen, auszustatten und am 10. Nov. 1036 in Gegenwart von Kaiser Konrad II., der Kaiserin Gisela sowie König Heinrich III., dessen Gemahlin und von 17 Bischöfen zu weihen. Man darf wohl annehmen, daß die drei Nachfolger des Willigis im wesentlichen den von ihm gebauten Dom wiedererrichteten. Gelegentlich einer großen Synode wurde im Okt. 1049 ein Marienaltar geweiht. Unter Erzbischof Bardo wurden auch Kreuzgang und Stiftsgebäude errichtet.
Das Aussehen dieses zwischen 975 und 1036 errichteten Kirchenbaues kennen wir wenigstens im Grundriß, der interessant und bedeutungsvoll ist. An ein sehr breites dreischiffiges Langhaus schloß sich im Westen ein 200 Fuß langes Querhaus an. Im allgemeinen errichtet man die Querhäuser im Osten anschließend an eine Apsis. Außerdem ist es um 1000 schon üblich, das Querhaus nicht länger als drei Quadrate zu machen, während das Mainzer etwa vier Quadrate lang ist. Also gleich zwei Besonderheiten. Vom Ost- und Westabschluß dieses Domes wissen wir ebensowenig wie vom Aufbau des Langhauses. Eine Streitfrage ist, ob eine Ostapsis vorhanden war. Ein Fundament aus der Zeit vor der jetzt bestehenden Apsis wurde nicht gefunden. Also wurde von einigen Forschern (Kunze, Esser) eine östliche Eingangsfassade, sogar mit Mittelturm, rekonstruiert, die wie ein Westwerk aussieht. Dagegen läßt sich einwenden, daß es 1. seit Fulda keine Kirche mit Westquerhaus gibt, die nicht auch eine Ostapsis besitzt, daß 2. bereits 1071 eine Ostapsis des Mainzer Domes bezeugt ist, daß 3. bei der Fundamentierung der neuen Apsis um 1100 das frühere Fundament wahrscheinlich herausgerissen wurde, um eine Pfahlgründung vornehmen zu können, die aufgrund von Erfahrungen, die man am Willigis-Bardo-Dom gemacht hatte, ab 1100 hier und dann an der Verstärkung der Langhausfundamente eingeführt wurde.
Von diesem Willigis-Bardo-Dom steht oberirdisch nur wenig Mauerwerk aufrecht. Die nördliche Querhausgiebelwand ist dadurch stehengeblieben, daß die St.-Gothard-Kapelle (s. S. 38) an sie angebaut wurde. Dort sind auch Reste eines mächtigen Portals zu finden. Die beiden östlichen runden Treppentürme, die ebenfalls Schule gemacht haben (in Worms), sind zwar im Fundament durch Fugen von den anliegenden quadratischen Baukörpern getrennt, binden dann aber doch in das aufgehende Mauerwerk tief ein. Daraus kann geschlossen werden, daß sie noch unter Willigis durch eine nachträgliche Änderung des ursprünglichen Bauplans angefügt wurden, um einen bequemen Zugang zu den Dächern beim Bau und bei Katastrophen zu haben. Die unteren vier Geschosse sind noch alt, in strenger Weise mit Pilastern und Gesimsen geschmückt und nur durch kleine Trichterfenster beleuchtet. Im Inneren findet sich eine Treppe mit flachen Stufen. Die Spindel ist abwechselnd aus roten und weißen Quadern gemauert. Ferner sind aus der Zeit des Willigis noch die beiden Bronzetürflügel des Marktportals erhalten (s. S. 52 ff.).
Als vergleichbarer Bau ist die Klosterkirche des hl. Bonifatius zu Fulda mit ihrem ausladenden Westquerschiff zu nennen, die zwischen 791 und 819 errichtet wurde. Aber auch die Grabeskirche des Apostels der Deutschen hatte ihr Vorbild, nämlich in der des Apostelfürsten in Rom, im konstantinischen St. Peter. Der Primas Germaniae ahmte als Haupt der deutschen Kirche den römischen Petersdom nach. Rom wird im ganzen Mittelalter als Haupt der Welt und als vorbildlich angesehen. Entsprechend baute gleichzeitig der Kölner Erzbischof Pilgrim (1021 – 1036) die als seine Grabeskirche vorgesehene Apostel-Kirche in Köln, eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit rechteckigem Ostchor, weitausladendem, durchgehendem Querschiff und Vierstützenkrypta unter dem quadratischen Westchor.
Der um 900 erbaute alte Mainzer Dom, die spätere Johanniskirche, hatte ebenfalls ein Westquerhaus. Von hier aus könnte auch der Grundriß des neuen Willigisdomes angeregt worden sein. Nachdem der Mainzer Dom um 1000 dieses römische Bauschema aufgegriffen hatte, wurde es von einigen anderen Bischöfen nachgeahmt, nämlich in Bamberg, Augsburg und Regensburg.
Die Michaelskirche zu Hildesheim, die der Willigisschüler Bernward (1010 – 1022) erbaute, ist ebenfalls doppelchörig, besitzt aber zwei kurze Querschiffe mit ausgeschiedener Vierung: ähnlich wie in Mainz sind Treppentürme außen angefügt. Der jüngere Wormser Dom, der allerdings sein Querhaus im Osten hat, wiederum doppelchörig, weist durch ähnliche Treppentürmchen auf das Mainzer Vorbild hin.
Der Willigisdom mußte deswegen gründlich betrachtet werden, weil seine Fundamente und seine Maße die späteren Dombauten bestimmen. Zwar sind der Ost- und Westabschluß bis heute nicht absolut sicher faßbar, aber das Langhaus und Querhaus sind in ihren Fundamenten festzustellen. Die einzige nachweisbare Veränderung der Jahrzehnte nach 1200 besteht in der Verkürzung des Querschiffs.