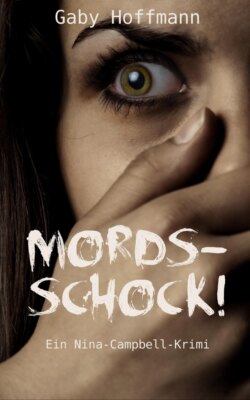Читать книгу Mordsschock! - Gaby Hoffmann - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
Оглавление„So alt wird kein Schwein!“, sagte Großtante Carlotta wie jedes Jahr an ihrem Geburtstag. Zwei Tage später starb sie.
Da Tante Carlotta in ihren 83 Lebensjahren sparsam, aber finanziell unabhängig gewirtschaftet hatte, warteten meine Schwester Sophie und ich gespannt darauf, was uns der Notar gleich aus ihrem Testament vorlesen würde.
Ich schlug meine Jeansbeine übereinander und wippte mit den Stiefelspitzen, in denen sich mal wieder ein nicht zusammenpassendes Paar Socken verbarg.
Sophie saß kerzengerade im eleganten, eierschalenfarbenen Kostüm neben mir. Die Beine, damenhaft züchtig in hautfarbenen Nylons verpackt, endeten in hellen Wildlederpumps, die wohlsortiert vor dem Sessel ruhten. Während sie scheinbar gelassen den Worten des Notars lauschte, wanderte ihr rechter Zeigefinger nervös in das rechte Nasenloch und popelte. Treffer! Versenkt! Als der Notar zum Wesentlichen kam, zog sie ihren Finger wie einen Ausreißer erschrocken heraus und verschränkte die Hände im Schoß.
„Mein Vermögen in Form von Aktien und Investmentfonds sowie mein Haus samt Inventar hinterlasse ich der Tochter meines verstorbenen Neffen Manfred Burmeister und seiner verstorbenen Frau Helen, der lieben Sophie, die Helens dritte Tochter Vicky großzieht. Meine für mich wertvollsten Besitztümer aber vermache ich als Zeichen meiner Zuneigung Helens zweiter Tochter aus ihrer nichtehelichen Beziehung, der lieben Nina ...“
Vor Aufregung drehte ich die Tempos in der Tasche meiner Lederjacke zu tausend kleinen Kügelchen.
„Sie bekommt mein Auto und meinen Kater Oscar.“
Die Taschentuchkügelchen kullerten auf den Boden, dem Notar vor die Füße.
„Oh, Verzeihung!“ Ich bückte mich und hockte nun halb unter dem Schreibtisch. Im Rücken spürte ich die verächtlichen Blicke meiner älteren Schwester. Das Auto, mit dem Tante Carlotta so gerne hin- und hergegondelt war, hatte seine neun Jahre auf dem Buckel. Und der fette Kater ... Na ja, typisch: Sophie, die dank ihres fleißigen Mannes Thilo sowieso schon in einem repräsentativen Einfamilienhaus am Stadtrand lebte, wurde von Tag zu Tag wohlhabender. Mein Traum, meine kleine Schwester Vicky zu mir zu holen, rückte in weite Ferne.
„Schön, dass du jetzt auch ein Auto hast!“ Gönnerhaft tätschelte Sophie meine Schulter, als wir die Kanzlei verließen. Zufriedenheit spiegelte sich auf ihrem Gesicht, das mit den großen blauen Augen, den pfirsichfarbenen Wangen und den strahlend weißen, wie zu einer Perlenschnur aufgereihten Zähnen hinter den dezent bordeauxrot geschminkten Lippen einer ihrer Schlafpuppen glich, die sie als Mädchen geliebt hatte.
Normalerweise war meine Schwester eine Meisterin im Nörgeln. Keine Ahnung, wie mein wirklich herzensguter Schwager Thilo ihre Launen ertrug. Ich jedenfalls hatte von klein auf mein eigenes ‚Anti-Sophie-Programm‘. Jene von Sophie gehütete Schlafpuppe beispielsweise ließ ich als Fünfjährige vom großen Bruder eines Nachbarjungen kahl rasieren und schmierte sie dann eigenhändig mit schwarzer Schuhcreme ein. Zwar war Sophie mit 16 schon aus dem Puppenalter heraus, trotzdem regte sie sich mächtig auf, weil ihre Kinder die Puppe erben sollten. Heute, 20 Jahre später, hatte Sophie noch keinen Nachwuchs in die Welt gesetzt, besaß aber das Sorgerecht für unsere kleine Schwester Vicky. Und die spielte, genau wie ich in ihrem Alter, lieber Fußball als mit Puppen.
Sophies Absätze klapperten die schweren Steinstufen hinunter. ‚Klack-klack‘ hallte es. Ihr blonder, symmetrischer Pagenkopf wippte, ihre eierschalenfarbenen Hüften schwangen. Der Jil-Sander-Duft schwebte hinter ihr her. Das hanseatische Treppenhaus mit Stuckverzierungen und großzügigen Glastüren auf jeder Etage, an denen imposante Namensschilder diverse Anwaltskanzleien ankündigten, gab einen trefflichen Rahmen für sie ab.
Es roch intensiv nach Putzmitteln. Ein Mann im grauen Anzug wartete vor dem Fahrstuhl. Höflich grüßte er. Sicher hielt er Sophie für eine erfolgreiche Anwältin und mich für ihre missratene Mandantin, die sie aus irgendeinem Sumpf rettete.
Ich hätte den Fahrstuhl genommen, aber Sophie wollte vermutlich in den fünf Stockwerken ihre leichten Fettpölsterchen am Bauch abtrainieren, die sich vorsichtig in dem schmal geschnittenen Kostüm abzeichneten. Die Konsequenzen des guten Lebens!, dachte ich boshaft. Schon als wir Kinder waren, musste ich den Müll runterbringen, während Sophie Mutters Saucen abschmecken durfte.
Als hätte Sophie meine Gedanken gelesen, drehte sie sich plötzlich um. „Du brauchst gar nicht so ein Gesicht zu ziehen! Schließlich bist du mit Tante Carlotta nicht mal blutsverwandt! Außerdem habe ich Verantwortung.“ Ihre gute Laune verbot ihr den sonst üblichen Verweis darauf, wie teuer der Unterhalt für Vicky sei und wie eine rotzfreche Elfjährige ihre Nerven strapaziere.
Sophie stieß einen undamenhaften Seufzer aus, als wir unten ankamen. Die vielen Treppen forderten ihren Tribut, aber die Erbschaft weckte ihre großzügige Ader. „Gehst du auf einen Kaffee mit? Ich lade dich ein.“
„Muss los! Bin schon zu spät dran!“ Ich stemmte die wuchtige Marmortür im Portal auf und atmete tief durch. Es war wie der Eintritt aus einer kühlen Käseglocke in einen belebten Bienenstock. Um mich herum schwirrte und summte es. Passanten hasteten mit schweren Einkaufstüten vorbei.
Trotz der winterlichen Temperaturen kam es mir draußen wärmer vor. Die hohen Gebäude rahmten die Mönckebergstraße ein und schirmten sie vor eisigen Winden ab. Einen Straßenmusikanten hatte der Sonnenschein nach draußen gelockt. Er fiedelte mitten auf dem Gehsteig herzzerreißend auf einer alten Geige. In der Ferne ertönte ein Martinshorn. Ein Kind sprang in eine Schneematschpfütze im Rinnstein und wurde von seiner Mutter schimpfend herausgeholt. Ein Mann lief auf und ab, um den Leuten mit volltönender Stimme „die Botschaft von Jesus, dem Herrn“ zu verkünden. In einer Nische neben dem Hauseingang wärmte sich ein Bettler die Hände im zottigen Fell seines Schäferhundes auf einer zerschlissenen Wolldecke und murmelte monoton: „Bitteschön! Bitteschön!“ Von der Imbissbude neben dem Kaufhaus auf der anderen Straßenseite zog ein verlockender Bratwurstgeruch herüber.
Ich legte eine Münze in den Hut des Bettlers.
„Vergelt’s Gott, junge Frau“, bedankte er sich im gleichen monotonen Singsang.
Sophie schüttelte den Kopf. Missbilligend zog sie die Schultern hoch. Ihre Körpersprache drückte aus, was sie dachte: Du wirst es nie zu etwas bringen!
Ein langer Schatten fiel vor uns auf das Pflaster, rasch rief ich Sophie zu: „Tschüss, gib Vic einen Kuss von mir!“
Vor dem Schaufenster nebenan hatte ein großer Mann gewartet. Er trat jetzt ins Licht der Februarsonne, die sich auf seinen glänzenden, schwarzen Haaren spiegelte. Der dunkle Mantel streckte die schlanke Gestalt, sodass er wie eine Insel zwischen all den eiligen Leuten auftauchte. Freudige Erwartung lag auf seinen glatt rasierten, olivfarbenen Gesichtszügen, die so perfekt das Bild des Latin Lovers mimten. Ehe ich etwas sagen konnte, presste Anthony mir einen feurigen Kuss auf die Lippen und saugte sich, ungeachtet der Menschenmenge, eine Weile an mir fest.
Das tat gut, nach dem seriösen Muff. Ich schmeckte seine weichen Lippen, roch das herbe Aftershave. Sanft schob er seine Zunge in meinen Mund. Sie spielte mit meiner, kitzelte und liebkoste sie. Langsam und fest, dann schneller und schneller. Im Gleichtakt rasten unsere Zungen, verschmolzen zu einer Einheit. Mein Pulsschlag beschleunigte sich. Beben im ganzen Körper.
Viel zu früh löste er seine Lippen, fasste mich um die Schultern und fragte: „Und?“
„Ein Auto!“
„Benz? Jaguar? Chrysler?“
„Polo, neun Jahre alt, rostfrei.“
Anthony lockerte seinen Griff, zog hörbar Luft durch seine etwas vorstehenden Schneidezähne, die er gerne hinter festgeschlossenen Lippen verbarg, weswegen er auch als interessanter Schweiger galt. Nur, dass er nie etwas wirklich Interessantes erzählt hatte. Aber diese südländische Macho-Optik erotisierte seine Person.
„Und ...“
„Ja?“ Ungeduldig legte er mit herrischer Geste seinen rechten Arm um meine Taille.
„Ein Kater, acht Jahre alt.“
Anthony verbarg seine Schneidezähne krampfhaft hinter festverschlossenen Lippen. Stumm und finster wie eine Auster ging er im Stechschritt neben mir durch den Pulk summender Menschen zum Parkhaus. Wortlos fuhr er mich im rasanten Tempo zur Redaktion.
Geschäftshäuser, Banken, Patriziervillen, Läden, Restaurants, der Hauptbahnhof flogen an uns vorbei. Wir überquerten die Lombardsbrücke mit ihrem traumhaften Blick auf die von der Cityskyline eingerahmte Binnenalster. Verwaist ruhte sie, eine zarte Eisschicht als Bettdecke übergestülpt. Ihre Könige waren noch nicht zurück, aber bald würden die stolzen Alsterschwäne wieder majestätisch ihre Bahnen ziehen.
Anthony drückte das Gaspedal durch, als könnte er mich nicht schnell genug loswerden. Er brauste den Mittelweg an den weißen Villen entlang in Richtung Außenalster. Das Schweigen im Auto wurde erwidert. Der Fluss lag im Winterschlaf. Nur gestört von einigen Spaziergängern, hart gesottenen Joggern, Radlern und hungrigen Enten.
Wenn die Alsterfontäne ihr funkelndes Wasserspiel startete, erwachte das Leben. Ausflugsdampfer würden begeisterte Touristen befördern, zahlreiche weiße Segel würden sich im Wind blähen, schwitzende Ruderer würden mit verzerrtem Gesicht vorbeihasten, und ich würde bei einem Cappuccino in einem der Cafés am Ufer in der Sonne dösen.
Anthony setzte mich vor dem gläsernen Bürogebäude in der Alten Rabenstraße ab. Von hier aus konnte man bis zum Fähranleger hinunter sehen. Ich erkannte dort die Silhouette einer alten Frau, die Brot für die Enten ins Wasser warf.
Anthony presste schwerfällig die Lippen auseinander: „Ich rufe dich an!“
Es war das Letzte, was ich jemals von ihm hörte!