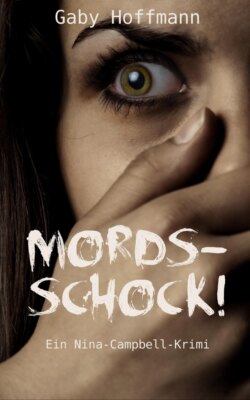Читать книгу Mordsschock! - Gaby Hoffmann - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеEinen Monat später stand ich in der Kleinstadt Rosenhagen vor einem winzigen Stadthaus, das so um 1900 erbaut sein mochte. Schmal und weiß mit leichten Stuckornamenten verziert, bot es dem heftigen Wind, der heute herrschte, trotzig die Stirn. Geschwungene Bögen über den grün-weiß gestrichenen Rahmen der Sprossenfenster im Giebel unterstrichen den zähen Charakter des Gebäudes.
Ebenso alt wie die Zeitung, die da drinnen modert, dachte ich grimmig und stapfte mit meinen superhohen Buffalo-Stiefeln die schmalen Stufen hoch. Ich stieß die grüne Holztür auf. Wie rostige Schneeflocken rieselten abblätternde Farbteilchen herunter und hinterließen eine grüne Spur.
Zum Vorstellungsgespräch war ich nach Feierabend da gewesen und hatte nur den hageren Chefredakteur angetroffen. Im Dämmerlicht hatte das Gebäude wie ein Spukhaus gewirkt. Trostlos, verwittert und vergessen. Kein Wunder, dass ich den Job ergattert hatte, die waren sicher froh, jemanden gefunden zu haben. Ich schickte ein Stoßgebet an Hendriks Cousin, der sich nun wer weiß wo aalte.
Jetzt, bei Tageslicht, war der Spuk weggewischt. Zweibeiniges Inventar des Hauses kroch mir lebendig entgegen. Eine rundliche, grau-brünette Frau im strassbesetzten Pullover, der über dem üppigen Busen spannte, lächelte mich an. Ihr Unterkörper blieb verdeckt, weil sie hinter einem wuchtigen Holztresen lehnte.
Frauen mit viel Oberweite animieren mich dazu, heimlich auf dem Klo zu verschwinden und eine Packung Kleenex in meinem dürftigen Ausschnitt zu versenken. Aber als Neue kann man ja wegen mangelnder Ortskenntnis keinen Schritt alleine tun. Also dümpelte mein Dekolleté weiter auf Bügelbrettniveau.
Der Vorraum verbreitete mit seiner braunen Rautentapete und den grünlichen Linoleumfliesen als beißendem Kontrast zu der Hausfassade ein gewisses 70er-Jahre-Flair. Vermutlich die Epoche der letzten Renovierungsphase.
Aus den Augenwinkeln musterte die Frau meinen Rock, der zugegebenermaßen gerade so eben den winzigen Slip bedeckte, aber ich fand ihn cool.
Ich strich mir einige vorwitzige Haarsträhnen, die sich aus meinem Pferdeschwanz gelöst hatten, hinter die Ohren. „Tag, ich möchte zu ...“
Weiter kam ich nicht, denn die Dicke unterbrach meinen höflichen Satz und erklärte schnell: „Ja, ich weiß Bescheid. Sie werden erwartet. Ich bringe Sie hoch!“ Während sie sprach, entschlüpften ihr kleine Schmatzer, weil sie ein Bonbon lutschte, das sie ständig von einer Wange in die andere Wange schob. Sie winkte mir, ihr zu folgen, und kletterte trotz ihrer Fülle behände eine morsche Holztreppe hoch. Ihr imposantes Hinterteil schwankte vor mir wie ein Schleppkahn, der mich in den Hafen zog.
Ich hatte Mühe, mit meinen Plateausohlen die zierlichen Stufen zu treffen. Unter jedem meiner Schritte ächzten sie dazu so erbärmlich, dass ich alle Augenblicke befürchtete, die Treppe würde zusammenkrachen.
Oben angekommen, riss meine Begleiterin eine Bürotür auf, aus der eine blaue Qualmsäule entwich, und rief in den Dunst: „Sie ist da! Ich bringe sie in den Konferenzraum!“
Dieses ‚sie‘ fand ich nicht besonders höflich, aber das war wohl der übliche Umgangston in der Provinz.
Ich nahm auf einem durchgesessenen Regiestuhl in einem nüchternen Raum Platz. Weiß getünchte Wände, acht weitere Regiestühle und ein grauer, länglicher Tisch – das war alles. Karger als der Wartesaal eines Krankenhauses.
Ein zartgliedriger Mann huschte wie ein Elf durch die Tür, in der Hand einen Stenoblock und Kuli. „Guten Tag, schön, dass Sie gekommen sind!“, begrüßte er mich nervös blinzelnd. Hastig ergriff er meine dargebotene Hand und ließ sie sofort wieder fallen, als handle es sich um einen ekligen alten Lappen.
Meine Fingerspitzen schimmerten grünlich – ein Souvenir der Holztür! Vermutlich glaubte mein Gegenüber, ich hätte eine ansteckende Krankheit oder bereits mangels ausreichender Körperpflege Grünspan angesetzt.
Anstatt seinen Namen zu nennen, zückte er den Kuli. „Wenn es Ihnen recht ist, fangen wir gleich an.“ Seine Stimme war überraschend tief und männlich.
Ich nickte gnädig. Schließlich erwartete ich, jetzt den Vertrag zu unterzeichnen und dann an die Arbeit zu gehen. Sektfrühstück oder Champagnerempfang hatte ich mir schon vor Jahren abgeschminkt.
Fahrig rutschte das Männchen vor mir auf dem Stuhl herum und räusperte sich. „Wie sind denn so Ihre Arbeitszeiten?“
Ach, das war ja mal ganz was anderes! Durfte ich die hier etwa diktieren? Ich zupfte den kurzen Rock zurecht und wuchs in meinem Stuhl. „Bisher habe ich von neun bis achtzehn Uhr, auch mal etwas länger, gearbeitet.“
Das Männchen hob den Kopf und blickte mich an, als ob ich nicht ganz dicht sei. „So früh?“
Das war ja nett! Kompromissbereit bot ich an, gerne jederzeit später anzufangen.
Das Männchen gewann wieder etwas von seiner verlorenen Fassung zurück und setzte die nervige Fragenstellerei fort: „Wie sind Sie dazu gekommen, gerade diesen Beruf einzuschlagen?“
Diese Runde ging an ihn, ich wurde unruhig. Vermutlich hatte ich den Job längst nicht in der Tasche, und er war irgend so ein Personalchef, der mich nochmals auf Eignung testete. Wohlüberlegt formulierte ich: „Ich interessiere mich für Menschen, und da lag es nahe ...“
Das Männchen stoppte mich, während es auf seinem Block herumkritzelte. „Aber es gibt so viele andere Berufe, die mit Menschen zu tun haben und ...“, er hüstelte kurz, „ich will es mal so ausdrücken, etwas ehrbarer sind.“
Nanu, war der Typ etwa ein Nestbeschmutzer von der Sorte ‚wir schimpfen auf Schmierenjournalisten und hängen uns das FAZ-Mäntelchen um‘? Ich überlegte, ob ich ihm den Käse vom investigativen Journalismus, der durchaus ein Wohltäter der Menschheit sein könne, aufs Brot schmieren sollte.
Aber das neugierige Männchen hatte schon seine nächste Frage parat: „Gibt es Praktiken, die Sie ablehnen?“
Ich überlegte vorsichtig: „Na ja, ich habe Respekt vor dem Tod, Pietät – Sie wissen schon! Als Witwenschüttlerin eigne ich mich wohl nicht!“
Mein wissbegieriges Gegenüber fuhr in seinem Stuhl hoch, glotzte mich entsetzt an, zuckte zweimal wie ein altersschwacher Regenschirm, sackte dann in schiefer Haltung zusammen und schrieb emsig mit. Fasziniert betrachtete ich drei Schweißperlen, die ihm von der angestrengten Stirn auf die Nase tropften, als koste ihn seine Fragerei große Überwindung. Jetzt brachte die Feuchtigkeit seine Brille ins Rutschen. Er fing sie eben am linken Bügel auf. Konzentriert sandte er mir einen stechenden Blick zu, als ob das Malheur meine Schuld wäre.
„Wenn Sie mit so vielen Männern zusammen sind, wie sieht es dann mit einer festen Beziehung aus?“ Ein rosiger Hauch flackerte über sein Gesicht, als wäre er stolz, diesen Satz über die Lippen gekriegt zu haben.
Okay, ich bin bestimmt nicht verklemmt, aber das war zu viel! Mein Privatleben ging diesen fremden Typen überhaupt nichts an. „Waren Sie mal bei der Stasi?“ Ich schnappte meine Tasche, warf meine Lederjacke über und wollte mit den Worten ‚Entschuldigung, hier kann ich nicht bleiben!‘ einen eleganten Abgang machen. Der wurde mir aber versaut, weil die Tür sich dummerweise von der anderen Seite öffnete und ich sie an den Kopf bekam. Eine hübsche Beule war genau das, was mir in diesem Moment noch fehlte!
Meine Begleiterin von vorhin schob eine dauergewellte junge Frau in Jeans, Pulli und Turnschuhen durch die Tür. „Tut mir leid“, stammelte sie verlegen. „Das ist die richtige Frau Körner.“ Mit diesen Worten bugsierte sie die Sportliche ins Zimmer, reichte mir formell die Hand und sagte: „Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Riechling ist mein Name, ich bin die Sekretärin. Herzlich willkommen bei uns!“
Das Männchen schien in diesem Moment einer Herzattacke nahe zu sein. „Eine Verwechslung also?“, stammelte es keuchend und stand jetzt endgültig auf den Trümmern seiner abermals runtergerutschten Sehhilfe.
„Schon gut!“ Ich verließ mit der Sekretärin den Raum.
„Möchten Sie ’n Bonsche?“ Sie fuchtelte mit einer Tüte Himbeerbonbons vor meiner Nase herum.
Aus Höflichkeit griff ich zu. „Was hat diese Frau Körner für einen Beruf?“
Die Riechling reckte sich bis zu meinem Ohr hoch, sodass ich ihren süßlichen Himbeeratem wahrnahm, und flüsterte schmatzend: „Nutte!“ Gepflegter schob sie hinterher: „Sie wissen schon, Prostituierte!“
Tiefe Furchen auf der Stirn verliehen dem graubärtigen dürren Chefredakteur Edfried Wagner den Anschein eines großen Denkers, der ständig mit Weltproblemen befasst war. Die eingefallenen, in Höhlen liegenden graublauen Augen verstärkten das Image des ausgemergelten Asketen. Ich stellte ihn mir beim Meditieren in einem buddhistischen Kloster vor. Seine Knochen steckten in einem zerknautschten Leinenanzug. So wie ihm seine Kleidung um den Körper schlackerte und oben der farblose Kopf herausguckte, erinnerte er mich an einen Totengräber. Kein Wunder, dass ich beim Vorstellungsgespräch glaubte, in einer Spukspelunke zu sein. Ein eingefleischter Vegetarier mit Essstörungen? Heimlich spähte ich, ob ich auf seinem Schreibtisch einen ausgewaschenen Joghurtbecher voller Salatblätter entdeckte.
Während Wagner mich einwies, stürmte sein Kontrastprogramm – ein ausgemachter Fettwanst – schnaufend ins Büro. „Drei Verletzte und ein umgekippter Schweinetransporter auf der A1. Machen Sie die Eins frei, Chef!“, brüllte er, und sein schwammiges rotes Gesicht unter der blonden Vollponyfrisur wurde durch ein strahlendes Grinsen verzerrt. „Aye! Jetzt haben wir einen Super-Aufmacher!“ Die auf halb acht sitzende schmuddelige Jeans rutschte ihm in die Kniekehlen, wozu seine unzähligen Schlüssel am Hosenbund ahnungsvoll klimperten. Als Aura umgab diesen keuchenden Polizeireporter außer einem saftigen Schweißaroma die ständig piepsende und knackende Geräuschkulisse vom Polizeifunk. „Peeeddder Eins biddde kommen! Hier is ’ne Frau umgekippt. Peeeddder Eins biddde!“, schnarrte es aus dem kleinen Apparat.
Der Chef ließ sich von seiner Begeisterung anstecken. „Gut, Jelzick!“ Er ballte die knochige Faust und stampfte dabei auf den knarrenden Dielenboden. Ich lag mit meiner Einschätzung des durchgeistigten Propheten völlig falsch!
Die karge Möblierung der Büros hatte wohl auf Edfried Wagner abgefärbt oder ihm den Appetit verschlagen: Die kleinen, verwinkelten Räume waren bis auf zwei oder drei verwitterte Holzschreibtische nackt. Davor standen altersschwache graue Drehstühle, die mindestens schon drei Generationen von Journalisten durchgesessen hatten. Weder Bilder an den weißen Wänden noch Grünpflanzen auf den Fensterbänken. Nur abgerissene Zettel mit Memos, vollgekritzelte Timer, Kalenderblätter und vergilbte Zeitungsausschnitte klebten überall. Computer, Drucker und Telefone auf den Tischen wirkten wie futuristische Eindringlinge aus einer anderen Welt. Den Blick nach draußen versperrten graue, rauchgeschwängerte Mullgardinen, die sich trotz geschlossener Fenster leicht vor den offensichtlich undichten Butzenscheiben blähten.
Aha, ständige Frischluftzufuhr als kreativer Kick, dachte ich, als ich meinen neuen Arbeitsplatz in Beschlag nahm. Trotzdem roch es stark nach 1900.
Mir gegenüber erhob sich eine Hünin, vielleicht vierzig Jahre alt. Sie wiegte sich beim Gehen aufreizend in den Hüften, als wolle sie mir von vornherein demonstrieren, welche Frau in diesem Laden die Nummer 1 war. Geschmack war nicht ihre Stärke: Der grüne Hosenanzug erzeugte eine fabelhafte Disharmonie zu ihren blond gesträhnten Haaren und den grell blau geschminkten Augenlidern hinter einer goldenen Brille. Herausfordernd sog sie zunächst mit gespitzten Lippen und nach oben gerecktem Kinn an ihrer Zigarette, ehe sie mir herablassend die Hand schüttelte. Die vielen Ringe an ihren Fingern piekten. „Ich bin Gundula Zöllner. Wenn du mal nicht weiter weißt, frage mich! Nur keine falsche Scheu!“
Sie lachte für mein Empfinden etwas zu schrill. Bei dem Gedanken an ihre feuchten Qualmwolken, gepaart mit süßlichem Parfümgeruch, wird mir jetzt noch übel.
Als angenehme Überraschung entpuppte sich der zierliche Mann, der mit mir das Interview geführt hatte. Hinter den dicken Brillengläsern blitzten intelligente braune Augen, an deren Rändern sympathische Lachfältchen saßen. „Ich heiße Herbert Dabelstein. Sagen Sie ‚Herbie‘, das tun alle!“
Der Polizeireporter Jelzick popelte am nächsten Morgen während der Redaktionskonferenz gelangweilt seine Frühstücksreste aus einer Zahnlücke. „Heute ist tote Hose!“, lispelte er, und weil ein Finger noch zwischen den Zähnen klemmte, schaltete er mit den restlichen Fingern das Funkgerät ein.
„Der Peter Heimann ist verunglückt! Tragische Sache!“, meldete sich Herbie zu Wort. „Da könnten wir eine Meldung bringen.“
„Wer is ‘n das?“ Jelzick kratzte inzwischen mit einem Bleistift das Schwarze unter seinen Nägeln hervor.
„Ein Abgeordneter von den Konservativen. Jung – dreiundzwanzig Jahre alt. Aufstrebendes Talent, hoffnungsvoller Nachwuchspolitiker!“
„Umweltausschuss, oder?“, überlegte Gundula.
Herbie nickte. „Er ist zugedröhnt mit seinem Wagen in die Kieskuhle gefahren und hat irgendwie die Kontrolle verloren. Jedenfalls stürzte er mit dem Auto den Abhang runter. Der Wagen landete in der Böschung. Er wurde herausgeschleudert und hat sich das Genick gebrochen. Vermutlich nicht angeschnallt. Der Leichnam trieb am Ufer des Sees.“
„Was hatte er intus?“ Jelzicks Neugierde war geweckt.
„1,8 Promille Alkohol und Ecstasy. Ich habe in deinem Revier gewildert und mit der Polizei gesprochen.“
„Dieser Cocktail reicht, um einen ausgewachsenen Mann kirre zu machen“, bestätigte Jelzick.
„Wissen die schon, was dahinter steckt?“ Wagner trommelte ungeduldig mit einem Filzstift auf die leeren Layoutbögen.
„Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Polizei vermutet Selbstmord unter Drogeneinfluss. Anscheinend hat er alleine im stillen Kämmerchen getrunken. Jedenfalls existieren keine weiteren Zeugen.“
„An der gleichen Stelle ist vor einigen Monaten schon mal einer von diesen Nachwuchspolitikern tödlich verunglückt. Ich glaube, er wickelte sich samt Auto um einen Baum“, bemerkte Jelzick.
„Ja genau, im Herbst. Auch einer von den Konservativen“, stimmte Gundula ihm zu.
„Soll ich nun eine Meldung schreiben?“, bohrte Herbie nach.
„Na gut, machen Sie einen Nachruf! Fünfzig Zeilen inklusive Foto auf der Zwei, links oben!“, befahl der Chef.
Herbie würde es mit einem ‚tragischen Unglücksfall‘ umschreiben. Für Selbstmörder gab es keinen Platz in der Presse.
Ich betrachtete das Foto, das wenig später auf Herbies Schreibtisch lag. Peter Heimanns große Augen schauten ernst und fragend. Ich wusste nicht, warum, aber irgendetwas schienen sie mir sagen zu wollen. Ob er zum Zeitpunkt der Aufnahme schon mit dem Gedanken gespielt hatte, sein Leben zu beenden? In den dunklen Pupillen entdeckte ich jeweils einen hellen Fleck, der darin wie ein Hoffnungsschimmer aufzuflackern schien. Und doch war für ihn nun alles verloren!
Eine halbe Stunde später steuerte ich Tante Carlottas Polo in ein Kaff außerhalb von Rosenhagen, wo mich irgendein Nachbarschaftsstreit erwartete. ‚Rumpel‘ – schon der Name ließ mich an vermüllte Dachspeicher denken. Hätte ich geahnt, auf welchen gefährlichen Job ich mich einließ, wäre ich sofort nach Hamburg zurückgedüst!
Ich kurvte an Äckern und Kuhwiesen vorbei durch eine Siedlung von kleinen, spitzen Einfamilienhäusern aus den 50er-Jahren. In den herausgeputzten Vorgärten standen Stiefmütterchen, Tulpen und Narzissen in exakten Winkeln und Kurven um die Rasenflächen gruppiert. Blau, gelb, rot – immer hübsch abwechselnd. Beim Pflanzen hatten sich die Bewohner viel Mühe gegeben, als ob die Blumenrabatten signalisieren sollten: Seht ihr, bei uns ist alles in Ordnung!
Ein Mädchen in Vics Alter rannte unbekümmert knapp vor meinem Auto über die Straße.
In Gedanken sah ich plötzlich die braunen Augen meiner Schwester vor mir, aus denen sonst die Frechheit nur so sprühte, und die Erinnerung holte mich ein. Groß und traurig wie zwei dunkle Sterne hatten sie mich zum Abschied angeblickt. „Denkst du manchmal an Mutter und unsere kleine Wohnung in der Hasselbrookstraße“, fragte sie leise.
„Natürlich!“ Ich wollte ihr über den Kopf streichen, aber sie drehte ihn so energisch weg, dass ihre Baseballkappe leichte Schieflage bekam.
Vic krauste die Nase und zog sie geräuschvoll hoch. Ihr rechtes Augenlid zuckte ein wenig. Sie presste ihre Lippen fest aufeinander, als könnte sie auf diese Weise das verräterische Beben unterdrücken. Vic hasste Heulsusen – eher biss sie sich die Zunge ab, als eine Träne zu verlieren. Aus ihrem Kindergesicht war alle mutwillige Dreistigkeit, die ihr normalerweise den coolen Anstrich einer rotznäsigen Erwachsenen verlieh, weggewischt. Zurück blieb der verwundete Ausdruck eines elfjährigen Mädchens, das nicht verstand, warum die Menschen, die sie am meisten liebte, sie alleine ließen.
Bei Sophie und Thilo ist sie in besten Händen – versuchte ich, mein aufgewühltes Gewissen zu beruhigen. Ich kann ständig nach Hamburg fahren und sie besuchen. Ist ja nicht weit! Es misslang! Ich hatte in ihrem Alter ein richtiges Zuhause gehabt. Wenn auch beengt und bescheiden, so wusste ich doch, wo ich hingehörte. Vic fühlte sich bei Sophie oft nur geduldet. Sie sprach es zwar nie aus, trotzdem ahnte ich, dass in Sophies Musterhaushalt eine vorlaute Elfjährige voller verrückter Einfälle ein störendes Element war. Meine kleine Schwester baute auf mich, und ich enttäuschte sie. Ich war eine Versagerin!
„He, Partner!“ Ich knuffte sie scherzhaft, wie es die Akteure eines von ihr geliebten Actionfilms taten.
Normalerweise knuffte sie dreimal so grob zurück. Damals drehte sie sich um und ging wortlos davon.
Ein Stich fuhr mir mitten durchs Herz und zerteilte es in zwei Hälften. Niemals würde ich das vergessen. Vic, du sollst nicht mehr traurig sein!, schwor ich mir in diesem Moment. Ich werde alles tun, damit du bald zu mir ziehen kannst!
Ich kurbelte die Scheibe ein Stückchen herunter und sog gierig den zarten Blütenduft als Vorboten wärmerer Tage ein. Je weiter ich mich der Dorfmitte näherte, umso älter wurden die Häuser. Ursprünglich hatte es hier offensichtlich nur einige Bauernhöfe gegeben, von denen nur noch die wenigsten landwirtschaftlich genutzt wurden. Stattdessen schienen die Städter den Reiz der roten Backsteinhäuser für sich entdeckt zu haben, um auf dem Lande Nester für junge Familien zu schaffen. Ich holperte über Kopfsteinpflaster. Der Polo hopste, als hätte er Känguruhbenzin gefrühstückt.
Nach viertelstündiger Suche – ich war inzwischen drei Mal am romantischen Dorfweiher vorbeigekommen, hatte drei Mal den Gestank eines riesigen Misthaufens eingeatmet und war drei Mal eine beeindruckende Allee mit Silberpappeln rauf- und runtergefahren – stoppte ich neben einem Mann im dreckigen Overall, der eine Schubkarre voll Stroh über den Bürgersteig bugsierte. „Können Sie mir sagen, wo die Hausnummer 17 ist?“
„Jo!“
„Äh, wo ist sie denn?“
Mit kargen Worten, aber fuchtelnden Handbewegungen beschrieb er mir den Weg. Stirnrunzelnd beäugte er zum Abschied mein Hamburger Nummernschild, als wolle er ausdrücken, dass die Dorfbewohner von all den großkotzigen Städtern, die hier eindrangen, die Nase voll hatten.
Die Hausnummer 17 klebte verschämt am verwitterten Briefkasten einer morschen Gartenpforte. Letzte Farbspuren ließen darauf schließen, dass sie einst tannengrün gestrichen war. Dahinter verbarg sich ein verwilderter Vorgarten, in dem feuchte Laubhaufen vom Herbst lagen. Der Wind spielte mit den Blättern und verteilte sie ungeniert auf den Gehweg. Keine Stiefmütterchen, Tulpen oder Narzissen, dafür rankten Efeu und Wilder Wein an der Fassade des alten Hauses hoch. Sie bedeckten den roten Backstein und reichten bis zum bemoosten Dach. Misstrauisch zog ich den Kopf ein aus Furcht, gleich einige der lose wirkenden Dachpfannen auf mein eigenes Dach zu bekommen. Stattdessen stolperte ich über einen herumliegenden leeren Blumentopf. Scheppernd hüpfte er zur Seite. Ein Sonnenstrahl brach sich auf der blinden Glasscheibe der Fensterfront. An einer Stelle war das Glas gesprungen und notdürftig mit Zeitungspapier geflickt.
Erschrocken zuckte ich zusammen, als sich quietschend neben mir die Eingangstür öffnete.
Im Rahmen stand eine Frau, deren Kopf fast auf der Brust lag, da ein großer Buckel ihren Rücken wie einen Flitzebogen spannte. Sie spreizte ihren knochigen Zeigefinger zum Zeichen, dass ich eintreten sollte. Einen Moment lang zögerte ich, weil mir Hänsel und Gretel einfielen.
Ich folgte ihr in einen dunklen Flur, dem ein muffiger Geruch nach ungewaschenen Körpern, Staub und verwesenden Lebensmitteln entströmte. Die Duftquelle konnte ich wegen der mangelnden Beleuchtung nicht ausmachen. Eine einzelne Glühbirne baumelte an einem losen Draht von der Decke.
Im angrenzenden Raum bot meine greise Gastgeberin mir einen zerschlissenen roten Samtstuhl zwischen gammeligen Möbeln an, die über und über mit halbfertigen Kleidungsstücken und bunten Stoffen bedeckt waren. Vorsichtig entfernte ich ein Stecknadelkissen, das an der Stuhllehne klemmte. Sie war Schneiderin. Ich glaubte kaum, dass sie eine große Kundschaft besaß. Dankend lehnte ich es ab, etwas zu mir zu nehmen. Gleichzeitig nahm ich mir vor, meine Wohnung in Zukunft öfter aufzuräumen, sonst würde ich eines Tages auch als solch alte Schlampe enden.
Die Schneiderin wandte mir ihren Kopf mit dem grauen Filzgestrüpp, das sich im gewaschenen Zustand als Haar entpuppen würde, zu. Auf ihrem von Runzeln zerfurchten Gesicht, in dem erstaunlicherweise anstelle einer Hakennase eine Durchschnittsnase saß, lag ein lauernder Ausdruck, als wüsste sie nicht genau, was sie von mir erwarten könnte. Sie nestelte an ihrem Umhang, der ihre gebeugte, unförmige Figur wohl kaschieren sollte. Dabei öffnete er sich, und eine mehrfach gestopfte Bluse blitzte durch. Entweder war die Frau direkt dem Märchenbuch entstiegen oder hinter der Tür war die versteckte Kamera postiert. Als mich kein Fernsehmoderator aus dieser Umgebung erlöste, konzentrierte ich mich auf die Tiraden, die die Alte ausstieß.
Ihr Vermieter schikaniere sie nach allen Regeln der Kunst, um sie loszuwerden. Nächtliche Anrufe und Drohbriefe. „Er wollte sogar einen meiner Hunde vergiften!“ Ihre trüben Augen füllten sich mit Tränen.
Ich riskierte einen Seitenblick auf die beiden braunen Köter, die hechelnd vor ihren Füßen lagen. Bisher hatte ich versucht, mich durch möglichst unauffälliges Verhalten ihrer Aufmerksamkeit zu entziehen. Besonders vertrauenerweckend fand ich sie nicht.
Die Alte streichelte ihren Lieblingen die glatten Köpfe, schnippte einen unsichtbaren Floh aus dem Fell und jammerte weiter über ihren unmenschlichen Vermieter. Als letzte Schandtat hatte der Unhold Stacheldrahtrollen rings um ihre Terrasse aufgetürmt.
Okay, das gab ein gutes Fotomotiv! Die arme Alte, die anklagend auf den Stacheldraht deutete – so was rührte die Leser. Mit diesen Gedanken an eine herzergreifende Story stolperte ich hinter ihr her durch unzählige Rumpelkammern, in denen ich mehr als eine Rattenzucht vermutete. Ich stieg über leere Konservendosen, räumte Pappkartons zur Seite und kämpfte mit Kleidungsstücken, die plötzlich an den unmöglichsten Stellen von der Decke schlackerten.
Erleichtert atmete ich auf, als wir endlich draußen auf den grauen Waschbetonplatten standen, die die Alte hochtrabend als ‚Terrasse‘ titulierte. Dahinter erstreckte sich ein weitläufiger Garten mit einem Holzhäuschen.
„Da wohnt er.“ Sie zeigte auf ein weißes Haus hinter der Gartenlaube.
Ich begriff, dass ‚er‘ ihr Vermieter war.
Die Stacheldrahtrollen hatte bereits jemand weggeräumt. Sie lagen aufgeschichtet neben dem Holzhaus auf der Seite, die zum Garten des Vermieters gehörte. Wenn ich von einer Idee besessen bin, kann mich nichts groß aufhalten. Kurz entschlossen begann ich, die Stacheldrahtrollen, so gut es ging, wieder vor die Terrasse zu zerren. Gar nicht so einfach! Ich schützte meine Hände mit den überall herumliegenden Lappen und Tüten, ritzte mir aber trotzdem die Finger ein. Keuchend registrierte ich, dass mein Deo versagte. Blut und Schweiß.
In diesem Moment bogen zwei Männer um die Hausecke. „He, was machen Sie da?“
Als ich die Uniform des einen sah, schwante mir nichts Gutes.
Der andere Typ zeterte gleich los: „Aha, so läuft das also! Um mir was anzuhängen, hat sie sich jetzt Helfer besorgt!“ Unzweifelhaft handelte es sich um den boshaften Hauseigentümer. Wut verzerrte sein birnenförmiges Gesicht mit den kleinen Schweinsäugelein und der Knollennase. Er war so Mitte fünfzig. Blass, hager und hoch aufgeschossen funkelte er mich an und zwirbelte an seinem rötlichen Vollbart, den erste graue Fäden durchzogen.
Der rundliche Dorfpolizist zückte diensteifrig sein Notizbuch, um meine Personalien aufzunehmen.
Diese Aktivitäten besänftigten den missgünstigen Vermieter. Er ließ seinen Bart in Ruhe. Sein rechter Arm klappte nach unten. Selbstvergessen fasste er sich an den Schritt. Ein hämisches Grinsen umspielte seine dünnen Lippen und gab ihm etwas Schmieriges.
Na, fein, da war ich ja gleich in das erste Fettnäpfchen getappt!
„Die Volkshochschulen haben ihre neuen Jahresprogramme herausgebracht. Das müssen wir als Aufmacher nehmen“, schlug Gundula vor und betrachtete zufrieden ihre kirschrot lackierten Krallen. Zur Bekräftigung schickte sie Edfried Wagner, der die Themen der morgigen Ausgabe notierte, ein langes Zwinkern. Ihre quäkende Stimme erinnerte an eine Stockente, die glaubte, lauter Küken um sich herum zu haben, die sie bevormunden musste. Das Schweigen ihrer Kollegen wertete Gundula als Zustimmung. „Ich habe eben immer eine Idee.“ Sie gackerte wieder. Dabei zeigte sie ihre großen weißen Zähne, die von Lippenstiftspuren geziert wurden. Beim Lachen wackelte sie mit dem Kopf, sodass die goldene Brille auf und ab wippte. Meinte die Frau das ernst oder spielte sie die Komikerin vom Dienst?
In diesem Moment buchte Gundula mich sicherlich auf die Liste ihrer vermeintlichen Bewunderer, dumm und dreist, wie sie war. Ich hielt mich bescheiden im Hintergrund, getreu der Weisheit: ‚Neue Kollegen sieht man lieber, als dass man sie hört!‘ Später machte ich öfters Bekanntschaft mit Gundulas scharfer Zunge. Um ihre eigene Unfähigkeit zu überspielen, hatte sie sich so eine Art Mutter Theresa-Image zugelegt und meinte, an jeder menschlichen Figur ihr Helfersyndrom ausprobieren zu müssen – ob derjenige nun wollte oder nicht. Tief besorgt, verzog sie dann immer ihre Augen hinter den Brillengläsern zu Schlitzen und äußerte mitfühlend: „Das konntest du ja noch nicht wissen!“ Es klang, als erläuterte sie einem Fünfjährigen Fortpflanzungspraktiken.
Die erste Kostprobe lieferte Gundula in der gleichen Stunde. Auf Herbies Apparat rief der Stacheldrahtvermieter an, von dem sich die schlampige Schneiderin schikaniert fühlte. Natürlich, um sich über mich zu beschweren und mit seinem Anwalt zu drohen.
Gundula witterte ihre Chance. Sie gab Herbie einen Wink. „Lass nur, ich kümmere mich schon darum! Gleich ist Deadline, dein Artikel ist ja noch nicht fertig!“ Im Nu hatte sie Herbie den Hörer aus der Hand gerissen, um glucksend schleimig mit dem Anrufer zu parlieren. „Nein, selbstverständlich schreiben wir nichts.“
Pause.
„Es tut mir leid, wenn Sie Unannehmlichkeiten gehabt haben! Meine junge Kollegin weiß noch nicht Bescheid.“
Kichern.
Und so weiter und so fort. Offensichtlich kannte sie ihn. Sie redete ihn jetzt mit ‚Herr Prange‘ an.
Unruhig saß ich da, streckte ab und an die Hand zum Hörer hin. „Ich kann selbst mit ihm sprechen“, drängte ich im Flüsterton.
Aber Gundula stellte auf Durchzug und ließ mich nicht. „Ach, der!“, meinte sie abfällig, nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte.
Ich dachte, damit sei die Sache erst mal gegessen. Nicht so Gundula, die die Gunst der Stunde augenscheinlich genutzt hatte, um mich beim Chef zu verpetzen.
Er rief mich in sein Büro. „Frau Zöllner sagte, es habe sich jemand über unsere Zeitung beschwert, weil Sie unbefugt gehandelt hätten. Wir sind als loyal und korrekt angesehen und können uns solche Vorkommnisse nicht leisten! Frau Zöllner meinte, Sie hätten es nicht absichtlich getan, sondern würden sich mit Berichterstattung in dieser Form nicht auskennen. Das hat sie sicherlich nett gemeint, nur uns nützt das nichts! Ich habe Sie nicht als Praktikantin, sondern als Redakteurin eingestellt. Und solche Artikel gehören zu unserem täglichen Brot. Mit Gespür und Feinsinn müssen wir die Themen angehen. Wenn Sie das nicht können, habe ich leider keine Verwendung für Sie“, drohte er mit streng gekrauster Stirn, auf der sämtliche Adern kurz vor dem Platzen waren.
Einen Moment lang gaben meine Beine nach. Puddingknie. Nicht schon wieder!, schoss es mir durch den Kopf. Aber eine echte Kämpfernatur lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Retten, was zu retten ist!, lautete jetzt die Parole. Ich riss mich zusammen und erklärte mit zittriger Stimme, dass es mir nur um ein gutes Fotomotiv gegangen sei, um die Geschichte anschaulich zu illustrieren.
Edfried Wagner ließ daraufhin einen kleinen Vortrag über political correctness und Ähnliches ab, das nicht zum Thema passte. Er holte eine Banane aus seinem Jutebeutel und fuchtelte damit umher, um die Bedeutung seiner Worte zu unterstreichen.
Währenddessen sammelte ich wieder Mut. „Ich werde dann nur ein Porträtfoto von der Schneiderin nehmen.“
Diese Ignoranz verschlug meinem Chef die Sprache. Er klatschte die Banane auf den Schreibtisch. Die Schale platzte, Fruchtfleisch quoll hervor. „Sie wollen diese Geschichte trotzdem schreiben? Die bringt uns nur Ärger ein!“
„Die Frau wird wirklich von ihrem Vermieter schikaniert. Sie sagt, er habe sogar versucht, einen ihrer Hunde zu vergiften.“
„Können Sie das beweisen? Ich will keinen Disput mit Anwälten. Das wird teuer und schadet unserem Ansehen!“ Er klaubte die Reste seiner matschigen Banane auf. „Haben Sie das endlich kapiert?“
Ich hatte und schlich mit hängenden Schultern an meinen Arbeitsplatz zurück.
Gundula schenkte mir ein barmherziges Schwesternlächeln. „Der Alte spinnt manchmal. Den muss man nicht so ernst nehmen!“
Am Abend zeigte mir Herbie die Technik im Keller, wo unsere Texte und Fotos von einem Metteur nach den Umbruchvorlagen auf die Seiten montiert wurden. So was hatte ich noch nie gesehen. Willkommen in den Fünfzigerjahren! Ein richtiges Zeitungsmuseum!
Metteur Willy im blaugestreiften T-Shirt hantierte wie ein Chirurg mit dem Messer in unseren Textausdrucken herum, um sie anschließend Absatz für Absatz sauber auf die Seiten zu kleben. Dazwischen platzierte er Fotos. Fasziniert betrachtete ich Willys Bierwampe, die sich der Tischschräge perfekt angepasst hatte. Vier andere Kollegen waren damit beschäftigt, Anzeigen zusammenzubasteln.
Barbara, die Laborantin, wirbelte hier wie eine Unterirdische umher. Von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, war sie an ihrem dunklen Arbeitsplatz gut getarnt. Für ihre Zukunft sah ich tatsächlich schwarz. In meinem früheren Verlag existierten weder Fotolaboranten noch Techniker. Alles lief auf digitalem Weg direkt ins Druckzentrum.
„Mensch, Herbie, jetzt is‘ es soweit: Bald sitzt der alte Willy auf seinem eigenen Bootssteg und angelt.“ Willy haute Herbie kräftig auf die Schulter, aber der ging nicht in die Knie. Anscheinend war er robuster, als er aussah.
„Willy träumt von einem Grundstück auf dem Gottesanger. Er will dort mit seiner ganzen Familie bauen“, erklärte Herbie mir, als wir wieder nach oben gingen.
„Was ist der Gottesanger?“
„Ein riesiges Gelände hinter dem alten Friedhof, zentral gelegen und gleichzeitig im Grünen. Die Tale fließt unmittelbar vorbei. Bis vor Kurzem gehörte es einer Sekte. Jahrelang hat der Stadtrat versucht, die Glaubensgemeinschaft zu vertreiben und zum Verkauf zu zwingen. Das Grundstück ist nun städtisches Eigentum, wird in mehrere Parzellen unterteilt und als Bauland an die Rosenhagener Bürger verkauft. Jeder Interessent soll die Chance bekommen, ein Gebot für sein gewünschtes Stück Land abzugeben. Das ist momentan unser Topthema, sozusagen der Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Interesses.“
„Wollen da viele Leute bauen?“
„Natürlich, gutes Bauland ist rar. Außerdem ist die Lage optimal. Nur fünf Minuten zur Fußgängerzone mit sämtlichen Geschäften entfernt und trotzdem mitten in der Natur am Ufer der Tale gelegen. Das sind Sahnegrundstücke, nach denen sich viele die Finger lecken. Kein Wunder, dass unsere Abgeordneten jahrelang gegen die Sekte prozessiert haben, um das Land in den Besitz der Stadt zu bringen.“
„Wie haben sie die Sekte weggekriegt?“
Herbie lachte. „Gar nicht! Die Sekte ist auseinandergebrochen, weil der Guru nach Neuseeland auswanderte. Man sagt, er hätte irgendwelchen Dreck am Stecken, weswegen er Rosenhagen überstürzt den Rücken kehrte. Also haben er und seine Anhänger der Stadt das Land zu einem Spottpreis hinterlassen. Und nun können die Quadratmeterpreise in die Höhe getrieben und die leeren Stadtkassen aufgefüllt werden.“ Herbie verzog sein gutmütiges Gesicht wieder zu einem Schmunzeln. „Die offizielle Version lautet anders. Da mimen unsere Politiker die Helden, die die Ungeheuer vertrieben haben. Das wirst du heute Abend live erleben.“ Mein Kollege spielte auf die Stadtratssitzung an, die ich gleich besuchen sollte. Edfried Wagner hatte gemeint, so könne ich mich am schnellsten mit den wichtigen Themen und Leuten der Stadt vertraut machen.