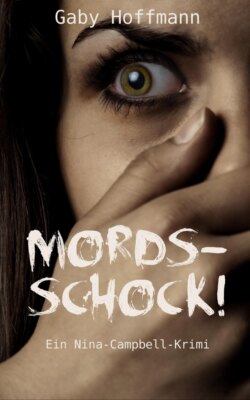Читать книгу Mordsschock! - Gaby Hoffmann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5
ОглавлениеIch lief über den kopfsteingepflasterten Marktplatz zur Fußgängerzone. Wenn man ein Herz für so was hatte, wirkten die alten Häuser und das Rathaus drum herum idyllisch. Eng schmiegten sie sich aneinander. Manche sahen ein wenig schief aus, als würden sie jeden Moment absacken. Aber so hielten sie dem Lauf der Geschichte seit vielen Jahrzehnten stand und überlebten zig menschliche Generationen.
Die eingravierte Jahreszahl 1891 über einer Haustür stach mir ins Auge. Die meisten Gebäude der Stadt stammten aus dieser Zeit. In den letzten Jahren waren offensichtlich viele der roten Backsteinfassaden erneuert worden. Man hatte sich mit Accessoires wie weißen Stuckornamenten und Sprossenfenstern Mühe gegeben, die ursprünglichen Gesichter der Häuser zu erhalten. Dazwischen wurden sie gestützt von neueren Gebäuden aus der Nachkriegszeit, die durch ihre Kastenformen neben den schlanken alten Häusern plump und derb wirkten. Sie beherbergten rund um den Marktplatz einen Blumenladen, einen Bäcker, eine Boutique, einen Bastelladen und ein Schuhgeschäft. An der Ecke zur Fußgängerzone lag ein weißes Café mit geschwungenen hohen Bogenfenstern in leuchtendem Türkis und mit einer gläsernen Fassade. Marktcafé leuchteten die Neonbuchstaben über dem Eingang. Ein bisschen Stilbruch – genau wie der Supermarkt gegenüber und die weißen Drahtbänke unter den Platanen.
Am Brunnen trafen sich Hausfrauen und Rentner zum Klönen. Aus gusseisernen Fischköpfen plätscherte das Wasser in das gemauerte achteckige Rondell. In der Mitte des Beckens stand eine Säule, auf der ein schmiedeeisernes Mädchen mit Zöpfen thronte. Im Arm trug sie eine Ente. Es sah so aus, als bewache sie das dahinterstehende weiße Rathaus.
Die weißen Säulen am Portal unter dem goldfarbenen Wort ‚Rathaus‘ erinnerten an eine Südstaatenvilla. Auch der zierliche, von Säulen eingerahmte Balkon und die Stuckformen der Jahrhundertwende versetzten mich in Erwartung, gleich Scarlett O’Hara heraustreten zu sehen. Nur die kleine Rathausuhr und das schwarze Dach passten nicht recht dazu.
Plötzlich wurde die Idylle gestört. Kreischend wichen die Passanten, die eben ein gemütliches Schwätzchen neben dem Brunnen hielten, zurück. Ein struppiger, schwarzer Mischlingshund war in das Wasser gesprungen, sodass es nach allen Seiten spritzte. Genießerisch ließ er sich nun mit hechelnder Zunge von den gusseisernen Fischköpfen besprengen. Nach dem Bad schüttelte er sein nasses Fell ausgiebig. Im hohen Bogen flogen die Tropfen dabei nach links und rechts.
Sein Herrchen nahm ihm diese Rücksichtslosigkeit nicht übel. „Bobby, du Drecksack!“, sagte er und tätschelte ihn zärtlich. Er trug einen schwarzen Schlapphut, von dem eine lange grüne Perlenkette herunterbaumelte. Er verdeckte das Gesicht des Mannes beinahe, nur der gezwirbelte Schnurrbart guckte heraus. Im Zusammenspiel mit der auffallenden Kopfbedeckung wirkten das blaue T-Shirt und die schwarze Hose bieder.
Der Mann parkte sein klappriges Fahrrad neben dem Brunnen. Auf dem Gepäckträger klemmten zusammengerollte Wolldecken und Handtücher, die Lenkstange bewachte ein großer brauner Teddy. Der Mann nahm einen tiefen Schluck aus einer Bierdose und stellte sie dann auf den Brunnenrand. „Weißt du, Bobby“, erklärte er seinem nassen Hund, „irgendwann sind wir reich, dann kaufen wir uns ’ne Villa.“
Der Hund schüttelte sich wieder.
Sein Herrchen kickte die leere Bierdose in den Brunnen. „Bobby, pass schön auf das Fahrrad auf! Wenn einer klaut, beiß!“, ermahnte er den Hund und verschwand in den Supermarkt.
Ich fühlte mich mit dem Gammler verbunden – ich war in dieser bürgerlichen Wohlanständigkeit genauso ein Fremdkörper wie er. Jederzeit könnte ich mein Hab und Gut auf dem Gepäckträger eines Fahrrades verstauen – wenn ich denn eines besitzen würde. Das hatte er mir voraus. Leider gab es noch einen entscheidenden Unterschied zwischen uns: Der Gammler kannte seine Gesetze, wusste, zwischen Träumen und Realität zu unterscheiden. Er war genügsam, ich nicht. Er stand zu seinem Leben, ich lief meinem hinterher.
Ich hastete durch die Fußgängerzone mit den Geschäften links und rechts, folgte dem Lauf der Biste. Oder war das hier schon die Tale? Ich hatte das mit den Flüssen noch nie verstanden. Hinter der Brücke erblickte ich am Wanderweg ein riesiges kastenförmiges Gebäude: das Finanzamt, dahinter lag die Polizei. Auf der anderen Seite befand sich der alte Friedhof, dessen Gräber neulich von Neonazis mit Hakenkreuzen verschandelt worden waren – ich erinnerte mich an Jelzicks Artikel darüber. Die Tale floss hier als richtig breiter Fluss an mit Bäumen und Büschen bewachsenen Grasflächen entlang. Das war also das Gelände des Gottesangers.
Im Schilf tummelten sich Blesshühner und Enten. Sie schnatterten, quakten und quietschten so aufgeregt, als sammelten sie sich bereits zu einer Protestdemo gegen die geplante Bebauung ihres Reviers. Die Sonne knallte mit der ganzen Kraft, zu der sie im Frühling fähig ist, auf das braune, unergründliche Wasser. Es roch leicht faulig. Hohe Silberpappeln und Birken, die sonst Schatten spendeten, waren kahl. Efeuranken hielten die Stämme fest im Griff. Nur die gelben Papierkörbe und die Kühe auf den welligen Wiesen am anderen Ufer signalisierten die nahe Zivilisation. Und nun rollten bald die Bagger und walzten das Stückchen Idylle platt! Frau Hanselmanns Bedenken fand ich in diesem Moment plausibel.
„Ja, jetzt müsste man jung sein!“
Erschrocken guckte ich hoch.
Vor mir stand ein alter Mann. Die Einkaufstüten im Arm deuteten darauf hin, dass er mir von der Stadt aus gefolgt war. „Ist das nicht schön? Hier ein Häuschen am Fluss zu haben, ist ein Traum! Die hätten mal zwanzig Jahre früher diese Lumpen vertreiben sollen! Dahinten haben sie gehaust.“ Er zeigte den Weg hinunter, wo ich die Überreste eines verfallenen Gebäudes entdeckte, das Büsche und Efeu bereits überwucherten.
„Sind die schon länger weg?“
„Ja, nur das Gelände wollten sie bisher nicht aufgeben. Ein Jammer, jetzt bin ich zu alt, um neu zu bauen.“
Ich holte meine Kamera heraus und knipste das Areal, auf dem so viele Hoffnungen ruhten, von allen Seiten. Die Entendemo löste sich auf, die Vögel paddelten flussabwärts.
Hätte ich in diesem Moment gewusst, wie viel Blut wegen dieses Stücks Land vergossen werden würde, wäre ich in die Tale gesprungen und den Enten hinterher geschwommen!
Während der Redaktionskonferenz wurde mir eine unerwartete Ehre zuteil: Da keiner eine besonders hitverdächtige Geschichte in petto hielt, wurde der Gottesanger Aufmacher.
Ich glaubte, ein leises Zähneknirschen aus Gundulas Richtung zu hören. Stolz setzte ich mich an meinen ersten Aufmacher. Ich schrieb eine Jubel-Geschichte über die gestrige Sitzung: Alle waren glücklich und zufrieden – die Politiker, weil sie die Sekte vertrieben hatten, und die Bürger, weil sie auf gute Grundstücke hofften. Man durfte mit der Wahrheit nicht allzu pingelig sein, wenn man eine Zeitung im Sinne der Leser konzipierte.
Wagner kam aus der Mittagspause, warf einen Blick auf den Artikel und war zufrieden. Außerdem schlug es gerade 15 Uhr, die Zeit, wo er sich auf den Heimweg machte und sein Stimmungsthermometer meistens automatisch nach oben kletterte. Er klemmte seinen Jutebeutel unter den Arm, hängte sich das knitterige Leinenjackett über die Schulter und verschwand pfeifend über die knarrenden Holzstiegen zum Ausgang. Nicht ohne dass die dicke Riechling wie stets hinter seinem Rücken den Kopf schüttelte.
Als er die Eingangstür von der anderen Seite zuschlug, kam Bernd aus der Technik angerannt und rief: „Chef, wir haben Probleme mit der Eins!"
Mit gerunzelter Stirn brach Wagner seinen Feierabend ab und wanderte in die unteren Räume. Kurze Zeit später verlangte er nach mir.
Mitleidig guckten mich meine Kollegen an.
„Wo sind die Fotos vom Gottesanger?", herrschte er mich an.
„Das weiß ich nicht. Die Abzüge waren vor zwei Stunden schon fertig", antwortete ich ahnungslos.
Das war meinem Chef egal. Er hörte nicht mehr zu, sondern tobte weiter. Sein hageres Gesicht war vor Anstrengung ganz eingefallen, dünne Adern traten stark hervor.
„Die Seiten müssen gleich weg. Wir können die Eins nicht ohne Foto erscheinen lassen!"
Fieberhaft durchsuchte ich alle Ablage-Körbe, Regale und Sonstiges in der Nähe. Vergeblich. Die Fotos blieben verschwunden. Leider schob Barbara nur einen Halbtagsjob, gegen frühen Nachmittag hatte sie meistens alle Abzüge fertig und ging nach Hause. Sie konnte mir also nicht helfen. Dabei war ich mir sicher, meine Bilder als Kopien und fertig zum Aufkleben auf die Seiten in der Technik gesehen zu haben.
Das interessierte meinen aufgebrachten Chef herzlich wenig. „Verflixte Schlamperei! So was können wir uns nicht leisten. Um alles muss man sich selbst kümmern, sonst klappt nichts“, jammerte und schimpfte er gleichzeitig. Seine Figur umgab er dabei mit einem Märtyrerschein, sodass ihn jeder Außenstehende stark bedauert hätte: ein Chef, der zwangsweise alles alleine regelte, weil er von einem Haufen Idioten umgeben war!
Gundula ließ sich diese Szenen natürlich nicht entgehen. Beschwichtigend strich sie dem entnervten Wagner über den haarigen Arm und murmelte halblaut: „Wir dürfen sie eben nicht überfordern. Es war doch ihr erster Aufmacher."
Aber der Chef ließ sich nicht beruhigen, schließlich mussten die Seiten ja in die Druckerei, seine schöne Eins war bisher eine reine Bleiwüste.
Zufällig fiel mein Blick auf die hinter dem Chef lauernde Gundula, die entgegen der angespannten Situation seltsam zufrieden wirkte. Hatte die was mit dem Verschwinden meiner Bilder zu tun?
Als Retter in der Not tauchte Herbie auf. Das Theater hier unten war mittlerweile in die Redaktionsräume hochgedrungen. „Wir können meine Bilder von der Tierschau nehmen. Barbara hatte sie schon für morgen fertig gemacht. Mit einem Bild reißen wir den morgigen Artikel einfach auf der Eins an“, schlug er vor.
Wagner japste erleichtert und keuchte: „Los schnell, so machen wir es!“ Langsam wich die Röte aus seinem Gesicht, die Adern schwollen ab. Wahrscheinlich sank auch sein Blutdruck wieder.
Ich empfand in diesem Moment warme Gefühle für Herbie, der die Treppen raufraste, um die neue Bildunterschrift in den Computer zu hacken. Hacken war übrigens das richtige Wort für Herbies Art und Weise, die Tastatur zu malträtieren. Ich hatte nie jemanden gesehen, der so schnell schrieb und dabei gleichzeitig so einen tönenden Anschlag erzeugte.
Geknickt packte ich meine Sachen zusammen. Das falsche Gepfeife von Gundula, die zu einer Pressekonferenz abzog, erinnerte mich wieder an meinen Verdacht.
Wagner kam nach oben und zitierte mich prompt in sein Büro, um mir eine gepfefferte Standpauke zu halten. Jeder müsste sich darum kümmern, dass die Fotos vollständig zu den Texten vorhanden wären, schließlich seien wir kein Kindergarten und und ... Seine Rede entwickelte die Dimension einer Abmahnung.
Mir wurde ganz heiß, während ich gleichzeitig bis in die Zehenspitzen fror. Plötzlich flutschten mir Worte raus, die ich besser für mich behalten hätte: „Ich schwöre, die Abzüge lagen neben den Texten. Es muss sie jemand mit Absicht weggenommen haben. Ich ...“
Wagner fiel mir ins Wort. „Ach, Unsinn! Wer tut so was?“
„Fragen Sie Frau Zöllner! Sie ist nicht gut auf mich zu sprechen. Und vorhin war sie lange unten bei Willy. Ihr würde ich zutrauen, dass ...“ Der Rest meiner Anklage blieb mir im Halse stecken, als ich das finstere Gesicht meines Chefs sah.
„Haben Sie Beweise?“
Aufgrund seiner eiskalten Stimme hielt ich es für klüger, einen Rückzieher zu machen. „Bitte, vergessen Sie, was ich gesagt habe!“ Ehe er antwortete, verließ ich das Büro und bereitete mich seelisch auf meine zweite Kündigung innerhalb von drei Monaten vor.
Im Laufe des nächsten Tages versuchte ich krampfhaft, unsichtbar zu sein.
Mein bedrücktes Gesicht fiel der Riechling auf. Sie bot mir eine Krokantpraline an und fragte neugierig: „Sie haben wohl Ärger?"
Die Praline quoll in meinem Mund zu einem Hefekloß auf.
„Sicher mit Gundula. Die gönnt ja keinem was. Als ich mal früher nach Hause bin, wegen eines Arzttermins, hat sie mich gleich angeschwärzt. Von wegen – das ständige Telefonklingeln wäre nicht zum Aushalten. Und sie habe sich geopfert und meinen Dienst neben ihren zahlreichen anderen Aufgaben mitübernommen.“ Zärtlich streichelten die Blicke der Riechling ihre Pralinen. Sie zog ein viereckiges Stück Nussnougat aus der Schachtel und steckte es sich langsam und genussvoll in den Mund. Während sie kaute, glühten ihre teigigen Wangen glücklich. „Wissen Sie, dass die in den Chef verliebt ist? Die schmeißt sich an die Männer ran. Neulich hat sie ...“, die Dicke flüsterte mir Klatsch ins Ohr, ihre schokoladige Nussnougat-Fahne lullte mich ein.
In solchen Momenten mahnte mich eine innere Stimme: Pfui, Tratschen ist schlecht, hat deine Mutter gesagt! Gleichzeitig tönte eine weitere Stimme in mir: Es gehört sich nicht, bringt aber unheimlichen Spaß! Und jetzt hatte ich quasi Narrenfreiheit. Seit gestern reihte ich mich in die Reihe der schlimmsten Klatschbasen ein: der Petzen! Schlimmer – der Petzen, die Gerüchte ohne Beweise aus dem Bauch heraus verbreiten!
Nachmittags nahm mein Fall eine überraschende Wendung. Jelzick fuchtelte mit einer Ausgabe unserer heutigen Zeitung herum. Ein breites Grinsen stand auf seinem fetten Gesicht, und das zu kurze Sweatshirt rutschte auf halb vier nach oben, woraufhin sein schwabbeliger Käsebauch hervorblitzte. „Ich habe deine Fotos gefunden! Die, die du gestern überall gesucht hast. Hättste gar nicht gebraucht, die sind schon drin.“
„Wo drin?“
„Na da, wo sie reingehören. In unserer Zeitung!“ Triumphierend hielt er mir die Ausgabe unter die Nase.
Auf der Eins rangierte mein Aufmacher über den Gottesanger. ‚Von Nina Campbell‘ stand darunter. Normalerweise wäre ich jetzt stolz gewesen, aber aufgrund des gestrigen Vorfalls freute ich mich nicht. Meine Fotos vom Gottesanger entdeckte ich nicht. Ich blätterte die Zeitung durch.
Jelzick riss mir die Zeitung aus der Hand, blätterte weiter und stupste ungeduldig auf eine Stelle. „Na guck doch, da!“
Tatsächlich meine Fotos! Nicht auf Seite eins, sondern auf Seite sechs. Und auch da an einem ungewöhnlichen Ort. ‚Fortbewegung der leichten Art‘, stand verlockend über einer C&A-Anzeige für Schuhmoden. Darunter klebten aufgefächert meine Fotos. Statt modischer Treter erschien versetzt immer wieder der Gottesanger. Ich muss sagen, das Ganze sah ungemein künstlerisch aus und peppte die Anzeige enorm auf.
Der findige Jelzick hatte natürlich auch gleich des Rätsels Lösung – ein Polizeireporter ist eben ein halber Detektiv. „Da hat Willy wohl mal wieder den Bauchkleber gemacht!“
Offensichtlich hatte Willy, der seinen umfangreichen Bauch gerne auf die Tischkante stützte, die selbstklebenden Fotos nichtsahnend auf diese Weise an der falschen Stelle platziert. Ich wusste nicht so recht, ob ich lachen oder weinen sollte. Hätte ich bloß nichts über Gundula gesagt, dann wäre ich jetzt aus dem Schneider.
„Nun guck bloß nicht so trübsinnig aus der Wäsche! Du hattest die Fotos ja nicht verschusselt“, tröstete mich der ahnungslose Jelzick.
Herbie wuchs heute, sobald er in meine Nähe kam. Er reckte sich auf die Zehenspitzen, straffte die Schultern und fragte mit belegter Stimme: „Du bist neu in der Stadt und kennst sicherlich noch nicht viele Leute hier. Hättest du nicht Lust, heute Abend bei mir vorbeizukommen? Wir könnten ein Glas Wein trinken.“ Als ich nicht sofort antwortete, schob er hastig hinterher: „Meine Frau ist mit den Kindern verreist.“
Aha, daher wehte der Wind. Da fiel mir etwas ein: „Hast du ein richtiges Haus mit allem drum und dran?“
Verständnislos guckte Herbie mich an.
„Ich meine mit Terrasse, Einbauküche, Badewanne ...“, zählte ich harmlos auf, wobei es mir nur auf Letzteres ankam.
Herbie nickte verwundert.
„Ne, das finde ich klasse, wenn man so was hat!“, begründete ich meine seltsame Fragerei. „Also um neun bin ich da!“
Mein Kollege strahlte, bildete ich mir zumindest ein. Jedenfalls beflügelte mich meine weibliche Attraktivität und weckte neue Lebensenergie. Ich lieh mir von Herbie 20 Euro, um endlich das Sparbuch für Vic zu eröffnen. Leider rann mir Geld immer durch die Finger. Ich gab es schneller aus, als ich es verdiente. Für Klamotten, Zigaretten, Drinks und was weiß ich ... Das musste anders werden – Sparbuch war ein super Anfang!
Die Rosenhagener Oberschicht beschränkte sich auf zwei Wohnalternativen. Entweder das großzügige Anwesen im grünen Vorort oder die exklusive, toprenovierte Jugendstilvilla im Zentrum. Daran konnte Herbie mit seinem weißen Bungalow am Stadtrand nicht kratzen, aber die relativ neuen Einfamilienhäuser der Siedlung am Beimermoor signalisierten ganz passable Gehälter der Anwohner. Bonanzafahrräder, Gokarts, Bobbycars, Sandkästen und Schaukeln ließen auf eine kinderreiche Nachbarschaft schließen. In den meisten Carports parkten zwei Autos: der Mercedes für ihn, der Kleinwagen oder Kombi für sie – spekulierte ich klischeehaft. Eine Kolonie der Besserverdienenden.
Mir blieb nur eine möblierte Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhauswohnblock gegenüber vom städtischen Parkhaus, die stark an meinen finanziellen Möglichkeiten schabte und mich ständig mit dem Kohleintopf-Geruch meiner Nachbarin belästigte.
Gegen Fremdgerüche war Herbie gefeit – den Abstand zu den Häusern links und rechts regulierten einige hochgewachsene Kiefern und ein Zaun. So ein kleines Häuschen mit Garten wäre für Vic und mich genau das Richtige ...
Ich verscheuchte meine Hollywoodfamilienträume und klinkte die weiß lackierte Pforte auf, die in einen gepflegten Garten mit der typischen Stiefmütterchen-Narzissen-Tulpen-Gruppe führte. Eine gelb blühende Forsythie lockerte das Bild farblich auf. Es dämmerte schon. Plötzlich hörte ich seltsame, hohe Schreie. Hinter der Asphaltstraße, die durch die gesamte Siedlung lief, führte ein Sandweg an einem kleinen Teich vorbei direkt ins Moor. Aus dieser Richtung kamen die Schreie. Es klang gespenstisch, als sei die friedliche Idylle glücklicher Familien bedroht. Ich fröstelte. Rasch ging ich an einigen feinsäuberlich aufgereihten Buchsbäumen in Kübeln vorbei und klingelte.
„Was sind das für unheimliche Töne?“, fragte ich Herbie anstatt einer Begrüßung.
„Die ersten Auerhähne auf der Balz. Brunftschreie.“
„Hua, klingt ja schaurig!“ Ich schüttelte mich und trat mir ohne Aufforderung die Füße auf einer Bastmatte ab. Der rote Steinboden des Vorflurs glänzte so, dass ich bedenkenlos dort ein Picknick veranstaltet hätte. Kein Kinderspielzeug auf dem hellen Parkett, keine Zigarettenkippen in Blumentöpfen, kein schmutziges Geschirr auf den Tischen. Der blaue Teppich sah gesaugt aus, die blaugemusterte Garnitur war fleckenlos und die weiße Schrankwand staublos.
„Wie aus der Werbung!“, lobte ich Herbie, der mich sportlich leger im karierten Holzfällerhemd und Jeans empfing. Zwischen einer blütenweißen Häkeldecke und einem gedrechselten Kerzenhalter hatte er auf dem Couchtisch eine Flasche Beaujolais mit zwei Gläsern und diverse Knabbersachen deponiert. Im Hintergrund säuselte eine Klassik-CD.
„Willst du die Kerzen nicht anzünden? Das finde ich obergemütlich!“, fragte ich meinen Gastgeber und sank in einen der tiefen, beigefarbenen Sessel. Dieses Modell hatte Herbies Gattin sicher extra ausgewählt, um ihren ohnehin schon schmächtigen Mann mehr zu ducken.
Während Herbie nervös mit einem Feuerzeug herumfummelte, heimlich seinen angekokelten Daumen abpustete und im Sessel verschwand, lenkte ich ihn auf sichere Pfade. Sein Vorrat an Mut schien mit der Einladung an mich aufgezehrt. „Politik war mir bisher egal. Ich glaube, ich bin das, was man eine Wechselwählerin nennt. Mal hier, mal da – das passt schon! Aber diese Typen von den Konservativen sind ja echt nett. Haben sich bei der Sitzung gleich vorgestellt. Und dann die Einladung von Ken Winter zu der Party.“ Ich schickte ihm einen naiven Augenaufschlag.
Es funktionierte. Herbie wuchs im Sessel. Ein unverfängliches Thema, bei dem er seine Überlegenheit ausspielte. „Na klar, das ist normal. Die Opposition macht stets die bessere Pressearbeit. Sie wollen ans Ruder. Dazu brauchen sie natürlich jede Menge PR. Am besten wäre für ihren Stimmenfang irgendein von der Regierung verzapfter Bockmist, mit dem sie dann hausieren gehen können.“
„Dieser von Stetten will wohl Huber ablösen und Bürgermeister werden?“
„Logisch, nächstes Jahr sind Wahlen. Da geben die Konservativen jetzt richtig Gas.“
„Und dabei sind zwei von ihnen auf der Strecke geblieben ...“
„Du meinst die Toten in der Kieskuhle? Tja, der Ehrgeiz bei den jungen Leuten in der Partei ist enorm, das lässt manche vielleicht privat aus dem Ruder laufen. Schaffen sie es nächstes Jahr, werden jede Menge gute Pöstchen neu verteilt. Das baut Druck auf, viele wollen sich profilieren. Aber ich glaube, es ist einfach ein makabrer Zufall, dass beide in der gleichen Partei waren. Du darfst nicht vergessen, wir leben in einer Kleinstadt. Viele Leute sind politisch engagiert oder in Vereinen. Merkwürdige Zufälle sind hier normal.“
„Wir haben als Jugendliche so lange die Luft angehalten, bis wir ohnmächtig wurden. Am besten ging es, wenn man den Kopf fest in einen leeren Müllsack steckte. Wer als Erster umkippte, hatte gewonnen. ‚Ins Koma fallen‘ haben wir das Spiel genannt. Vielleicht gibt’s bei den jungen Konservativen auch so einen Gruppenzwang? Aus Langeweile kommen manche auf die verrücktesten Ideen.“
„Ein Spiel mit tödlichem Ausgang?“ Herbie schüttelte den Kopf. „Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu weit hergeholt, nur weil sie Parteikollegen waren. Außerdem handelt es sich nicht um Jugendliche. Beide waren schon Anfang zwanzig. Schaut mir eher nach Selbstmord aus.“
„Freunde von mir sind früher regelmäßig zum Cruisen auf einen alten Schrottplatz gefahren. Kann doch sein, dass sich die Jungpolitiker in der Kieskuhle getroffen haben. Dabei geschah ein Unfall, die anderen haben kalte Füße bekommen und sind abgehauen.“
„Davon habe ich noch nie was gehört.“
Einen Moment lang sah ich wieder die Augen des toten Peter Heimann vor mir. Irgendetwas faszinierte mich an ihnen. Groß mit dunklen Pupillen, in denen jeweils ein helles Pünktchen blitzte. Ich vermochte sie nicht aus meinem Gedächtnis zu streichen. So jung blieben sie nun für ewig geschlossen.
Ich schüttelte diese Gedanken ab und wollte ein bisschen Klatsch aus Herbie herausholen. Das gelang nur zäh. Die Riechling war da anscheinend eine dankbarere Quelle. „Hast du den Eindruck, dass Gundula in unseren Chef verknallt ist?“
Herbie kraulte die Überreste seines spärlichen Haarschopfes, nahm einen großen Schluck Wein und kräuselte beim Kauen die Lippen. „Hinter mir war sie auch mal her! Natürlich ohne Chance!“ Stolz rutschte er im Sessel nach vorne.
Das war der richtige Zeitpunkt, um an mein Ziel zu gelangen. Ich schlug meine Beine übereinander, die der kurze Mini entblößte, und flötete: „Ach, die nicht?“
Mit Vergnügen bemerkte ich hektische rote Flecken, die über seinen Hals huschten.
Er räkelte sich unruhig. „Hm, filigrane Beine!“
„Genau das hat Erin Schulz auch gesagt.“ Stolz erinnerte ich mich an die Komplimente des Stardesigners, den ich interviewt hatte. Herbie blickte mich verständnislos an.
„Mir ist kalt, darf ich ein bisschen ranrutschen?“ Scheinbar schüchtern kuschelte ich mich an. Leichter Moschusgeruch kroch mir in die Nase, damit wollte er zweifellos seine Männlichkeit unterstreichen.
Herbie tastete zögerlich nach meiner Hand.
Ich setzte mein verführerischstes Lächeln auf und flüsterte: „Herbie, ich liebe es, vorher ein Wannenbad zu nehmen. Das ist hinterher so romantisch, wenn alles gut duftet. Und wo mir so kalt ist. Darf ich?“
Wenig später stand ich in dem weiß gekachelten Badezimmer, das ähnlich steril wie die übrige Einrichtung wirkte. Nichts auf den Ablagen erinnerte daran, dass hier Menschen lebten. Alle Kosmetika befanden sich offensichtlich in den Schränken. Beschämt dachte ich an meine vollgemüllte Ablage im Bad. Ich leerte meine Tasche und schüttete eine halbe Flasche Schaumbad in die Wanne. Jetzt zwei Sprudeltabletten in das heiße Wasser und hinein ins Vergnügen! Herbie hatte mir einen tragbaren CD-Player ausgeliehen, in den ich meine Entspannungs-CD packte. Das Glas Wein stellte ich auf den Badewannenrand.
„Du darfst mich nicht stören. Sonst komme ich nicht in Stimmung!“, rief ich säuselnd das Treppenhaus hinunter in Richtung meines Gastgebers.
Herrlich das Gefühl, in das heiße Wasser einzutauchen! Es ging nichts über einen schönen Badewannenabend! Ich lag da, ließ den Schaum um mich herum perlen, genoss die massierende Wirkung der Sprudeltabletten, atmete die ätherischen Öle ein, trank Wein, hörte Musik und hatte es einfach wonnig. Etwas nervig natürlich, dass mein verhinderter Liebhaber nach einer halben Stunde ungeduldig wurde und gegen die Tür klopfte. Ich beschwichtigte ihn mit meiner zauberhaftesten Stimme und aalte mich eine weitere Viertelstunde in der Wanne.
Und dann passierte das, was ich aus unzähligen Soaps kannte, nie aber geglaubt hätte, es selbst zu erleben. Ich hörte Schritte und Stimmen im Treppenhaus.
„Ich muss ganz dringend pullern!“, kreischte eine helle Kinderstimme.
Ehe ich mich in Bewegung setzen konnte, wurde die Tür aufgerissen: Ein rothaariger sommersprossiger Bengel von ungefähr sieben Jahren stürmte in das Bad. Ohne mich wahrzunehmen, riss er den Klodeckel hoch und pinkelte in das Becken.
Angewidert rümpfte ich die Nase. Ade meine schönen Wohlgerüche! Das pralle Leben holte einen überall ein.
Als er seinen Sturzbach beendet hatte, fiel sein Blick auf mich in der Wanne.
Ich winkte ihm freundlich zu.
Er riss seine Kinderaugen auf und brüllte los: „Aiiiiiii! Mami, da sitzt ’ne fremde Frau in der Wanne.“
Mit runtergelassener Hose stürmte er aus dem Bad.
Ich stieg aus der Wanne, um mich abzutrocknen. Inzwischen zog es wie Hechtsuppe, weil die Tür sperrangelweit offen stand.
Auf der Treppe wurde gestritten. „Max! Du sollst mich mit deinen albernen Fantasien in Ruhe lassen. Ich bin die ganze Strecke alleine durchgefahren, um Papi zu überraschen. Ich bin jetzt müde und habe keine Nerven für deine Spinnereien“, sagte eine strenge Frauenstimme.
Max plärrte und schrie: „Da ist wirklich ’ne Frau in der Wanne. Immer sagst du, ich lüge. Aber ich lüge nie! Guck!“ Der wahrheitsliebende kleine Kerl zerrte seine Mutter ins Bad.
Ich stand so da, wie ich einst auf die Welt gekommen war. Ich schlang ein Handtuch um die intimsten Körperteile. Mehr aus Rücksicht auf die jugendlichen Augen von Max als auf die seiner Mutter. „Guten Abend“, begrüßte ich die erschrockene Frau.
Entsetzt starrte sie mich an. Stand ihr nicht schlecht. Es passte zu ihrer blonden Hochsteckfrisur, den blauen Augen und der schlanken Figur in Pulli und Jeans. Leider war sie nicht viel reifer als ihr Sprössling, denn prompt kreischte auch sie mit hoher Stimme: „Ahiiiiii! Herbert, wer ist das denn?“
Ihr Ehemann klammerte sich inzwischen mit mulmigem Gesicht am Türrahmen fest und betrachtete skeptisch die Begrüßungsszene. „Darf ich vorstellen, das ist meine neue Kollegin. Sie kennt noch nicht so viele Leute, und da dachte ich ...“, stotterte er.
Ehe Herbie sich selbst ins Unglück redete, unterbrach ich ihn. „Die Sache ist die: Ich habe in meiner neuen Wohnung keine Badegelegenheit. Und da war Ihr Mann so freundlich, mich hier baden zu lassen.“
Weil ich wenig Lust verspürte, einem Ehekrach beizuwohnen, zog ich mich in Windeseile an und verließ das gastliche Haus.