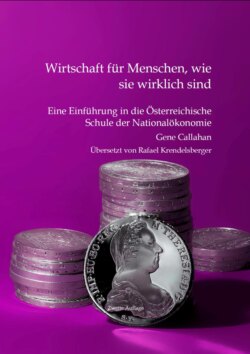Читать книгу Wirtschaft für Menschen, wie sie wirklich sind - Gene Callahan - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Entstehung des Wertes
ОглавлениеNun, Rich ist also alleine auf der Insel und weiß nicht, ob und wann er gerettet werden wird. Welche Einblicke kann die Ökonomie aus dieser Situation gewinnen?
Zuerst muss Rich ein Ziel für seine Zeit auf der Insel finden. OK, für den Moment steckt er dort fest. Akzeptiert man das als Rahmenbedingung, was soll er dann tun? Die Antwort auf diese Frage besteht darin, ein Ziel festzulegen. Vielleicht liegt sein Ziel darin, zu überleben, bis er gerettet wird. Während dieses Ziel rational genug erscheint, müssen wir uns vor Augen halten, dass andere ebenso möglich sind. Vom Standpunkt der Ökonomie aus ist kein besonderes Ziel mehr oder weniger gültig (um einen wichtigen Aspekt noch einmal zu betonen: das bedeutet nicht, dass die Ökonomie aussagt, dass ein Wertsystem gleich gut ist wie irgendein anderes. Ökonomie versucht einfach nicht, auf die Fragestellung einzugehen, was wir wertschätzen sollen).
Nehmen wir einmal an, dass Rich ein ergebener Anhänger der Religion des Jainismus sei. Es verstößt gegen seine religiösen Prinzipien, einem lebenden Wesen etwas zu Leide zu tun. Während er eine Kokosnuss oder zwei zusammenkratzen kann, wird ihm klar, dass er langsam verhungern wird, wenn er darauf verzichtet, die Ratten, die es auf der Insel im Überfluss gibt, zu grillen. Und doch lebt er nach seinen Prinzipien. Bedeutet das, dass Rich Ökonomie ignoriert oder sich irrational verhält? Während manche Schulen der Ökonomie „Ja“ sagen würden, lautet die Antwort für einen Österreichischen Ökonomen entschieden „Nein“. Rich verfolgt einfach das Ziel, das er am höchsten bewertet, nämlich das, an seinem religiösen Glauben festzuhalten.
Wie auch immer, nehmen wir einmal an, dass Rich jetzt das Überleben als sein eigentliches Ziel auserkoren hat. Für sein Überleben braucht er Wasser, Nahrung, ein Dach über dem Kopf und Erholung. Das sind die Mittel, mit denen er sein Ziel zu erreichen hofft. Unterkunft hat er sich allerdings noch keine gebaut. Nahrung ist zwar verfügbar, aber über die ganze Insel verstreut und nur mit einiger Mühe zu sammeln. Es gibt Quellen, aber nur mit einer geringen Schüttung an Frischwasser.
Weil Rich noch andere Mittel einsetzen muss, um an Wasser, Essen, eine Unterkunft und an Erholung zu kommen, sind diese selbst untergeordnete Ziele geworden. Essen ist ein Mittel bezogen auf das Ziel „Überleben“, aber ein Ziel, das durch das Mittel des Rattenfanges angestrebt wird. Dasselbe Gut kann vom Blickpunkt des Planes A ein Mittel sein und ein Zweck vom Blickpunkt des Planes B.
Also findet sich Rich in einer Situation wieder, die der aller anderen Menschen ähnlich ist: Er strebt einige Ziele an, hat aber nur begrenzte Mittel zur Verfügung, um diese Ziele zu erreichen. Er muss mit seinen Mitteln haushalten, um die vorrangigen Ziele erreichen zu können. Wenn er zum Beispiel seine ganze Zeit darauf verwendet, eine Unterkunft zu bauen, wird er weder Essen noch Wasser haben.
Rich muss mit seiner Zeit sparsam umgehen. Er muss auch andere Ressourcen sparen. Er kann es sich nicht leisten, alle Kokosnüsse von den Palmen zu schütteln, nur damit dann die verrotten, die er nicht essen kann. Obwohl er gerne Wasser zum Kochen hätte, hat er doch nur genug zum Trinken. Daher muss er seine Wasservorräte fürs Trinken verwenden, wenn er überleben will.
Wie entscheidet Rich, auf welche Weise er seine knappen Ressourcen einsetzt? Um das zu tun, muss Rich wählen. Sogar nachdem er das Überleben als sein erstes Ziel ausgewählt hat, muss er immer noch entscheiden, wie er es erreichen will. Und solange Rich seinen Minimalbedarf mit einem geringeren als seinem höchsten Arbeitsaufwand erreichen kann, muss er auch entscheiden, wie er diese Überschussenergie verwendet. Vielleicht ist Rich sehr eitel und es kümmert ihn sehr, wie er aussehen wird, wenn er gerettet wird. In diesem Fall wird er einen großen Teil seiner Überschussenergie für sein Aussehen aufwenden. Wenn er sehr risikoscheu ist, wird er seine Zeit damit verbringen, einen Lebensmittelvorrat anzulegen. Wenn er ein Wissenschafter ist, könnte er Experimente mit der lokalen Flora und Fauna anstellen.
Ökonomie beschäftigt sich nicht damit, wie Rich zu seinen Werten kommt. Sie betrachtet es als ihren Ausgangspunkt, dass Menschen manche Dinge höher schätzen als andere und dass ihre Handlungen diese Wertschätzungen widerspiegeln. Für die Ökonomie gilt es definitiv als gegeben, dass das, was höher geschätzt wird, ausgewählt wird und dass das aufgegeben wird, was niedriger geschätzt wird. Genau das ist die Logik des menschlichen Handelns und schon allein der Gedanke an Wesen, die dieser Logik nicht folgen, wäre für uns arg verwirrend.
Nehmen wir an, ich hätte Urlaub in Athen machen können, habe aber stattdessen Istanbul gewählt. Es ist ein sehr ungenauer Ausdruck, wenn man sagt, „ich hätte eigentlich Athen vorgezogen“, obwohl man Istanbul gewählt hat. Die Tatsache, dass ich in Wirklichkeit nach Istanbul gegangen bin, ist das eigentliche Vorziehen. Vielleicht habe ich es getan, weil die Flugpreise in die Türkei niedriger waren oder weil meine Frau sich für Istanbul entschieden hatte und ich nicht streiten wollte. Was auch immer, ich wählte Istanbul und nahm die damit verbundenen Kosten in Kauf, um dorthin zu kommen, weil ich diese Option Athen und den damit verbundenen Kosten, dorthin zu gelangen, vorzog.
Wenn wir sagen, dass mein Votum für Istanbul zeigt, dass ich es vorzog, bedeutet das nicht, dass ich danach nicht doch noch zum Schluss kommen kann, dass mein ursprüngliches Urteil falsch war. Nach der Reise könnte ich entscheiden, dass Istanbul nichts für mich ist und ich Athen hätte wählen sollen. Wir müssen sorgfältig darauf achten, dass wir Bewertungen im Vorhinein und im Nachhinein unterscheiden. Handeln setzt lernen voraus und lernen setzt voraus, dass ich, wenn ich A wähle, manchmal entdecken werde, dass ich eigentlich B hätte wählen sollen.
Die Vorstellung, dass wir immer das wählen, was wir vorziehen, mag etwas extrem erscheinen. Sie möchten vielleicht unter Protest geltend machen: „Ich ziehe es nicht vor, zum Zahnarzt zu gehen, trotzdem tue ich es.“ Umgangssprachlich ist diese Aussage in Ordnung, aber Ökonomie muss präziser sein. Wenn Sie die Entscheidung treffen, dann wägen Sie den Nutzen des Nicht-zum-Zahnarzt-Gehens (d. h. kein Bohren) mit den Kosten (Karies) ab. Die Tatsache, dass sie dann doch gehen, setzt voraus, dass Sie den Zahnarzt der Alternative der verfaulten Zähne vorziehen, trotz des Schmerzes, den das mit sich bringt. Was Sie meinen, lautet präzis formuliert, dass Sie wünschen, dass Zähne niemals kariös würden und Zahnärzte unnötig wären.
Ökonomie beschäftigt sich nicht mit der Welt der Wünsche und müßiger Phantasien – außer wenn diese Tagträume sich in Handlungen manifestieren. In der Alltagssprache können wir sagen: „Ich hätte gerne einen Eistee, wenn ich nach Hause komme.“ Das zeigt einen Handlungsplan an. Aber für die Ökonomie ist es die Handlung selbst, die zählt, und der Plan hat nur so weit Bedeutung, als er die Handlung beeinflusst. Präferenzen werden vom Standpunkt der Ökonomie aus im Moment der Entscheidung wirklich. Sie können ständig versichern, dass Sie lieber abnehmen statt Kuchen zu essen. Aber die Ökonomie ignoriert solche Zusicherungen. Sie ist nur daran interessiert, was passiert, wenn das Tablett mit den Nachspeisen serviert wird.
Also entscheidet sich Rich und teilt seine Zeit auf. Sagen wir, dass er jeden Tag die ersten vier Stunden damit verbringt, Essen zu sammeln, die nächsten zwei schöpft er Wasser und die nächsten vier arbeitet er an einem Unterstand. Den Rest des Tages ruht er aus.
Alle der oben angeführten Handlungen haben das Ziel, Unzufriedenheit zu beseitigen. Das Essen stillt direkt seinen Hunger, das Wasser seinen Durst und der Unterstand deckt sein Bedürfnis nach Schutz vor Wind und Regen. Sogar seine Freizeit ist eine Handlung mit dem Gedanken an ein Ziel: Erholung. Solange Rich körperlich dazu im Stande ist, mit der Arbeit fortzufahren, besteht die Entscheidungsmöglichkeit, aufzuhören und auszuruhen.
Wir werden den Punkt betrachten, an dem Rich seine Entscheidung trifft, weil er die wesentliche Erkenntnis illustriert, mit der Carl Menger das Wertproblem löste, das die klassische Ökonomie geplagt hatte.[2] Stellen Sie sich vor, dass Rich versucht, Pfosten für seinen Unterstand miteinander zu verbinden. Er hat gegessen, er hat Wasser und mit dem Unterstand geht es ganz nett vorwärts. Darüber hinaus fühlt er sich langsam ein bisschen erschöpft.
Wann wird er dann mit der Arbeit aufhören? Das wird an dem Punkt geschehen, wenn die Befriedigung, die Rich von der nächsten „Einheit“ an Arbeit erwartet, niedriger ausfällt als die Befriedigung, die Rich von der ersten „Einheit“ an Ausruhen erwartet. Diese Tatsache wird schon alleine durch die Existenz des Auswählens vorausgesetzt. Auswählen bedeutet, etwas zu reihen. Daher wird Rich arbeiten, solange er den Gewinn, den er aus der nächsten Arbeitseinheit erwartet, dem Gewinn vorzieht, den er aus der nächsten Ruheeinheit erwartet.
Die „Einheit“, um die es hier geht, ist einfach das Zeitintervall, in das Rich seine Arbeit gedanklich unterteilt. Die nächste Einheit könnte zum Beispiel darin bestehen, den nächsten Satz Pfosten zusammenzubinden oder eine Kokosnuss zu pflücken. Die Einheit wird sehr wahrscheinlich eine Aufgabe sein, die es nicht wert ist, begonnen zu werden, wenn sie nicht fertiggestellt wird. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn Rich eine Kokosnuss pflückt, sie dann aber zu Boden fallen lässt und nach Hause geht, ohne sie in seine Tasche zu geben. Die Menge an Zeit, die Rich als Einheit betrachtet, wird von Aufgabe zu Aufgabe und von Tag zu Tag verschieden sein, selbst wenn sie dieselbe Arbeit betrifft – sie ist subjektiv. Was zählt, ist die spezielle Aufgabe, die er gerade in dem Moment als nächste Handlung betrachtet, wenn er Feierabend macht.
Rich ist gerade dabei, mit dem Zusammenbinden der Pfosten zu beginnen, als er ein leichtes Stechen im Rücken spürt. „Hm“, fragt er sich, „Zeit zum Ausruhen?“ In diesem Moment trifft er eine Wahl, und zwar zwischen der Befriedigung, die er meint, aus dem Zusammenbinden des nächsten Bündels an Pfosten zu gewinnen und der Befriedigung, die er glaubt von einigen Minuten an Ausruhen zu erhalten. Weil Bevorzugung an einen konkreten Akt der Auswahl zwischen speziellen Mitteln gebunden ist, die auf einen speziellen Zweck abzielen, wählt die ökonomische Entscheidung nicht zwischen Abstraktionen. Rich wählt nicht zwischen „Arbeit“ und „Freizeit“ an sich, sondern zwischen einer besonderen Arbeit und einer speziellen Dauer von Freizeit, und das unter speziellen Umständen.
Diese Erkenntnis löst das Wertparadoxon, das die klassischen Ökonomen verhext hatte. „Warum“, so fragten sie sich, „wenn Wasser um so viel mehr wert ist als Diamanten, zahlen Menschen so viel für Diamanten und so wenig, wenn nicht gar nichts, für Wasser?“ Die katastrophale Arbeitswerttheorie, die versuchte, den Wert einer Ware mit der Menge an Arbeit gleichzusetzen, die in das Gut eingegangen war, wurde entwickelt, um dieses Manko zu beheben. Karl Marx baute einen Großteil seines Gedankengebäudes auf der Arbeitswerttheorie auf.
Was den klassischen Ökonomen entging, ist die Tatsache, dass niemand jemals zwischen „Wasser“ und „Diamanten“ wählt. Das sind lediglich abstrakte Begriffe, mit denen wir die Welt kategorisieren. In der Realität trifft auch niemand eine Wahl zwischen „allem Wasser in der Welt“ und „allen Diamanten in der Welt“. Wenn ein handelnder Mensch wählt, dann ist er mit einer Auswahl zwischen konkreten Mengen von Gütern konfrontiert. Er hat die Wahl zwischen, sagen wir, einem Fass Wasser und einem Zehn-Karat-Diamanten.
„Warten Sie“, möchten Sie hier einwenden, „ist das Wasser nicht immer noch nützlicher als der Diamant?“ Die Antwort lautet: „Das hängt davon ab.“ Es hängt vollständig von der Bewertung der Person ab, die vor der Entscheidung steht. Ein Mensch, der gleich neben einem Bergbach voll von klarem sauberen Wasser lebt, wird ein Fass Wasser nicht hoch schätzen (wenn überhaupt), wenn ihm eines angeboten wird. Der Bergbach versorgt ihn mit mehr Wasser als er verwenden kann. Der Nutzen der zusätzlichen Wassermenge ist für ihn gleich null (vielleicht ist er sogar negativ, weil ihn das Wasserfass ärgert, das dann ständig im Weg steht). Aber dieser Bursche hat vielleicht keine Diamanten, also könnte die Möglichkeit, einen zu erwerben, für ihn verlockend sein. Es ist klar, dass der Mann Diamanten höher einschätzen wird als Wasser.
Wenn wir die Lebensumstände desselben Menschen ändern, könnte sich seine Bewertung vollständig ändern. Wenn er die Sahara mit einem Diamanten in der Tasche durchquert, ihm aber das Wasser ausgeht und er am Rande des Verdurstens steht, wird er höchstwahrscheinlich den Diamanten sogar für ein Glas Wasser hergeben (wenn er ein Geizhals ist, könnte er den Diamanten immer noch höher bewerten als das Wasser, selbst wenn er dabei das Risiko eingeht, an Durst zu sterben).
Der Wert von Gütern ist subjektiv – genau dieselbe Menge Wasser beziehungsweise Diamant kann von verschiedenen Personen verschieden bewertet werden und sogar von derselben Person zu verschiedenen Zeiten verschieden bewertet werden. Um es mit Menger auszudrücken:
„Wert ist daher keine inhärente Eigenschaft von Gütern, sondern die Wichtigkeit, die wir der Befriedigung unserer Bedürfnisse zuschreiben […] und die wir konsequenterweise auf ökonomische Güter […] übertragen als den Ursachen der Befriedigung unserer Bedürfnisse (Grundsätze der Volkswirthschaftslehre).“
Viele Mittel können für mehr als nur einen Zweck eingesetzt werden. Rich könnte Wasser für viele Verwendungen einsetzen. Zuerst wird er Mittel, die mehr als einem Zweck dienen können, der Verwendung zuführen, die er für die wichtigste hält. Das ist keine Tatsache, die aus Beobachtungen unzähliger Handlungen abgeleitet wurde, sondern eine logische Notwendigkeit. Wir können sagen, dass die erste Verwendung für Rich die wichtigste war, und zwar genau deshalb, weil er sich dazu entschlossen hat, dieses gefühlte Bedürfnis zuerst zu stillen.
So lange wie es Richs Ziel ist zu überleben, wird er den ersten Kübel Wasser, den er schöpfen kann, zum Trinken verwenden. Nur dann, wenn er sicher ist, dass er genug Wasser hat, um nicht zu verdursten, wird er es in Betracht ziehen, es zum Kochen zu verwenden. Nachdem jeder Kübel Wasser für einen weniger wichtigen Zweck eingesetzt wird, hat also für Rich jeder weitere Kübel einen niedrigeren Wert als einer der vorher errungenen. Der Nutzen jedes zusätzlichen Kübels nimmt für Rich ab. Wenn er eine Wahl treffen muss, dann ist es jeweils das nächste Stück, das erworben wird oder das erste, das aufgegeben werden muss, das von Belang ist. Ökonomen nennen dies die marginalen Einheiten und bezeichnen das Prinzip als das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens.
Die Spanne, um die es geht, ist weder eine physikalische Eigenschaft des betrachteten Ereignisses, noch kann sie objektiv berechnet werden. Die Spanne ist die Grenzlinie zwischen Ja und Nein, zwischen Auswählen und Zur-Seite-Legen. Die marginale Einheit ist diejenige, über die Sie entscheiden: Werden Sie heute eine zusätzliche Stunde arbeiten? Sollten Sie auf einer Party bleiben und sich noch einen Drink genehmigen? Werden Sie einen weiteren Tag in diesem Hotel an Ihren Urlaub anhängen?
Das sind ganz andere Fragen als „Ist Arbeiten eine gute Sache?“, „Sind Urlaube erholsam?“. Was zur Frage steht, ist, ob die nächste Arbeitsstunde mehr Nutzen bringt als eine weitere Stunde Freizeit. Ist die Erholung durch einen weiteren Tag Urlaub die Kosten wert? Unsere Entscheidungen treffen wir an der Grenzlinie und sie beziehen sich auf die Grenzeinheit.
Wenn Rich sein Tagwerk beginnt, dann ist der Grenznutzen, den er von einer Stunde Arbeit erwartet, wesentlich höher als der einer Stunde Freizeit. Wenn er nicht mit der Arbeit anfängt, wird er nicht essen und nicht trinken können! Aber jede weitere Arbeitsstunde ist einem Vorhaben gewidmet, das weniger wichtig ist als das vorhergehende. Zuletzt – sagen wir nach zehn Stunden – ist Rich an einem Punkt angelangt, an dem die Befriedigung, die er von einer weiteren Arbeitsstunde erwartet, unter die Befriedung gefallen ist, die er von einer Stunde Freizeit erwartet. Der Grenznutzen der nächsten betrachteten Arbeitsstunde ist unter den Grenznutzen der nächsten Stunde an Freizeit gefallen und Rich macht eine Pause.
Die Frage der Bewertung wird im Moment der Entscheidung gelöst. Weil jede Handlung auf eine ungewisse Zukunft ausgerichtet ist, gibt es immer die Möglichkeit von Fehlern. Rich könnte etwa entscheiden, dass er genug Essen gesammelt hat und ein Schläfchen machen. Während er schläft, stiehlt ein Affe die Hälfte der Kokosnüsse. Im Rückblick könnte er die Entscheidung bereuen und entscheiden, dass er mehr Essen hätte sammeln sollen oder stattdessen einen Zaun hätte bauen sollen. Vielleicht wird seine Bewertung anders ausfallen, wenn er wieder vor einer solchen Entscheidung steht. Er hat gelernt.
Die Unsicherheit der Zukunft ist durch die Existenz des Handelns an sich vorausgesetzt. In einer Welt, in der die Zukunft mit Sicherheit bekannt ist, ist kein Handeln möglich. Wenn ich weiß, was passieren wird, und es keine Möglichkeit gibt, es zu ändern, macht es keinen Sinn, es zu versuchen. Wenn ich sehr wohl handeln kann, um den zukünftigen Lauf der Dinge zu verändern, dann ist die Zukunft überhaupt nicht vorbestimmt.
Die Tatsache, dass frühere Handlungen später vielleicht bereut werden, entkräftet die Tatsache nicht, dass Menschen das auswählen, was sie bevorzugen – zu dem Zeitpunkt, an dem die Auswahl getroffen werden muss. Wacht man mit einem Kater am Sonntagmorgen auf, dann wird man vielleicht die Party von Samstagabend bereuen. Trotzdem ging man am Samstagabend lieber zur Party als sich ins Bett zu legen.
Es ist wahr, dass ein Überschwang der Gefühle gewisse Handlungen wesentlich erstrebenswerter scheinen lässt als sie das in Momenten kühler Betrachtung wären. Trotzdem wird ein Fußballfan, der von den höhnischen Bemerkungen eines Fans der gegnerischen Mannschaft so provoziert wurde, dass er ihm einfach „eine schmieren muss“, sich zurückhalten, wenn sich ein Polizist zwischen ihn und seinen Gegner stellt. Ein verheirateter Mann, so entflammt, dass er sich „nicht mehr zurückhalten kann“, einer Frau Avancen zu machen, wird aufhören, wenn seine Frau auf der Bildfläche erscheint.
Intensive Gefühle sind ein anderer Faktor, der beim Auswählen Gewicht hat. Aber die Tatsache, dass Menschen manchmal sehr wohl ihren Leidenschaften widerstehen, zeigt, dass sie auch unter diesen Umständen eine Auswahl treffen. Menschen sind nur unter bestimmten Umständen wirklich nicht fähig, zu wählen, zum Beispiel im Endstadium des Säuferwahnsinns, bei Senilität, nach schweren Hirnschäden oder als Säugling. Aber solche Menschen sind keine ökonomisch Handelnden, und die Ökonomie versucht nicht, die Handlungen von Menschen unter diesen Umständen zu beschreiben. Selbst bei vollem Bewusstsein gibt es für Menschen Momente der reinen Reaktion. Es gibt keinen Plan oder eine tiefere Bedeutung, wenn Sie Ihre Hand schnell von einem heißen Ofen wegziehen oder wenn sie sich bei lauten Geräuschen von oben ducken. Ökonomie ist keine Theorie der Reaktion, sondern des absichtlichen Handelns. Es ist das andauernde Erforschen der Auswirkungen menschlichen Handelns.
[1] Statt der in Europa verbreiteten Gartenzwerge stellen Amerikaner anscheinend gerne Flamingostatuen in ihre Gärten [Anmerkung des Übersetzers].
[2] Es stellt einen der über die Geschichte der Wissenschaft verteilten Fälle gleichzeitiger Entdeckung dar, dass Léon Walras und William Stanley Jevons, die unabhängig von Menger arbeiteten, in den frühern 1870er Jahren zu ähnlichen Lösungen gelangten.