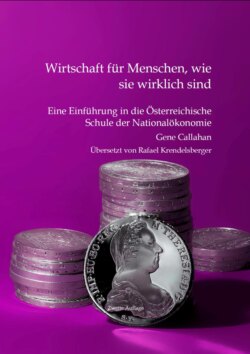Читать книгу Wirtschaft für Menschen, wie sie wirklich sind - Gene Callahan - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Was studieren wir?
ОглавлениеWenn wir uns zuerst einer Wissenschaft annähern, möchten wir wissen, womit sie sich beschäftigt. Ein anderer Weg, die selbe Angelegenheit anzupacken, besteht darin, zu fragen: „Welche grundsätzlichen Annahmen trifft sie, um die Welt zu untersuchen?“ Wenn man ein neues Fachgebiet in Angriff nimmt, besteht der erste Schritt darin, einen Eindruck davon zu gewinnen, worum es geht. Bevor man sich ein Biologiebuch kauft, wird man sich vergewissern, dass man etwas über Lebewesen lesen wird. Am Anfang einer Chemievorlesung stellt man fest, dass man erwarten kann, etwas über die Art und Weise zu erfahren, wie sich Elemente zu verschiedenen Verbindungen kombinieren lassen.
Viele Leute haben das Gefühl, dass sie im Großen und Ganzen mit Ökonomie vertraut sind. Fragt man sie jedoch, dann stellt sich heraus, dass sie Probleme damit haben, das Fachgebiet zu definieren. „Es ist Geldforschung“, werden Ihnen einige mitteilen. „Es geht um Betriebe, Gewinn und Verlust und so weiter“, wird jemand anderer versichern. „Nein, es geht darum, wie die Gesellschaft sich entscheidet, Wohlstand zu verteilen“, argumentiert eine andere Person. „Falsch! Es ist die Suche nach mathematischen Mustern, die Preisveränderungen beschreiben", beharrt ein vierter. Professor Israel Kirzner weist in The Economic Point of View darauf hin, dass es selbst unter Berufsökonomen eine ganze Reihe von Formulierungen über die wirtschaftliche Betrachtungsweise gibt, deren Vielfalt erstaunlich ist.
Der hauptsächliche Grund für diese Verwirrung liegt darin, dass Ökonomie eine der jüngsten Wissenschaften ist, die der Menschheit bekannt sind. Natürlich hat es eine Vermehrung von neuen Zweigen existierender Wissenschaften in den Jahrhunderten gegeben, seit man Ökonomie als eigenständiges Fachgebiet erkannt hat. Aber Molekularbiologie zum Beispiel ist ein Teil der Biologie, keine brandneue Wissenschaft.
Ökonomie dagegen ist anders. Die Existenz einer eigenen Wirtschaftswissenschaft lässt sich zurückverfolgen bis zur Entdeckung der Tatsache, dass es vorhersagbare Gesetzmäßigkeiten in der Wechselwirkung zwischen Menschen in der Gesellschaft gibt und dass diese Gesetzmäßigkeiten entstehen, ohne dass sie irgendjemand plant.
Die vage Vorstellung solcher Gesetzmäßigkeiten, abseits von den mechanischen Gesetzmäßigkeiten des Universums und den bewussten Plänen irgendeines Individuums war das erste Auftauchen der Idee der spontanen Ordnung im wissenschaftlichen Bewusstsein des Westens. Bevor sich die Ökonomie als Wissenschaft etablierte, wurde einfach angenommen, dass, wenn man eine Ordnung entdeckte, sie von jemand geordnet worden sein musste – von Gott im Falle der physikalischen Gesetze und von bestimmten Menschen im Falle von Objekten und Institutionen, die von Menschen gemacht worden waren.
Frühe politische Philosophen schlugen verschiedenste Pläne zur Organisation der menschlichen Gesellschaft vor. Funktionierte der Plan nicht, dann nahm der Schöpfer des Planes im Allgemeinen an, dass die Herrscher oder die Bürger nicht tugendhaft genug gewesen waren, um seinen Plan auszuführen. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass sein Plan universellen Regeln des menschlichen Handelns widersprach und nicht gelingen konnte, egal wie tugendhaft die Teilnehmer waren.
Die Zunahme an menschlicher Freiheit, die in Europa während des Mittelalters begann und in der Industriellen Revolution gipfelte, deckte eine klaffende Lücke im existierenden Bauplan des Wissens auf. Die Gesellschaft in Westeuropa wurde immer weniger nach den Befehlen eines Herrschers gestaltet. Nach und nach fielen Produktionsbeschränkungen. Die Gilden konnten den Zugang zu Handwerk und Gewerbe nicht mehr so strikt kontrollieren. Trotzdem gab es anscheinend immer gerade die richtige Anzahl an Zimmermännern, Schmieden, Maurern und so weiter. Kein königliches Privileg war mehr notwendig, um irgendeine Produktion zu beginnen. Und obwohl jeder eine Brauerei eröffnen konnte, wurde die Welt trotzdem nicht mit Bier überflutet. Und auch sonst wurde anscheinend immer gerade die richtige Menge hergestellt. Ohne dass irgendjemand einen „Masterplan“ für die Einfuhren in eine Stadt aufstellte, war die Mischung an Gütern, die an den Stadttoren auftauchte, im Großen und Ganzen richtig. Im 19. Jahrhundert stellte der französische Ökonom Frédéric Bastiat zum Wunder dieser Erscheinung fest: „Paris wird ernährt!“ Ökonomie hat diese Gesetzmäßigkeiten nicht geschaffen, noch hat sie die Aufgabe, deren Existenz zu beweisen – wir sehen sie jeden Tag vor unseren Augen. Ökonomie muss stattdessen erklären, wie diese Gesetzmäßigkeiten zustande kommen.
Viele Gelehrte haben zur herandämmernden Erkenntnis beigetragen, dass Ökonomie ein neuer Weg ist, die Gesellschaft zu betrachten. Die Ursprünge der Wirtschaftswissenschaften reichen weiter zurück, als man oft annimmt, sicher bis zumindest ins 15. Jahrhundert. Die Arbeiten der Spätscholastiker an der Universität von Salamanca in Spanien bewegten Joseph Schumpeter später dazu, sie zu den ersten Wirtschaftswissenschaftern zu ernennen.
Adam Smith war wohl nicht der erste Ökonom, wie er manchmal genannt wird. Aber mehr als jeder andere Sozialphilosoph machte er die Idee populär, dass Menschen, wenn sie nur die Freiheit besitzen, ihre eigenen Ziele zu verfolgen, eine soziale Ordnung hervorbringen, die niemand bewusst geplant hat. Der berühmte Ausspruch von Smith in The Wealth of Nations lautet sinngemäß, dass freie Menschen so handeln, als würden sie von einer unsichtbaren Hand geleitet, um ein Ziel voranzutreiben, das kein Teil ihrer Absicht war.
Der Österreichische Ökonom Ludwig von Mises sagte in seinem Hauptwerk Nationalökonomie dass die folgende Entdeckung Leute verblüffte:
„Es gibt also, musste man sich sagen, auch für die Betrachtung menschlichen Verhaltens in der Gesellschaft einen anderen Gesichtspunkt als den von gut und böse, von gerecht und ungerecht. Auch im Gesellschaftlichen waltet eine Gesetzmäßigkeit, der sich das Handeln anzupassen hat, wenn es erfolgreich sein will.“
Mises beschreibt die anfänglichen Schwierigkeiten, die Natur der Ökonomie festzulegen, so:
„An der neuen Wissenschaft schien alles problematisch zu sein. Sie war ein Fremdkörper im System der alten Wissenschaften, und man wusste nicht, wie man sie klassifizieren und rubrizieren sollte. Doch man war anderseits davon überzeugt, dass es zur Einreihung der Nationalökonomie in den Katalog der Wissenschaften keiner Umgestaltung oder Erweiterung des Katalogschemas bedürfe. Man hielt das Katalogsystem für vollständig; wenn die Nationalökonomie nicht hineinzupassen schien, so musste es an der unzulänglichen Behandlung ihrer Probleme durch die Nationalökonomen liegen.“
Bei vielen wich die Verblüffung bald der Enttäuschung. Sie hatten Ideen zur Gesellschaftsreform, und nun stellten sie fest, dass die heranwachsende Wirtschaftswissenschaft ihnen im Weg stand. Die Ökonomie teilte den Reformern mit, dass manche Pläne zur sozialen Organisation fehlschlagen würden, unabhängig davon, wie gut sie ausgeführt würden, weil diese Pläne grundlegende Gesetze der menschlichen Interaktion verletzten.
Manche der Reformer, wie etwa Karl Marx, versuchten, das ganze Fachgebiet als ungültig hinzustellen, weil die errungenen Erkenntnisse der frühen Ökonomen ihre Reformideen entgleisen ließen. Ökonomen, so beklagte sich Marx, beschrieben einfach die Gesellschaft, wie sie sie unter der Vorherrschaft der Kapitalisten vorfanden. Es gebe keine wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die auf alle Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten anwendbar seien. Ganz besonders würden die Gesetze, die die Klassische Schule um Smith, Ricardo und Malthus formuliert hatten, nicht auf die Menschen zutreffen, die im zukünftigen sozialistischen Utopia leben würden. In Wirklichkeit, sagten die Marxisten, waren diese Denker nichts weiter als Verteidiger der Ausbeutung der Massen durch einige wenige Reiche. Die klassischen Wirtschaftswissenschafter waren, um es im Jargon der chinesischen Marxisten auszudrücken, „Lakaienhunde der imperialistischen Kriegstreiberschweine“.
Das Ausmaß, in dem Marx und gleich gesinnte Denker Erfolg damit hatten, die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften zu unterminieren, spiegelte die Zerbrechlichkeit dieser Fundamente wider. Die klassischen Ökonomen hatten viele wirtschaftliche Erkenntnisse gewonnen, aber sie wurden von gewissen Widersprüchen in ihren eigenen Theorien geplagt wie etwa von ihrer Unfähigkeit, eine schlüssige und widerspruchsfreie Werttheorie aufzustellen (wir werden später im Detail auf diese Schwierigkeiten zu sprechen kommen).
Es war Mises, aufbauend auf den Arbeiten früherer Österreichischer Ökonomen wie Carl Menger, der letztendlich Wirtschaftswissenschaften wieder errichtete, und zwar „auf dem stabilen Fundament einer allgemeinen Theorie menschlichen Handelns“.
Für manche Zwecke mag es wichtig sein, zwischen der allgemeinen Theorie menschlichen Handelns, die Mises Praxeologie nannte, und Wirtschaftswissenschaften als dem Teil dieser Wissenschaft, der sich mit dem Tauschen beschäftigt, zu unterscheiden. Da jedoch der Begriff Praxeologie keine weite Verwendung gefunden hat und eine scharfe Trennlinie zwischen Ökonomie und dem Rest der Praxeologie in einem einführenden Buch nicht wichtig ist, werde ich für die ganze Wissenschaft den Namen Ökonomie verwenden. Mises selbst verwendete den Begriff auf diese Art und Weise:
„Ökonomie […] ist die Theorie allen menschlichen Handelns, die allgemeine Wissenschaft der unveränderlichen Kategorien des Handelns und ihrer Durchführung unter allen denkbaren speziellen Bedingungen, unter denen Menschen handeln.“ (Human Action)
Was meint Mises mit „menschlichem Handeln“? Lassen wir ihn selbst sprechen:
„Handeln ist bewusstes Verhalten. Wir können auch sagen: Handeln ist Wollen, das sich in Tat und Wirken umsetzt und damit verwirklicht, ist ziel- und zweckbewusstes Sichbenehmen, ist sinnhafte Antwort des Subjekts – der menschlichen Persönlichkeit – auf die Gegebenheit der Welt und des Lebens.“ (Nationalökonomie)
Auf eine ähnliche Art und Weise drückte es der britische Philosoph Michael Oakeshott aus: Menschliches Handeln ist der Versuch, das, was ist, durch das zu ersetzen, was aus der Sicht des Individuums sein sollte.
Der Ursprung menschlichen Handelns ist in der Unzufriedenheit begründet, oder, wenn Sie das Glas als halb voll betrachten wollen, in der Vorstellung, dass das Leben besser sein könnte als es derzeit ist. Das, was ist, wird – auf welche Art und Weise auch immer – als unzulänglich beurteilt. Wenn wir satt und ganz damit zufrieden sind, wie die Dinge im Moment sind, dann haben wir keinen Antrieb zu handeln – denn jede Handlung könnte die Sache nur schlechter machen! Aber sobald wir in unserer Umwelt etwas wahrnehmen, das nicht ganz zufrieden stellend ist, dann ergibt sich die Möglichkeit, aktiv zu werden, um in dieser Situation Abhilfe zu schaffen.
Stellen Sie sich vor, dass Sie entspannt in einer Hängematte liegen, völlig glücklich und zufrieden mit der Welt um sich herum. Was sonst so vorgeht, ist Ihnen völlig egal. Plötzlich stört ein Summen Ihren Lenz. Es wird Ihnen klar, dass Sie sich sicher entspannter fühlen könnten, würde das Geräusch aufhören. Mit anderen Worten: Sie können sich Umstände vorstellen, die Ihrer Meinung nach herrschen sollten. Sie erleben den ersten Bestandteil menschlichen Handelns – Unzufriedenheit.
Aber Unzufriedenheit ist nicht genug. Zuerst müssen Sie die Ursache des Unwohlseins verstehen. Natürlich: es ist der Lärm. Aber wir können uns nicht einfach den Lärm wegwünschen. Um zu handeln, müssen wir verstehen, dass jede Ursache die Auswirkung einer anderen Ursache ist. Wir müssen einer Ursache-Wirkungs-Kette folgen, bis wir einen Ort erreichen, an dem wir meinen, dass unsere Intervention, unser Handeln, diese Kette unterbrechen und die Unzufriedenheit beseitigen wird. Wir müssen einen Plan vor uns haben, um uns von dem, was ist, zu dem zu bewegen, was sein sollte.
Wenn das Summen von einem Flugzeug stammt, das oben vorbeifliegt, dann werden Sie nichts machen (wenn Sie nicht gerade eine Flugabwehrkanone installiert haben, gibt es ja nicht viel, was Sie hier wegen des Flugzeugs unternehmen könnten). Sie müssen davon überzeugt sein, dass Ihre Handlung irgendeinen Effekt in Ihrer Welt haben kann. Um tätig zu werden, ist es aber nicht notwendig, dass Ihre Überzeugung richtig ist. Die Menschen in grauer Vorzeit glaubten oft, dass das Befolgen gewisser Riten ihre Umwelt zum Vorteil beeinflussen konnte, etwa um Dürren abzuwenden oder mehr Jagdbeute hervorzubringen. So weit ich weiß, haben diese Ansätze nicht funktioniert. Aber der Glaube, dass sie es würden, war ausreichend, um Menschen dazu zu bringen, sie durchzuführen.
Sie sehen sich also um und stellen fest, dass eine Mücke die Ursache des Lärms ist. Vielleicht können Sie wirklich etwas wegen des Lärms machen – Sie können den kleinen Quälgeist erledigen. Sie betrachten ein Ziel, nämlich die Mücke loszuwerden. Sie sehen, dass es Ihnen einen Nutzen bringen wird, das Ziel zu erreichen – der Lärm wird aufhören und Sie können ungestört ausruhen.
Sie könnten also aufstehen und die Mücke erledigen. Aber eigentlich hatten Sie etwas anderes im Sinn – nämlich lässig in der Hängematte herumzufaulenzen. Jetzt müssen Sie sich mit einer anderen Komponente menschlichen Handelns herumschlagen – Sie haben eine Entscheidung zu treffen. Es wäre großartig, die Mücke loszuwerden, aber dafür müssten Sie aufstehen. Und das ist zum Weinen. Der Vorteil, den Sie davon erwarten, die Mücke loszuwerden, kostet Sie etwas – Sie müssen aufstehen. Wenn der Vorteil die Kosten übertrifft, dann haben Sie aus Ihrem Handeln Gewinn gezogen.
Obwohl wir die Begriffe Gewinn oder Profit oft verwenden, um finanzielle Vorteile zu bezeichnen, ist ihre Bedeutung doch etwas umfassender, etwa wie im Ausspruch: „Was gewinnt ein Mensch, wenn er die Welt erobert, aber seine Seele verliert?“ Wir führen alle unsere Handlungen – seien es Aktienkäufe, sei es der Rückzug auf einen Berg, um dort zu meditieren – mit einem Blick auf Gewinn in diesem psychischen Sinn durch. Wie es das obige Zitat andeutet: Wenn wir uns dazu entscheiden, ein frommes Leben in Armut zu führen, dann deshalb, weil wir erwarten, dass wir am Ende mehr gewinnen, als es uns kostet, das Streben nach weltlichen Gütern aufzugeben. Wir erwarten, von der Entscheidung zu profitieren.
Entscheidungen bringen es mit sich, dass wir die Mittel berücksichtigen müssen, die notwendig sind, um unsere Ziele zu erreichen. Ich hätte nichts dagegen, der stärkste Mensch auf der Welt zu sein. Aber wenn ich darüber nachdenke, dieses Ziel zu verfolgen, muss ich auch daran denken, was ich tun muss, um es zu erreichen. Ich bräuchte Krafttraining, müsste Nahrungsmittelzusätze kaufen und viele Stunden pro Tag fürs Training verwenden. In unserer Welt erscheint nicht alles, was wir begehren, bloß weil wir es uns wünschen. Viele Dinge, die wir wollen, selbst wenn sie lebensnotwendig sind, erreichen wir erst, nachdem wir viel Zeit und Mühe darauf verwendet haben. Ausrüstung für Krafttraining fällt nicht einfach vom Himmel (Gott sei Dank!). Und wenn ich mehrere Stunden am Tag für Gewichtheben ausgebe, kann ich diese Zeit nicht dazu verwenden, ein Buch zu schreiben oder mit meinen Kindern zu spielen.
Für sterbliche Menschen stellt Zeit den Gipfel der knappen Güter dar. Sogar für Bill Gates ist der Vorrat an Zeit gering. Obwohl er am selben Morgen einen Privatjet nach Tahiti und Aruba chartern kann, kann er immer noch nicht an beide Orte gleichzeitig fliegen! Ein Mensch zu sein, bedeutet zu wissen, dass unsere Tage auf dieser Welt gezählt sind und dass wir uns entscheiden müssen, wie wir sie verwenden. Weil wir in einer Welt der Knappheit leben, bringt die Verwendung von Mitteln, um einen Zweck zu erreichen, Kosten mit sich. Für mich sind die Kosten der Zeit für das Krafttraining dadurch festgelegt, wie hoch ich die anderen – alternativen – Möglichkeiten bewerte, diese Zeit zu verbringen.
In der Ökonomie ist der Wert der Mittel, die wir wählen können, subjektiv. Niemand anderer vermag zu sagen, ob eine Stunde Gewichtheben mir mehr wert ist als eine, die ich mit Schreiben verbringe. Es gibt auch keine Möglichkeit, den Unterschied in meinen Bewertungen dieser Aktivitäten objektiv zu messen. Niemand hat ein „Valuemeter“ (Wertmessgerät) erfunden. Ausdrücke wie „dieses Abendessen war doppelt so gut wie das von gestern Abend“ sind einfach Metaphern. Sie setzen nicht voraus, dass es wirklich möglich ist, Zufriedenheit zu messen.
Wie Murray Rothbard betont hat, lässt sich das leicht verifizieren, und zwar, indem man fragt: „doppelt so viel wovon?“ Wir haben ja nicht einmal eine Einheit, um Zufriedenheit zu messen.
Eine von Carl Mengers wesentlichen Einsichten bestand darin, dass die Natur des Wertes subjektiv ist. Für die klassischen Ökonomen war Wert ein Paradoxon. Sie versuchten, ihre Werttheorie auf der Arbeit aufzubauen, die in die Herstellung von Gütern einfloss oder auf die – irgendwie objektiv gemessene – Nützlichkeit. Aber denken Sie an so einen einfachen Fall wie einen Diamanten, den Sie auf einem Spaziergang am Boden liegend finden. Keine Arbeit war notwendig, um den Diamanten zu produzieren noch ist er nützlicher als ein Glas Wasser – zumindest zur Lebenserhaltung. Und trotzdem gilt ein Diamant im Allgemeinen als viel wertvoller als ein Glas Wasser. Menger durchschlug diesen Gordischen Knoten, indem er seine Werttheorie genau darauf aufbaute – Sachen sind wertvoll, weil Menschen sie dafür halten.
Die Österreichische Schule versucht nicht zu beurteilen, ob die Auswahl von Zielen, die Sie verfolgen, weise ist. Sie erzählt uns nicht, dass wir falsch liegen, wenn wir ein gewisses Ausmaß an Erholung höher schätzen als einen bestimmten Geldbetrag. Sie betrachtet Menschen nicht als Wesen, denen es nur um finanzielle Gewinne geht. Nichts ist daran „unökonomisch“, wenn jemand ein Vermögen verschenkt oder einen hoch bezahlten Job aufgibt, um Mönch zu werden.
Ökonomie beschäftigt sich nicht mit der Frage, ob es objektive Werte gibt oder nicht. Noch einmal: das sollte nicht so verstanden werden, als ob die Österreichische Volkswirtschaftslehre irgendeiner Religion oder Ethik gegenüber feindlich eingestellt wäre. Ich selbst kenne Österreichische Ökonomen, die Katholiken, Atheisten, orthodoxe Juden, Buddhisten, Objektivisten, Protestanten oder Agnostiker sind. Würde ich mehr Ökonomen kennen, könnte ich noch Moslems, Hindus usw. anführen – dessen bin ich mir sicher. Den Vergleich von Werten sollte die Ökonomie der Ethik, der Religion und der Philosophie überlassen. Ökonomie ist nicht eine Theorie von allem und jedem, sondern einfach eine Theorie der Konsequenzen von Entscheidungen. Wenn wir Ökonomie studieren, nehmen wir die Ziele der Menschen als grundsätzlich gegeben hin. Menschen wählen – irgendwie – Ziele aus und handeln, um sie zu erreichen. Die Aufgabe unserer Wissenschaft besteht darin, die Folgen dieser Tatsachen zu erforschen.
Mises sagte in der Einführung zu Nationalökonomie:
„Im Wählen fallen alle menschlichen Entscheidungen. Im Wählen wird nicht nur zwischen materiellen Gütern und persönlichen Diensten entschieden. Alles Menschliche steht zur Wahl; jedes Ziel und jedes Mittel, Materielles und Ideelles, Hohes und Gemeines, Edles und Unedles stehen in einer Reihe und werden durch das Handeln gewählt oder zurückgestellt. Nichts, was Menschen begehren oder meiden wollen, bleibt der Ordnung und Reihung durch die Wertskala und durch das Handeln entzogen. Die subjektivistische Nationalökonomie erweitert das von den Klassikern bearbeitete Forschungsgebiet: aus der politischen Ökonomie geht die allgemeine Lehre vom menschlichen Handeln, die Praxeologie, hervor.“